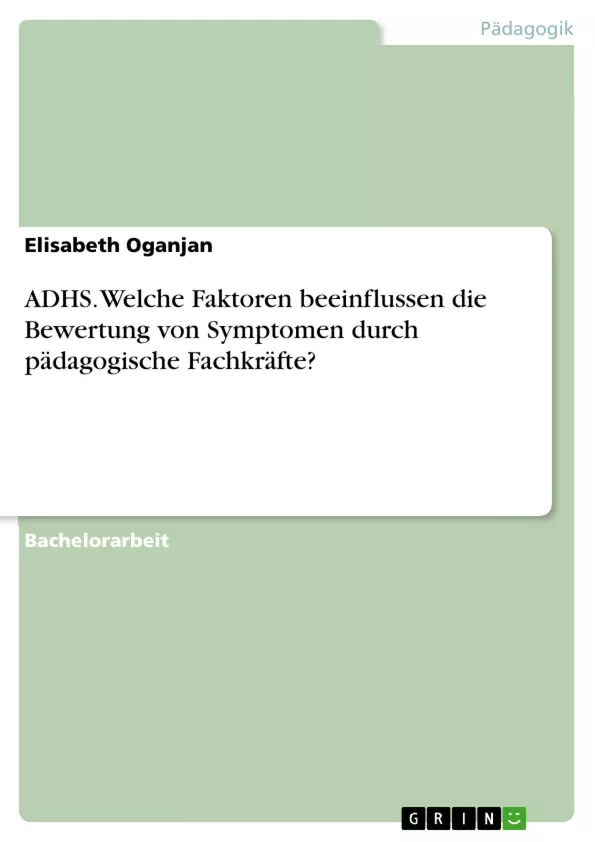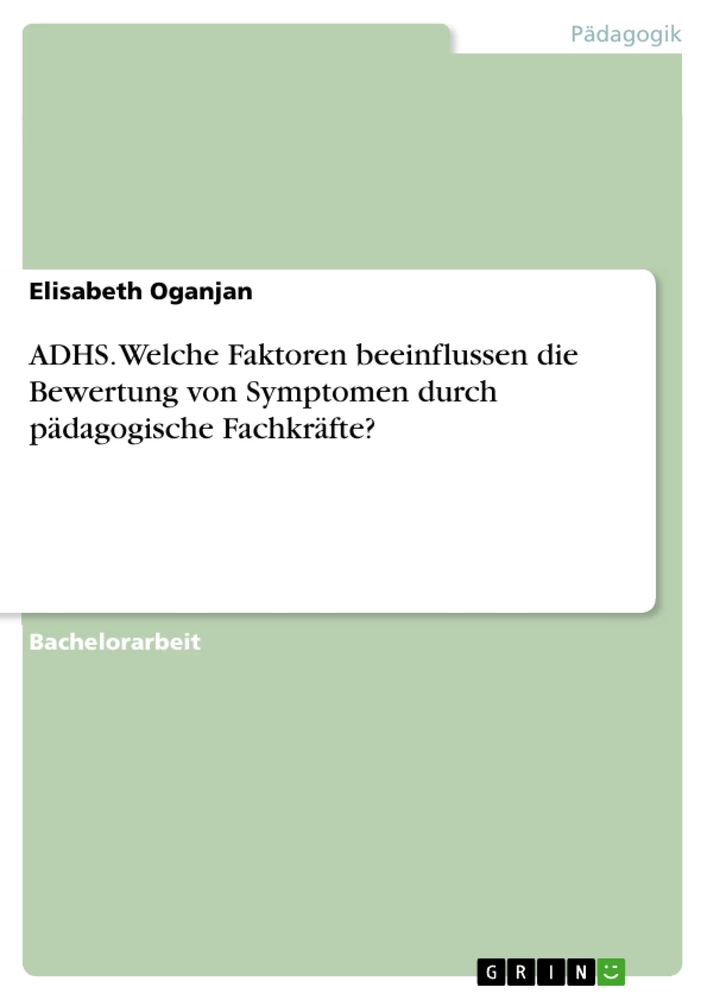
ADHS. Welche Faktoren beeinflussen die Bewertung von Symptomen durch pädagogische Fachkräfte?
Bachelorarbeit, 2016
60 Seiten, Note: 1,3
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Theoretische und empirische Grundlagen
- Aufmerksamkeitsdefizit-/ Hyperaktivitätsstörung (ADHS)
- Definition und Klassifikation
- Symptomatik
- Epidemiologie
- Ätiologie
- Diagnostik
- Therapie
- ADH-S-G
- Aufmerksamkeitsdefizit-/ Hyperaktivitätsstörung (ADHS)
- Methodik
- Fragestellung
- Forschungsstrategie und Datenerhebungsmethode
- Entwicklung des Fragebogens
- Ergebnisse
- Diskussion und Ausblick
- Diskussion
- Ausblick
- Quellenverzeichnis
- Abbildungsverzeichnis
- Anhang
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Faktoren, die die Bewertung von ADHS-Symptomen durch pädagogische Fachkräfte beeinflussen. Sie basiert auf einem Forschungsprojekt, das ein Screeninginstrument für die Früherkennung von ADHS-Symptomen in der Grundschule entwickelte. Die Arbeit zielt darauf ab, die Validität des Lehrerurteils bei der Diagnose von ADHS zu untersuchen, indem sie die Einflüsse von Faktoren wie Fortbildungen, Dienstalter und Einstellungen auf die Beurteilung von ADHS-Symptomen untersucht.
- Definition und Klassifikation von ADHS
- Epidemiologie und Ätiologie von ADHS
- Validität des Lehrerurteils bei der Diagnose von ADHS
- Einflussfaktoren auf die Bewertung von ADHS-Symptomen durch pädagogische Fachkräfte
- Entwicklung und Anwendung eines Fragebogens zur Erfassung von Einflussfaktoren
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung gibt einen Überblick über das Thema ADHS und seine Relevanz im Kontext der Schule. Sie stellt die Forschungsfrage und die Zielsetzung der Arbeit dar. Das zweite Kapitel behandelt die theoretischen und empirischen Grundlagen von ADHS, einschließlich Definition, Klassifikation, Symptomatik, Epidemiologie, Ätiologie, Diagnostik und Therapie. Es stellt auch das Screeninginstrument ADH-S-G vor. Das dritte Kapitel beschreibt die Methodik der Arbeit, einschließlich der Forschungsstrategie, der Datenerhebungsmethode und der Entwicklung des Fragebogens. Das vierte Kapitel präsentiert die Ergebnisse der Datenerhebung. Das fünfte Kapitel diskutiert die Ergebnisse und gibt einen Ausblick auf weitere Forschungsmöglichkeiten.
Schlüsselwörter
Aufmerksamkeitsdefizit-/ Hyperaktivitätsstörung (ADHS), Lehrerurteil, Diagnostik, Screeninginstrument, ADH-S-G, Einflussfaktoren, Fortbildungen, Dienstalter, Einstellungen, pädagogische Fachkräfte, Früherkennung, Validität.
Details
- Titel
- ADHS. Welche Faktoren beeinflussen die Bewertung von Symptomen durch pädagogische Fachkräfte?
- Hochschule
- Pädagogische Hochschule Freiburg im Breisgau
- Note
- 1,3
- Autor
- Elisabeth Oganjan (Autor:in)
- Erscheinungsjahr
- 2016
- Seiten
- 60
- Katalognummer
- V351942
- ISBN (eBook)
- 9783668388307
- ISBN (Buch)
- 9783668388314
- Dateigröße
- 1306 KB
- Sprache
- Deutsch
- Schlagworte
- adhs welche faktoren bewertung symptomen fachkräfte
- Produktsicherheit
- GRIN Publishing GmbH
- Preis (Ebook)
- US$ 20,99
- Preis (Book)
- US$ 29,99
- Arbeit zitieren
- Elisabeth Oganjan (Autor:in), 2016, ADHS. Welche Faktoren beeinflussen die Bewertung von Symptomen durch pädagogische Fachkräfte?, München, Page::Imprint:: GRINVerlagOHG, https://www.diplomarbeiten24.de/document/351942
- Autor werden
- Ihre Optionen
- Vertriebskanäle
- Premium Services
- Autorenprofil
- Textarten und Formate
- Services für Verlage, Hochschulen, Unternehmen

- © GRIN Publishing GmbH.
- Alle Inhalte urheberrechtlich geschützt. Kopieren und verbreiten untersagt.
- info@grin.com
- AGB
- Open Publishing
Der GRIN Verlag hat sich seit 1998 auf die Veröffentlichung akademischer eBooks und Bücher spezialisiert. Der GRIN Verlag steht damit als erstes Unternehmen für User Generated Quality Content. Die Verlagsseiten GRIN.com, Hausarbeiten.de und Diplomarbeiten24 bieten für Hochschullehrer, Absolventen und Studenten die ideale Plattform, wissenschaftliche Texte wie Hausarbeiten, Referate, Bachelorarbeiten, Masterarbeiten, Diplomarbeiten, Dissertationen und wissenschaftliche Aufsätze einem breiten Publikum zu präsentieren.
Kostenfreie Veröffentlichung: Hausarbeit, Bachelorarbeit, Diplomarbeit, Dissertation, Masterarbeit, Interpretation oder Referat jetzt veröffentlichen!
- GRIN Verlag GmbH
-
- Nymphenburger Str. 86
- 80636
- Munich, Deutschland
- +49 89-550559-0
- +49 89-550559-10
- info@grin.com
-