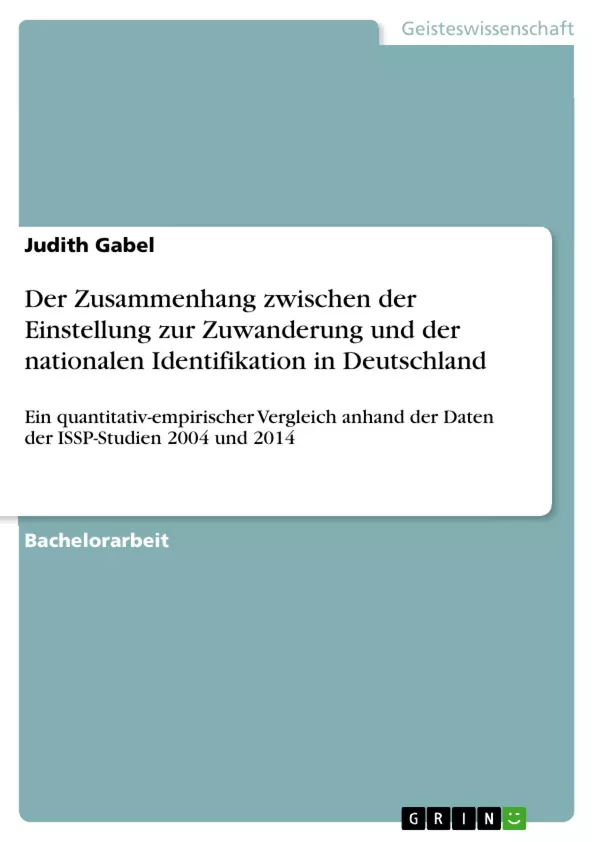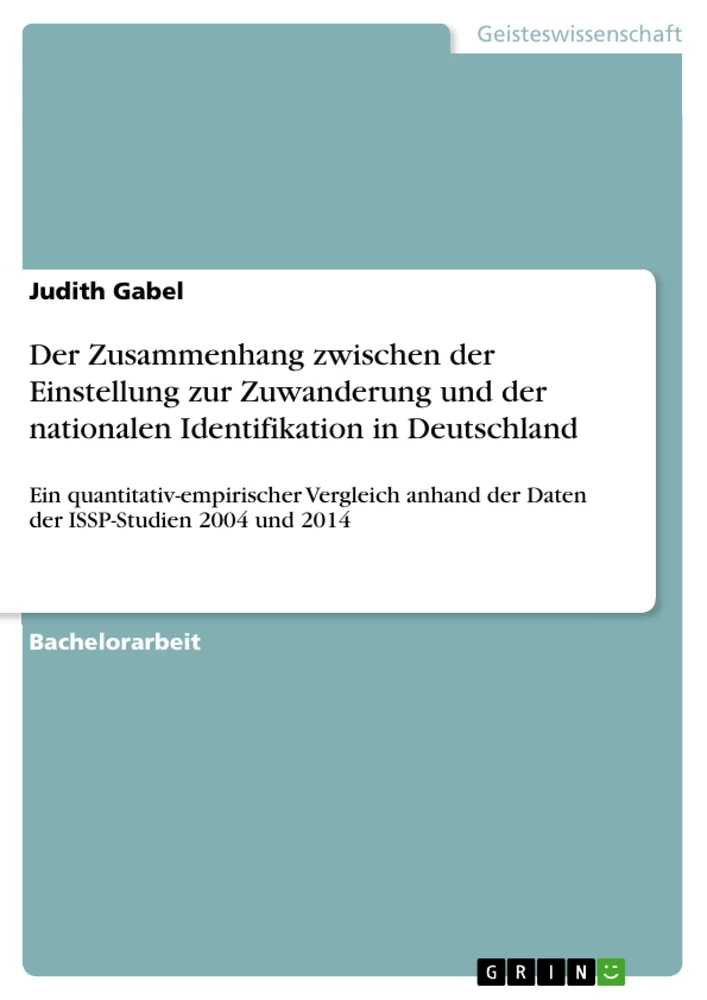
Der Zusammenhang zwischen der Einstellung zur Zuwanderung und der nationalen Identifikation in Deutschland
Bachelorarbeit, 2016
47 Seiten, Note: 1,7
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis (Table of Contents)
- 1. Einleitung: Zur Thematik der Zuwanderung und nationalen Identität
- 2. Theoretischer Bezugsrahmen
- 2.1 Einführung in den Identitätsbegriff
- 2.2 Die Theorie der sozialen Identität nach Henri Tajfel
- 2.3 Studien zur nationalen Identität und Fremdenfeindlichkeit
- 3. Eigene Untersuchung
- 3.1 Die ISSP-Studien 2004 und 2014 als Erhebungsinstrument
- 3.2 Darstellung der zentralen Variablen
- 3.3 Datenaufbereitung und Hypothesen
- 4. Empirische Erkenntnisse
- 4.1 Die Einstellung zur Zuwanderung in Deutschland der Jahre 2004 und 2014 im Vergleich: Univariate Analyse der drei abhängigen Variablen
- 4.2. Die Einstellung zur Zuwanderung in der BRD: Zusammenfassung der Ergebnisse
- 4.3 Die nationale Identifikation in der Bundesrepublik Deutschland der Jahre 2004 und 2014 im Vergleich: Univariate Analyse der unabhängigen Variablen
- 4.4 Die nationale Identifikation in Deutschland: Zusammenfassung der Ergebnisse
- 4.5 Der Zusammenhang bzw. Unterschied zwischen der Einstellung zur Zuwanderung und der nationalen Verbundenheit in Deutschland
- 4.6 Der Zusammenhang bzw. Unterschied zwischen der Einstellung zur Zuwanderung und dem kulturell-politischen Faktor einer nationalen Identität in Deutschland
- 4.7 Der Zusammenhang bzw. Unterschied zwischen der Einstellung zur Zuwanderung und dem Merkmal der ethnischen Abstammung als Indiz einer deutschen Identität
- 4.8 Der Zusammenhang bzw. Unterschied zwischen der Einstellung zur Zuwanderung und der Bewertung von religiöser Zugehörigkeit als Indiz einer deutschen Identität
- 4.9 Der Zusammenhang zwischen der Einstellung zur Zuwanderung und der nationalen Identifikation in der BRD: Zusammenfassung der Ergebnisse
- 5. Resümee und Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte (Objectives and Key Themes)
Diese Bachelorarbeit untersucht den Zusammenhang zwischen der Einstellung zur Zuwanderung und der nationalen Identifikation in Deutschland. Mithilfe von quantitativ-empirischen Daten der ISSP-Studien aus den Jahren 2004 und 2014 analysiert die Arbeit, wie sich Einstellungen zur Zuwanderung auf die nationale Identifikation von Bürgerinnen und Bürgern in Deutschland auswirken.
- Analyse der Einstellungen zur Zuwanderung in Deutschland
- Untersuchung der Entwicklung der nationalen Identifikation in Deutschland
- Erforschung des Zusammenhangs zwischen Einstellung zur Zuwanderung und nationaler Identifikation
- Analyse der Auswirkungen kultureller, politischer und ethnischer Faktoren auf die nationale Identität
- Anwendung und Interpretation der ISSP-Daten zur Beantwortung der Forschungsfragen
Zusammenfassung der Kapitel (Chapter Summaries)
- Kapitel 1: Einleitung - Diese Einleitung liefert einen Überblick über die Thematik der Zuwanderung und nationalen Identität und stellt die Relevanz des Themas in der gegenwärtigen deutschen Gesellschaft dar.
- Kapitel 2: Theoretischer Bezugsrahmen - In diesem Kapitel werden verschiedene theoretische Konzepte zur Erklärung von Identität und Fremdenfeindlichkeit vorgestellt, insbesondere die Theorie der sozialen Identität nach Henri Tajfel. Der Fokus liegt auf der Rolle von Gruppenprozessen und sozialer Kategorisierung im Kontext von nationalen Identitäten.
- Kapitel 3: Eigene Untersuchung - Dieses Kapitel beschreibt die Methodik der eigenen Untersuchung. Es werden die ISSP-Studien 2004 und 2014 als Erhebungsinstrument vorgestellt, die wichtigsten Variablen definiert und die Datenaufbereitung sowie die Hypothesenformulierung erläutert.
- Kapitel 4: Empirische Erkenntnisse - Hier werden die empirischen Ergebnisse der Analyse der ISSP-Daten präsentiert. Die Ergebnisse umfassen die Einstellung zur Zuwanderung, die nationale Identifikation sowie den Zusammenhang zwischen diesen beiden Variablen. Die Analyse umfasst sowohl univariate Analysen der einzelnen Variablen als auch multivariate Analysen zur Erforschung des Zusammenhangs.
Schlüsselwörter (Keywords)
Die Arbeit beschäftigt sich mit den zentralen Themen der nationalen Identifikation, der Einstellung zur Zuwanderung, der sozialen Identität und der Fremdenfeindlichkeit in Deutschland. Die Analyse stützt sich auf die ISSP-Daten und untersucht die Beziehung zwischen Einstellungen zur Zuwanderung und dem Verständnis der deutschen Identität. Weitere wichtige Begriffe sind: Gruppenprozesse, soziale Kategorisierung, kulturelle Faktoren, politische Faktoren, ethnische Abstammung, religiöse Zugehörigkeit.
Häufig gestellte Fragen
Gibt es einen Zusammenhang zwischen nationaler Identität und der Einstellung zu Zuwanderern?
Die Forschung untersucht, ob eine starke nationale Verbundenheit mit einer ablehnenden Haltung gegenüber Zuwanderung korreliert, wobei zwischen verschiedenen Identitätskonzepten (z.B. ethnisch vs. politisch) unterschieden werden muss.
Was ist die Theorie der sozialen Identität nach Tajfel?
Sie besagt, dass Menschen ihr Selbstwertgefühl aus der Zugehörigkeit zu Gruppen beziehen und dazu neigen, die eigene Gruppe (In-Group) aufzuwerten und andere Gruppen (Out-Group) abzuwerten.
Wie hat sich die Einstellung zur Zuwanderung zwischen 2004 und 2014 verändert?
Die Arbeit vergleicht ISSP-Daten beider Jahre, um Trends in der öffentlichen Meinung bezüglich der Anzahl und des kulturellen Wertes von Immigranten aufzuzeigen.
Worauf bezieht sich das "Deutsch-Sein" in der Bevölkerung?
Die nationale Identifikation kann sich auf ethnische Merkmale (Abstammung), kulturelle Faktoren (Sprache) oder politische Werte (Verfassungspatriotismus) stützen.
Welche Rolle spielt die Religion für die nationale Identität in Deutschland?
Die Untersuchung analysiert, inwieweit die Religionszugehörigkeit als Indiz für eine "echte" deutsche Identität gewertet wird und wie dies die Einstellung zu Migranten beeinflusst.
Details
- Titel
- Der Zusammenhang zwischen der Einstellung zur Zuwanderung und der nationalen Identifikation in Deutschland
- Untertitel
- Ein quantitativ-empirischer Vergleich anhand der Daten der ISSP-Studien 2004 und 2014
- Hochschule
- Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg (Institut für Humanwissenschaften)
- Note
- 1,7
- Autor
- Judith Gabel (Autor:in)
- Erscheinungsjahr
- 2016
- Seiten
- 47
- Katalognummer
- V352338
- ISBN (eBook)
- 9783668387096
- ISBN (Buch)
- 9783668387102
- Dateigröße
- 1685 KB
- Sprache
- Deutsch
- Schlagworte
- Zuwanderung Nationale Identität Fremdenfeindlichkeit Nationale Verbundenheit
- Produktsicherheit
- GRIN Publishing GmbH
- Preis (Ebook)
- US$ 19,99
- Preis (Book)
- US$ 29,99
- Arbeit zitieren
- Judith Gabel (Autor:in), 2016, Der Zusammenhang zwischen der Einstellung zur Zuwanderung und der nationalen Identifikation in Deutschland, München, Page::Imprint:: GRINVerlagOHG, https://www.diplomarbeiten24.de/document/352338
- Autor werden
- Ihre Optionen
- Vertriebskanäle
- Premium Services
- Autorenprofil
- Textarten und Formate
- Services für Verlage, Hochschulen, Unternehmen

- © GRIN Publishing GmbH.
- Alle Inhalte urheberrechtlich geschützt. Kopieren und verbreiten untersagt.
- info@grin.com
- AGB
- Open Publishing
Der GRIN Verlag hat sich seit 1998 auf die Veröffentlichung akademischer eBooks und Bücher spezialisiert. Der GRIN Verlag steht damit als erstes Unternehmen für User Generated Quality Content. Die Verlagsseiten GRIN.com, Hausarbeiten.de und Diplomarbeiten24 bieten für Hochschullehrer, Absolventen und Studenten die ideale Plattform, wissenschaftliche Texte wie Hausarbeiten, Referate, Bachelorarbeiten, Masterarbeiten, Diplomarbeiten, Dissertationen und wissenschaftliche Aufsätze einem breiten Publikum zu präsentieren.
Kostenfreie Veröffentlichung: Hausarbeit, Bachelorarbeit, Diplomarbeit, Dissertation, Masterarbeit, Interpretation oder Referat jetzt veröffentlichen!
- GRIN Verlag GmbH
-
- Nymphenburger Str. 86
- 80636
- Munich, Deutschland
- +49 89-550559-0
- +49 89-550559-10
- info@grin.com
-