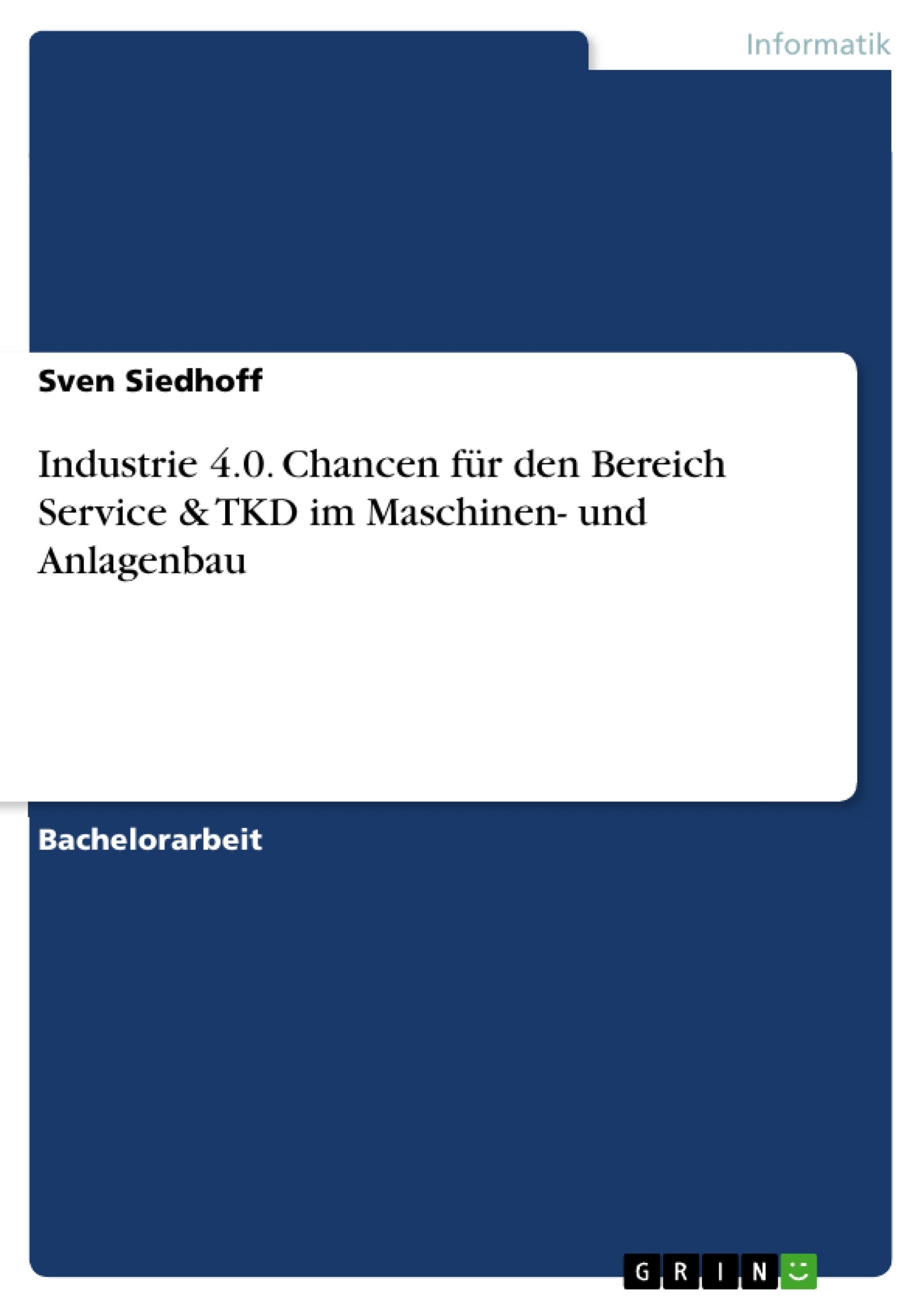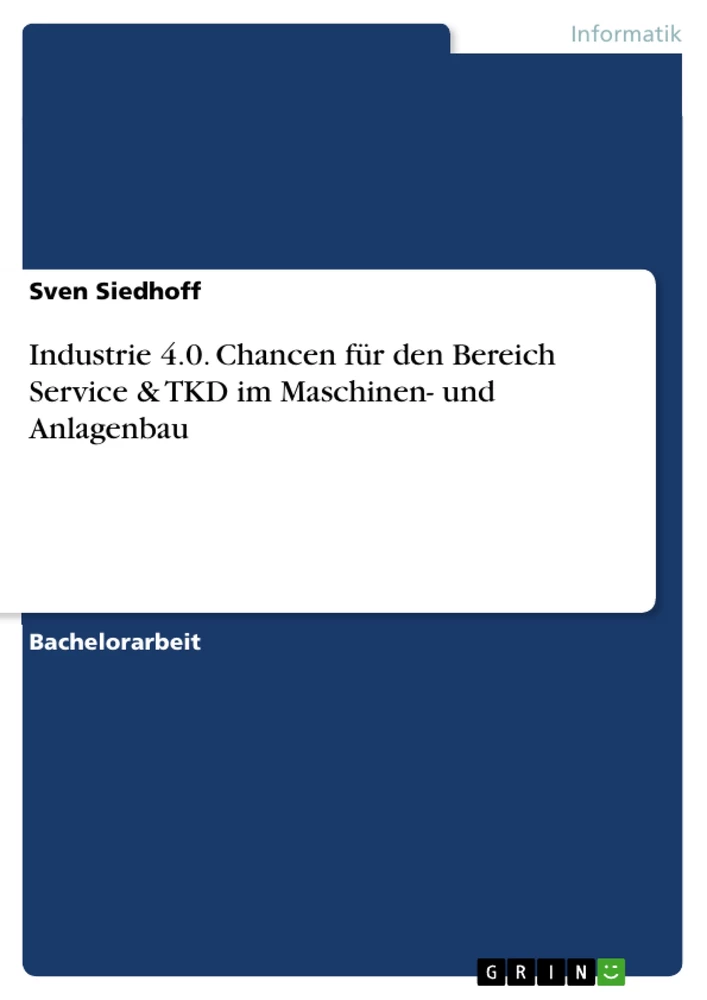
Industrie 4.0. Chancen für den Bereich Service & TKD im Maschinen- und Anlagenbau
Bachelorarbeit, 2016
37 Seiten, Note: 2,0
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis (Table of Contents)
- Einleitung
- Geschichte der Industrialisierung
- Die erste industrielle Revolution
- Die zweite industrielle Revolution
- Die dritte industrielle Revolution
- Industrie 4.0
- Was versteht man unter Industrie 4.0
- Chancen für die deutsche Industrie
- Technische Voraussetzungen
- IoT - Internet der Dinge
- Cyber-physische Systeme
- Smart Factory
- Big Data
- Chancen im Bereich Service durch Industrie 4.0
- Klassischer Service
- Präventive Instandhaltung
- Reaktive Instandhaltung
- Smart Service
- CMS - Zustandsüberwachung
- CBM - Zustandsabhängige Instandhaltung
- Augmented Reality
- Fernwartung
- Software im Bereich Service
- Service-Apps und Portale
- Dokumentation von Serviceeinsätzen
- Nutzwertanalyse
- Bewertungskriterien und deren Gewichtung
- Auswertung
- Klassischer Service
- Fazit und Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte (Objectives and Key Themes)
Diese Bachelorarbeit analysiert die Chancen von Industrie 4.0 für den technischen Kundendienst im Maschinen- und Anlagenbau. Das Ziel ist es, die Entwicklung der Industrie 4.0 aufzuzeigen, die wichtigsten technischen Voraussetzungen zu erläutern und den Einfluss dieser neuen Technologien auf den Bereich Service / TKD zu beleuchten. Die Arbeit untersucht, wie Smart Service und innovative Softwarelösungen den klassischen Kundendienst revolutionieren können und welche Vorteile sich für Maschinen- und Anlagenbauer ergeben.
- Entwicklung der industriellen Revolutionen
- Industrie 4.0 und ihre technischen Voraussetzungen (IoT, CPS, Smart Factory, Big Data)
- Chancen von Industrie 4.0 für den technischen Kundendienst
- Smart Service und seine Anwendungsmöglichkeiten (Zustandsüberwachung, CBM, Augmented Reality, Fernwartung)
- Nutzwertanalyse von Industrie 4.0 im Kontext des technischen Kundendienstes
Zusammenfassung der Kapitel (Chapter Summaries)
- Einleitung: Diese Einleitung gibt einen Überblick über die Themen der Arbeit und die Bedeutung der technologischen Entwicklung für die Industrie und den Kundendienst.
- Geschichte der Industrialisierung: Dieses Kapitel beschreibt die Entwicklung der industriellen Revolutionen und ihre Auswirkungen auf die Produktionsprozesse.
- Industrie 4.0: Dieses Kapitel definiert den Begriff Industrie 4.0, erläutert die Chancen für die deutsche Industrie und stellt die wichtigsten technischen Voraussetzungen vor, wie IoT, Cyber-physische Systeme, Smart Factory und Big Data.
- Chancen im Bereich Service durch Industrie 4.0: Dieses Kapitel fokussiert auf die Auswirkungen von Industrie 4.0 auf den technischen Kundendienst und beschreibt klassische Serviceleistungen im Vergleich zu Smart Service. Es werden verschiedene Möglichkeiten, wie Zustandsüberwachung, CBM, Augmented Reality und Fernwartung, vorgestellt und deren Potenzial für den technischen Kundendienst aufgezeigt.
- Software im Bereich Service: Dieses Kapitel beleuchtet die Rolle von Softwarelösungen im technischen Kundendienst. Es werden Service-Apps, Portale und die Dokumentation von Serviceeinsätzen betrachtet.
- Nutzwertanalyse: Dieses Kapitel untersucht den Mehrwert von Industrie 4.0 im technischen Kundendienst mithilfe einer Nutzwertanalyse. Es definiert Bewertungskriterien und führt eine Auswertung durch.
Schlüsselwörter (Keywords)
Industrie 4.0, technische Voraussetzungen, Internet der Dinge (IoT), Cyber-physische Systeme (CPS), Smart Factory, Big Data, klassischer Service, Smart Service, Zustandsüberwachung, Condition Based Maintenance (CBM), Augmented Reality, Fernwartung, Service-Apps, Portale, Nutzwertanalyse, technischer Kundendienst, Maschinen- und Anlagenbau.
Häufig gestellte Fragen
Was bedeutet Industrie 4.0 für den Service?
Es ermöglicht den Übergang vom klassischen, reaktiven Service hin zum "Smart Service", der auf Echtzeitdaten und Vernetzung basiert.
Was ist Predictive Maintenance (Vorausschauende Instandhaltung)?
Durch Zustandsüberwachung (CMS) werden Daten analysiert, um Wartungsbedarf vorherzusagen, bevor ein Ausfall auftritt.
Wie hilft Augmented Reality (AR) im Kundendienst?
Techniker können vor Ort durch AR-Brillen mit Informationen oder durch Fernwartung von Experten in Echtzeit unterstützt werden.
Was sind Cyber-physische Systeme (CPS)?
Es sind Systeme, bei denen mechanische Komponenten über Netzwerke (Internet) mit Softwareeinheiten verbunden sind und interagieren.
Welche Rolle spielt Big Data im Maschinenbau?
Die Analyse riesiger Datenmengen aus Maschinen ermöglicht es, Effizienz zu steigern, Fehlerquellen zu identifizieren und neue Geschäftsmodelle zu entwickeln.
Details
- Titel
- Industrie 4.0. Chancen für den Bereich Service & TKD im Maschinen- und Anlagenbau
- Hochschule
- Technische Akademie Wuppertal e.V.
- Note
- 2,0
- Autor
- Sven Siedhoff (Autor:in)
- Erscheinungsjahr
- 2016
- Seiten
- 37
- Katalognummer
- V355632
- ISBN (eBook)
- 9783668416086
- ISBN (Buch)
- 9783668416093
- Dateigröße
- 1166 KB
- Sprache
- Deutsch
- Schlagworte
- Industrie 4.0 Service technischer kundendienst Fernwartung CBM CMS IOT Industrielle Revolution Internet der Dinge Software TKD
- Produktsicherheit
- GRIN Publishing GmbH
- Preis (Ebook)
- US$ 16,99
- Preis (Book)
- US$ 18,99
- Arbeit zitieren
- Sven Siedhoff (Autor:in), 2016, Industrie 4.0. Chancen für den Bereich Service & TKD im Maschinen- und Anlagenbau, München, Page::Imprint:: GRINVerlagOHG, https://www.diplomarbeiten24.de/document/355632
- Autor werden
- Ihre Optionen
- Vertriebskanäle
- Premium Services
- Autorenprofil
- Textarten und Formate
- Services für Verlage, Hochschulen, Unternehmen

- © GRIN Publishing GmbH.
- Alle Inhalte urheberrechtlich geschützt. Kopieren und verbreiten untersagt.
- info@grin.com
- AGB
- Open Publishing
Der GRIN Verlag hat sich seit 1998 auf die Veröffentlichung akademischer eBooks und Bücher spezialisiert. Der GRIN Verlag steht damit als erstes Unternehmen für User Generated Quality Content. Die Verlagsseiten GRIN.com, Hausarbeiten.de und Diplomarbeiten24 bieten für Hochschullehrer, Absolventen und Studenten die ideale Plattform, wissenschaftliche Texte wie Hausarbeiten, Referate, Bachelorarbeiten, Masterarbeiten, Diplomarbeiten, Dissertationen und wissenschaftliche Aufsätze einem breiten Publikum zu präsentieren.
Kostenfreie Veröffentlichung: Hausarbeit, Bachelorarbeit, Diplomarbeit, Dissertation, Masterarbeit, Interpretation oder Referat jetzt veröffentlichen!
- GRIN Verlag GmbH
-
- Nymphenburger Str. 86
- 80636
- Munich, Deutschland
- +49 89-550559-0
- +49 89-550559-10
- info@grin.com
-