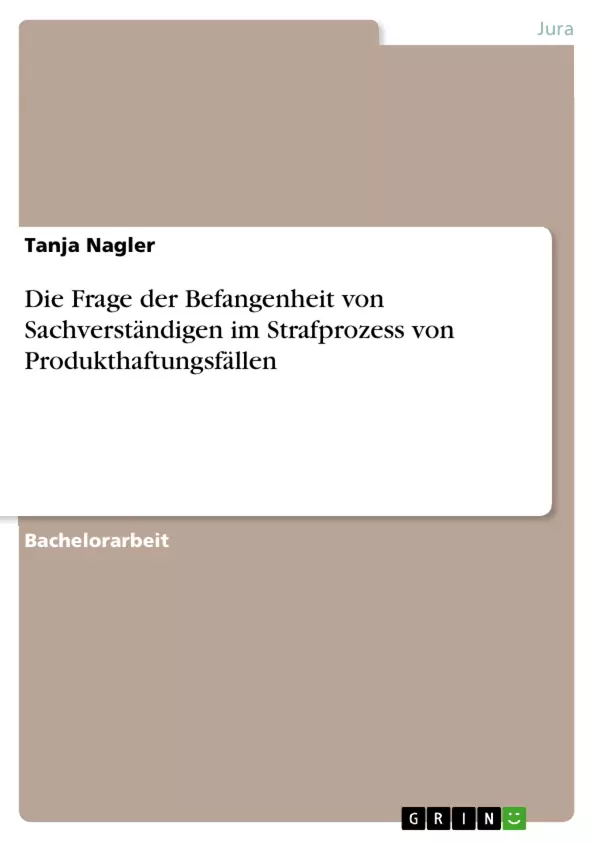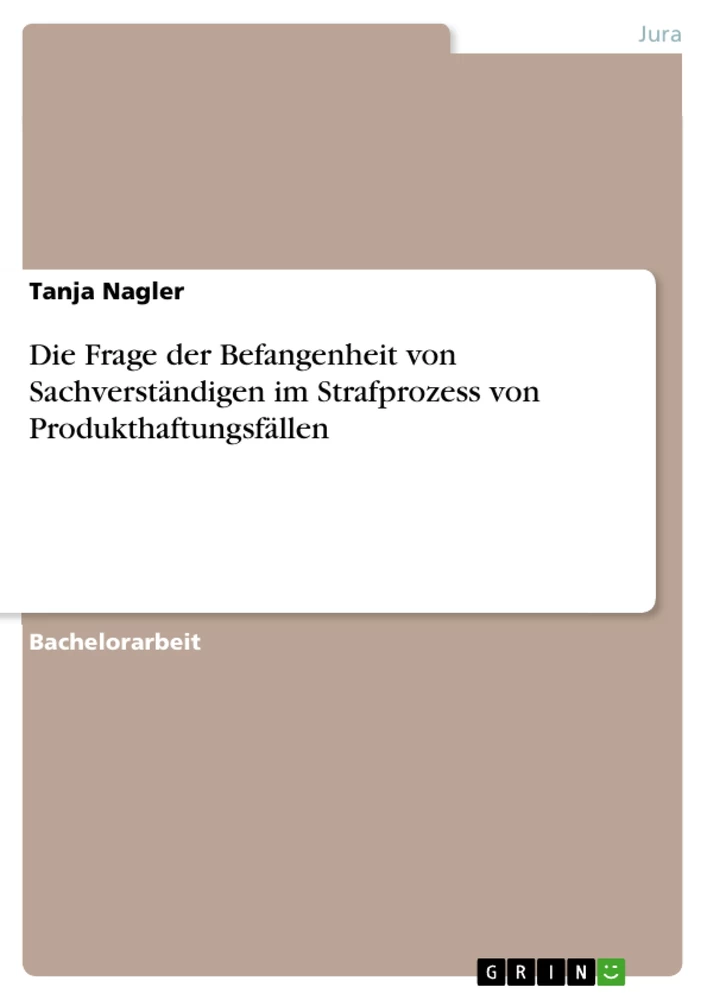
Die Frage der Befangenheit von Sachverständigen im Strafprozess von Produkthaftungsfällen
Bachelorarbeit, 2014
42 Seiten, Note: 2,8
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einleitung.
- 2 Definitionen...
- 2.1 Sachverständige...
- 2.1.1 Notwendige Qualifikationen und Pflichten........
- 2.1.2 Sachverständige als Beweismittel im Strafprozess.......
- 2.2 Befangenheit als Ablehnungsgrund.....
- 2.2.1 Besorgnis der Befangenheit von Sachverständigen im Strafprozess
- 2.2.2 Misstrauensgründe gegen die Unparteilichkeit......
- 2.3 Produkthaftung ..
- 2.3.1 Schutzbedürftigkeit des Verbrauchers ......
- 2.3.2 Verantwortlichkeit und Pflichten des Herstellers
- 2.3.3 Kausalität im strafrechtlichen Produkthaftungsprozess............
- 3 Strafprozesse bekannter Produkthaftungsfälle.
- 3.1 Das Contergan-Verfahren………………………...\n
- 3.1.1 Entstehungsgeschichte und Sachverhalt
- 3.1.2 Kausalitätszusammenhang und Sachverständigenbeweis............
- 3.2 Der Holzschutzmittel-Skandal
- 3.2.1 Sachverhalt und strafrechtliche Probleme
- 3.2.2 Beweisproblematik und Zwiespalt der Wissenschaft.
- 3.2.3 Einfluss der Wirtschaft und die Rolle der Sachverständigen ....
- 4 Allgemeine Kriterien für die Beurteilung der Befangenheit...........
- 4.1 Wirtschaftliche Beteiligungen und wissenschaftliche Kooperationen ...
- 4.2 Gesellschaftspolitisches Engagement von Sachverständigen
- 4.3 Regeln für die Unparteilichkeit von Sachverständigen im\nproduktrechtlichen Strafprozess..\n
- 5 Fazit..\n
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich mit der Frage der Befangenheit von Sachverständigen im Strafprozess von Produkthaftungsfällen. Sie untersucht die komplexen Zusammenhänge zwischen wissenschaftlicher Expertise, wirtschaftlichen Interessen und der Suche nach Gerechtigkeit im Strafrecht.
- Definition und Rolle von Sachverständigen im Strafprozess
- Die Bedeutung von Befangenheit als Ablehnungsgrund im Strafverfahren
- Die Herausforderungen der Produkthaftung im Strafrecht, insbesondere die Beweisführung von Kausalität
- Analyse von zwei prominenten Produkthaftungsfällen: Contergan und Holzschutzmittel
- Entwicklung von Kriterien für die Beurteilung der Befangenheit von Sachverständigen im Kontext von Produkthaftungsfällen
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in die Problematik der Befangenheit von Sachverständigen im Strafprozess von Produkthaftungsfällen ein. Sie beleuchtet die Herausforderungen, die sich aus der komplexen Beweisführung und der Abhängigkeit der Justiz von wissenschaftlicher Expertise ergeben.
Kapitel 2 definiert den Begriff des Sachverständigen und erläutert seine notwendigen Qualifikationen sowie seine Rolle als Beweismittel im Strafprozess. Darüber hinaus werden die Kriterien für Befangenheit im Strafprozess und die potenziellen Misstrauensgründe gegen die Unparteilichkeit von Sachverständigen behandelt.
Kapitel 3 analysiert zwei bedeutende Produkthaftungsfälle: das Contergan-Verfahren und den Holzschutzmittel-Skandal. Es werden die Sachverhalte, die rechtlichen Probleme sowie das Verhalten der beteiligten Sachverständigen beleuchtet, um die Bedeutung von Befangenheit und Unparteilichkeit im Strafprozess aufzuzeigen.
Kapitel 4 untersucht die Kriterien für die Beurteilung der Befangenheit von Sachverständigen im Strafprozess. Es werden wirtschaftliche Beteiligungen, wissenschaftliche Kooperationen und gesellschaftspolitisches Engagement als potenzielle Faktoren der Beeinflussung betrachtet.
Das Fazit fasst die gewonnenen Erkenntnisse zusammen und formuliert Empfehlungen für die Sicherstellung der Unparteilichkeit von Sachverständigen im produktrechtlichen Strafprozess.
Schlüsselwörter
Produkthaftung, Sachverständige, Befangenheit, Strafprozess, Kausalität, Contergan, Holzschutzmittel, Beweisführung, Unparteilichkeit, Wissenschaft, Wirtschaft, Recht, Verbraucher, Hersteller, Rechtssicherheit.
Details
- Titel
- Die Frage der Befangenheit von Sachverständigen im Strafprozess von Produkthaftungsfällen
- Hochschule
- Frankfurt University of Applied Sciences, ehem. Fachhochschule Frankfurt am Main
- Note
- 2,8
- Autor
- Tanja Nagler (Autor:in)
- Erscheinungsjahr
- 2014
- Seiten
- 42
- Katalognummer
- V357860
- ISBN (eBook)
- 9783668427440
- ISBN (Buch)
- 9783668427457
- Dateigröße
- 533 KB
- Sprache
- Deutsch
- Schlagworte
- Befangenheit Sachverständige Strafprozess Befangenheit Sachverständige Strafprozess Produkthaftung Sachverständige Strafprozess Sachverständige Produkthaftung
- Produktsicherheit
- GRIN Publishing GmbH
- Preis (Ebook)
- US$ 20,99
- Preis (Book)
- US$ 29,99
- Arbeit zitieren
- Tanja Nagler (Autor:in), 2014, Die Frage der Befangenheit von Sachverständigen im Strafprozess von Produkthaftungsfällen, München, Page::Imprint:: GRINVerlagOHG, https://www.diplomarbeiten24.de/document/357860
- Autor werden
- Ihre Optionen
- Vertriebskanäle
- Premium Services
- Autorenprofil
- Textarten und Formate
- Services für Verlage, Hochschulen, Unternehmen

- © GRIN Publishing GmbH.
- Alle Inhalte urheberrechtlich geschützt. Kopieren und verbreiten untersagt.
- info@grin.com
- AGB
- Open Publishing
Der GRIN Verlag hat sich seit 1998 auf die Veröffentlichung akademischer eBooks und Bücher spezialisiert. Der GRIN Verlag steht damit als erstes Unternehmen für User Generated Quality Content. Die Verlagsseiten GRIN.com, Hausarbeiten.de und Diplomarbeiten24 bieten für Hochschullehrer, Absolventen und Studenten die ideale Plattform, wissenschaftliche Texte wie Hausarbeiten, Referate, Bachelorarbeiten, Masterarbeiten, Diplomarbeiten, Dissertationen und wissenschaftliche Aufsätze einem breiten Publikum zu präsentieren.
Kostenfreie Veröffentlichung: Hausarbeit, Bachelorarbeit, Diplomarbeit, Dissertation, Masterarbeit, Interpretation oder Referat jetzt veröffentlichen!
- GRIN Verlag GmbH
-
- Nymphenburger Str. 86
- 80636
- Munich, Deutschland
- +49 89-550559-0
- +49 89-550559-10
- info@grin.com
-