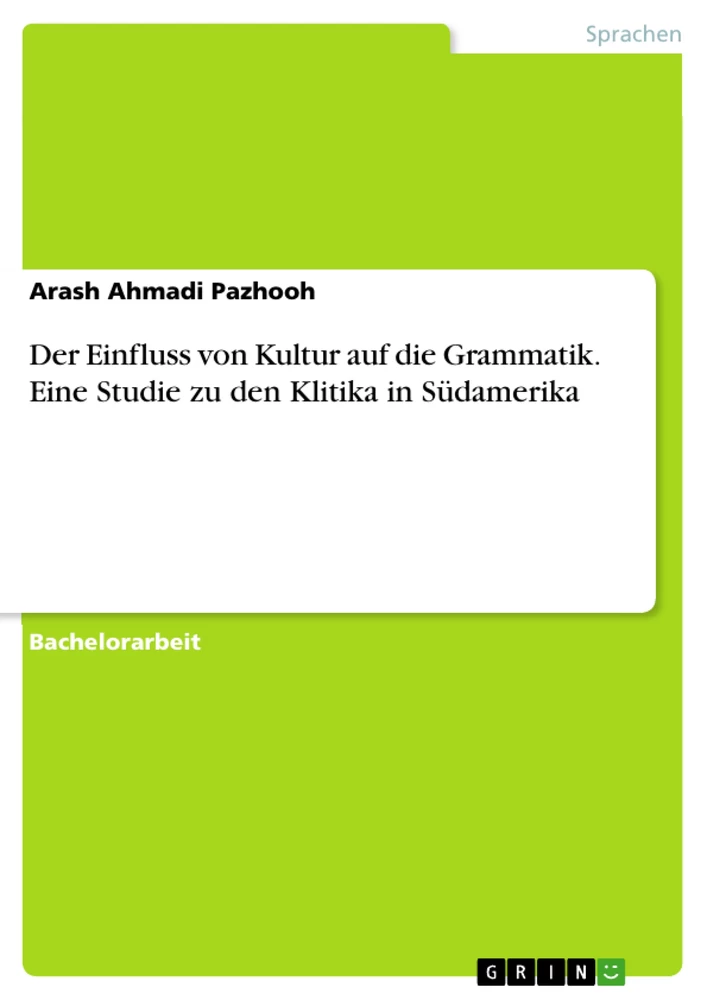
Der Einfluss von Kultur auf die Grammatik. Eine Studie zu den Klitika in Südamerika
Bachelorarbeit, 2017
31 Seiten, Note: 1.0
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Theoretischer Rahmen
- Sapir Whorf: Sprache - Denken - Wirklichkeit
- Humboldt: Das Entstehen der grammatischen Formen und ihr Einfluss auf die Ideenentwicklung
- Martínez - Hypothese
- Kommunikative Hypothese
- Rioplatense
- Guaraní-Spanisch
- Anden-Spanisch
- Anwendung auf das kastilische Spanisch
- Evaluation
- Fazit und Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende wissenschaftliche Arbeit befasst sich mit dem kulturellen Einfluss auf das Klitika-System im südamerikanischen Spanisch, insbesondere mit dem unterschiedlichen kontextbezogenen Gebrauch der Klitika le und lo/la. Die Studie analysiert, ob die Syntax einer Sprache durch die Kultur beeinflusst wird und ob diese Beeinflussung auf das Klitika-System im südamerikanischen Spanisch nachweisbar ist.
- Kultureller Einfluss auf die Grammatik
- Die Bedeutung von Klitika im Spanischen
- Untersuchung des Klitika-Systems im Rioplatense, Guaraní-Spanisch und Anden-Spanisch
- Vergleich mit dem kastilischen Spanisch
- Relevanz der Syntax für die Semantik und Pragmatik
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt die Fragestellung der Arbeit vor und erläutert die Bedeutung der Kultur für die Sprachforschung. Kapitel 2 referiert den theoretischen Rahmen, der die Arbeit untermauert. Es werden die Gedanken von Sapir Whorf, Humboldt und Martínez zu Sprache und Kultur vorgestellt. Kapitel 3 beschreibt die kommunikative Hypothese und untersucht die drei südamerikanischen Varietäten des Spanischen (Rioplatense, Guaraní-Spanisch, Anden-Spanisch) im Hinblick auf den kulturellen Einfluss auf die Grammatik. Kapitel 4 widmet sich der Anwendung der Forschungsergebnisse auf das kastilische Spanisch. Kapitel 5 bietet eine Evaluation der Ergebnisse und Kapitel 6 fasst die gewonnen Erkenntnisse zusammen und gibt einen Ausblick auf zukünftige Forschung.
Schlüsselwörter
Die Arbeit fokussiert auf die Themen Kultur, Grammatik, Klitika, Spanisch, Südamerika, Rioplatense, Guaraní-Spanisch, Anden-Spanisch, kastilisches Spanisch, Semantik, Pragmatik, Linguistik. Der Schwerpunkt liegt auf der Analyse des kulturellen Einflusses auf das Klitika-System im südamerikanischen Spanisch.
Details
- Titel
- Der Einfluss von Kultur auf die Grammatik. Eine Studie zu den Klitika in Südamerika
- Hochschule
- Universität Hamburg
- Note
- 1.0
- Autor
- Arash Ahmadi Pazhooh (Autor:in)
- Erscheinungsjahr
- 2017
- Seiten
- 31
- Katalognummer
- V359276
- ISBN (eBook)
- 9783668438163
- ISBN (Buch)
- 9783668438170
- Dateigröße
- 757 KB
- Sprache
- Deutsch
- Schlagworte
- einfluss kultur grammatik eine studie klitika südamerika
- Produktsicherheit
- GRIN Publishing GmbH
- Preis (Ebook)
- US$ 16,99
- Preis (Book)
- US$ 18,99
- Arbeit zitieren
- Arash Ahmadi Pazhooh (Autor:in), 2017, Der Einfluss von Kultur auf die Grammatik. Eine Studie zu den Klitika in Südamerika, München, Page::Imprint:: GRINVerlagOHG, https://www.diplomarbeiten24.de/document/359276
- Autor werden
- Ihre Optionen
- Vertriebskanäle
- Premium Services
- Autorenprofil
- Textarten und Formate
- Services für Verlage, Hochschulen, Unternehmen

- © GRIN Publishing GmbH.
- Alle Inhalte urheberrechtlich geschützt. Kopieren und verbreiten untersagt.
- info@grin.com
- AGB
- Open Publishing
Der GRIN Verlag hat sich seit 1998 auf die Veröffentlichung akademischer eBooks und Bücher spezialisiert. Der GRIN Verlag steht damit als erstes Unternehmen für User Generated Quality Content. Die Verlagsseiten GRIN.com, Hausarbeiten.de und Diplomarbeiten24 bieten für Hochschullehrer, Absolventen und Studenten die ideale Plattform, wissenschaftliche Texte wie Hausarbeiten, Referate, Bachelorarbeiten, Masterarbeiten, Diplomarbeiten, Dissertationen und wissenschaftliche Aufsätze einem breiten Publikum zu präsentieren.
Kostenfreie Veröffentlichung: Hausarbeit, Bachelorarbeit, Diplomarbeit, Dissertation, Masterarbeit, Interpretation oder Referat jetzt veröffentlichen!
- GRIN Verlag GmbH
-
- Nymphenburger Str. 86
- 80636
- Munich, Deutschland
- +49 89-550559-0
- +49 89-550559-10
- info@grin.com
-









