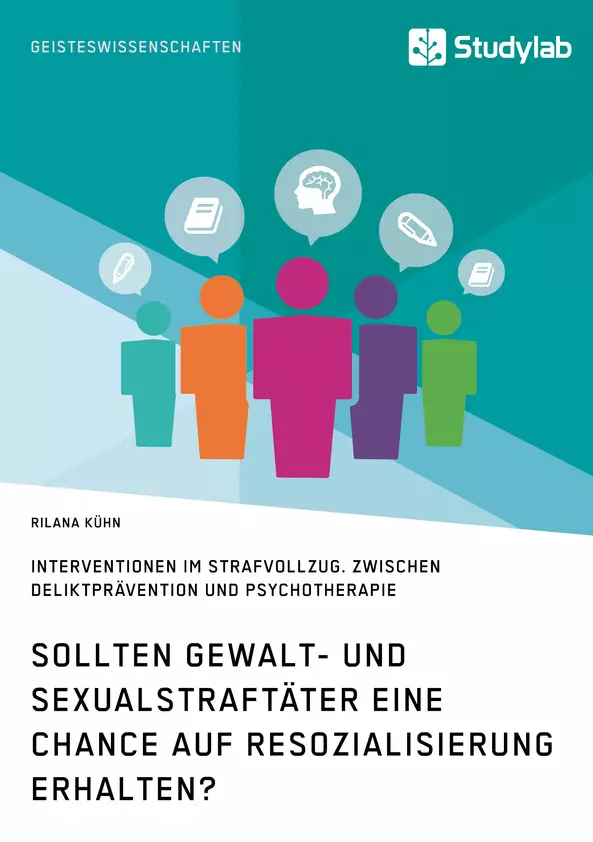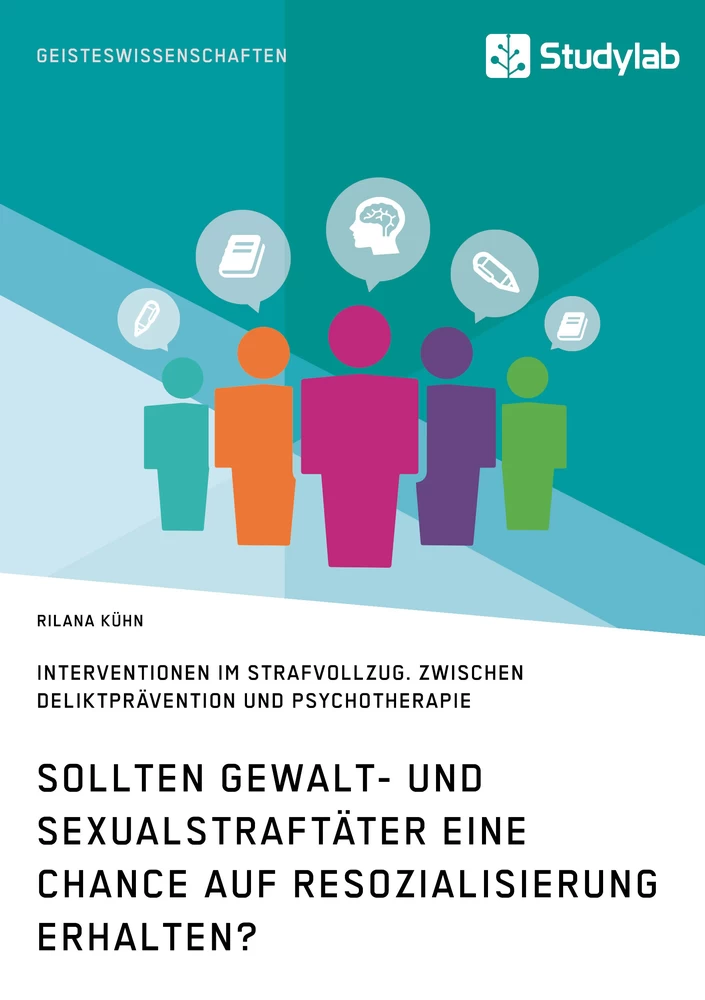
Sollten Gewalt- und Sexualstraftäter eine Chance auf Resozialisierung erhalten?
Bachelorarbeit, 2016
52 Seiten, Note: 1,7
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
- Danksagung
- Zusammenfassung
- Abstract
- Einleitung
- Theoretischer Hintergrund
- Einführung der relevanten Begriffe
- Das Gefängnis als Behandlungsort – Kritische Standpunkte
- Risikofaktoren und Tatmerkmale
- Risikofaktoren für Erstdelinquenz
- Täter-Opfer-Beziehung bei Gewalt- und Sexualdelikten
- Risikofaktoren für die Rückfälligkeit
- Wirksamkeit von Interventionen
- Befunde
- Kosten-Nutzen-Effizienz
- Zwischen Deliktprävention und Psychotherapie
- Die deliktpräventive Therapie
- Behandlung von persönlichkeitsgestörten Hochrisikostraftätern
- Die Grenzen der deliktorientierten Therapie
- Psychodynamische Interventionen
- Kognitiv-verhaltenstherapeutische Therapie
- Fallbeispiel eines Sexualstraftäters mit Hochrisikofantasien
- Forensische Nachsorge
- Diskussion
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit befasst sich mit der Frage, ob Gewalt- und Sexualstraftäter eine Chance auf Resozialisierung erhalten sollten und welche Interventionen im Strafvollzug dazu beitragen können. Im Fokus stehen die deliktpräventive Therapie und die psychotherapeutische Behandlung, sowie die Berücksichtigung von Risikofaktoren für Erstdelinquenz und Rückfälligkeit.
- Bewertung der Möglichkeiten und Grenzen der Resozialisierung von Gewalt- und Sexualstraftätern
- Analyse der Wirksamkeit von Interventionen im Strafvollzug
- Untersuchung der deliktpräventiven Therapie und ihrer Grenzen
- Exploration verschiedener psychotherapeutischer Ansätze im Umgang mit Hochrisikostraftätern
- Diskussion der Bedeutung der forensischen Nachsorge für die erfolgreiche Resozialisierung
Zusammenfassung der Kapitel
- Die Einleitung führt in das Thema ein und stellt die Forschungsfrage nach der Resozialisierung von Gewalt- und Sexualstraftätern. Sie beleuchtet die Relevanz des Themas und die verschiedenen Perspektiven auf die Problematik.
- Der theoretische Hintergrund liefert eine Definition der relevanten Begriffe und analysiert das Gefängnis als Behandlungsort. Er geht auf die kritischen Standpunkte ein und untersucht die Risikofaktoren für Erstdelinquenz und Rückfälligkeit, sowie die Täter-Opfer-Beziehung bei Gewalt- und Sexualdelikten.
- Die Kapitel über die Wirksamkeit von Interventionen analysieren die Befunde und die Kosten-Nutzen-Effizienz verschiedener Behandlungsformen. Sie untersuchen, inwiefern Interventionen im Strafvollzug einen positiven Einfluss auf die Resozialisierung von Straftätern haben.
- Der Abschnitt über die deliktpräventive Therapie und die Behandlung von persönlichkeitsgestörten Hochrisikostraftätern beleuchtet die Grenzen der deliktorientierten Therapie und stellt verschiedene psychotherapeutische Ansätze vor.
- Das Fallbeispiel eines Sexualstraftäters mit Hochrisikofantasien illustriert die Komplexität des Themas und zeigt die Herausforderungen bei der Behandlung von Straftätern mit besonderen Bedürfnissen.
Schlüsselwörter
Resozialisierung, Gewaltstraftäter, Sexualstraftäter, Strafvollzug, Interventionen, Deliktprävention, Psychotherapie, Risikofaktoren, Rückfälligkeit, Täter-Opfer-Beziehung, Kosten-Nutzen-Effizienz, Forensische Nachsorge.
Häufig gestellte Fragen
Sollten Sexualstraftäter eine Chance auf Resozialisierung erhalten?
Die Autorin argumentiert, dass aus ethischer und finanzieller Sicht eine Resozialisierung sinnvoll ist, da Therapie kosteneffizienter ist als reiner Strafvollzug.
Was sind die Risikofaktoren für Rückfälligkeit?
Das Buch untersucht verschiedene Risikofaktoren, darunter Persönlichkeitsstörungen, Tatmerkmale und die Wirksamkeit bisheriger therapeutischer Interventionen.
Ist lebenslange Haft ohne Therapie eine Lösung?
Laut der Untersuchung erzielen rein strafende Methoden nicht den gewünschten Effekt der Rückfallprävention und sind langfristig teurer als gezielte Psychotherapie.
Was ist deliktpräventive Therapie?
Dies ist eine Form der Behandlung im Strafvollzug, die gezielt darauf ausgerichtet ist, das Risiko künftiger Straftaten durch Aufarbeitung der Tatmotive zu senken.
Welche Rolle spielt die forensische Nachsorge?
Die forensische Nachsorge ist entscheidend für die erfolgreiche Wiedereingliederung und die Überwachung des Rückfallrisikos nach der Entlassung aus dem Strafvollzug.
Details
- Titel
- Sollten Gewalt- und Sexualstraftäter eine Chance auf Resozialisierung erhalten?
- Untertitel
- Interventionen im Strafvollzug. Zwischen Deliktprävention und Psychotherapie
- Hochschule
- International Psychoanalytic University
- Note
- 1,7
- Autor
- Rilana Kühn (Autor:in)
- Erscheinungsjahr
- 2016
- Seiten
- 52
- Katalognummer
- V364540
- ISBN (eBook)
- 9783668451544
- ISBN (Buch)
- 9783960950752
- Dateigröße
- 532 KB
- Sprache
- Deutsch
- Schlagworte
- Delikttherapie Psychotherapie Strafvollzug Interventionen Prävention Gefängnis Sexualstraftäter Gewaltstraftäter Forensik Rehabilitation Resozialisierung Kosten-Nutzen-Analyse Psychoanalyse Verhaltenstherapie Gewaltpotential Population Rückfallrisiko FOTRES Metaanalyse
- Produktsicherheit
- GRIN Publishing GmbH
- Preis (Ebook)
- US$ 20,99
- Preis (Book)
- US$ 29,99
- Arbeit zitieren
- Rilana Kühn (Autor:in), 2016, Sollten Gewalt- und Sexualstraftäter eine Chance auf Resozialisierung erhalten?, München, Page::Imprint:: GRINVerlagOHG, https://www.diplomarbeiten24.de/document/364540
- Autor werden
- Ihre Optionen
- Vertriebskanäle
- Premium Services
- Autorenprofil
- Textarten und Formate
- Services für Verlage, Hochschulen, Unternehmen

- © GRIN Publishing GmbH.
- Alle Inhalte urheberrechtlich geschützt. Kopieren und verbreiten untersagt.
- info@grin.com
- AGB
- Open Publishing
Der GRIN Verlag hat sich seit 1998 auf die Veröffentlichung akademischer eBooks und Bücher spezialisiert. Der GRIN Verlag steht damit als erstes Unternehmen für User Generated Quality Content. Die Verlagsseiten GRIN.com, Hausarbeiten.de und Diplomarbeiten24 bieten für Hochschullehrer, Absolventen und Studenten die ideale Plattform, wissenschaftliche Texte wie Hausarbeiten, Referate, Bachelorarbeiten, Masterarbeiten, Diplomarbeiten, Dissertationen und wissenschaftliche Aufsätze einem breiten Publikum zu präsentieren.
Kostenfreie Veröffentlichung: Hausarbeit, Bachelorarbeit, Diplomarbeit, Dissertation, Masterarbeit, Interpretation oder Referat jetzt veröffentlichen!
- GRIN Verlag GmbH
-
- Nymphenburger Str. 86
- 80636
- Munich, Deutschland
- +49 89-550559-0
- +49 89-550559-10
- info@grin.com
-