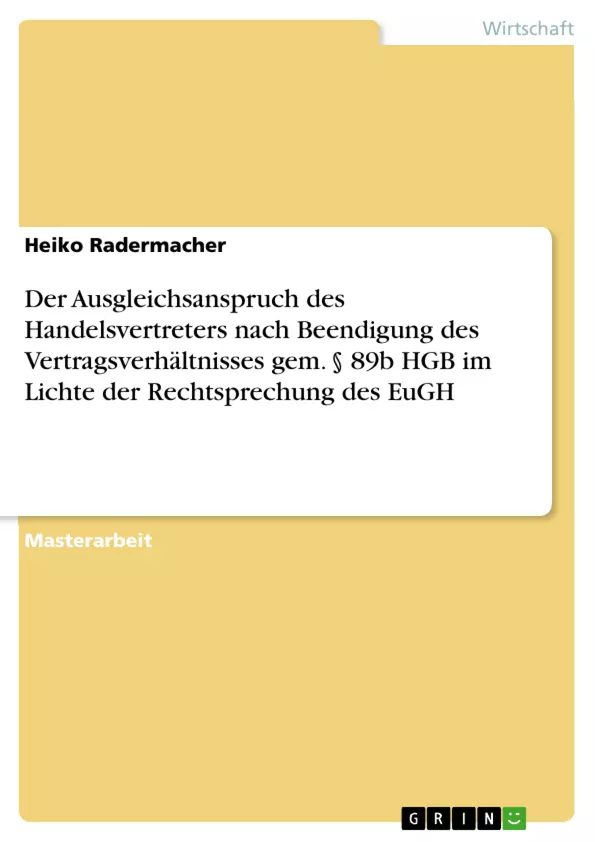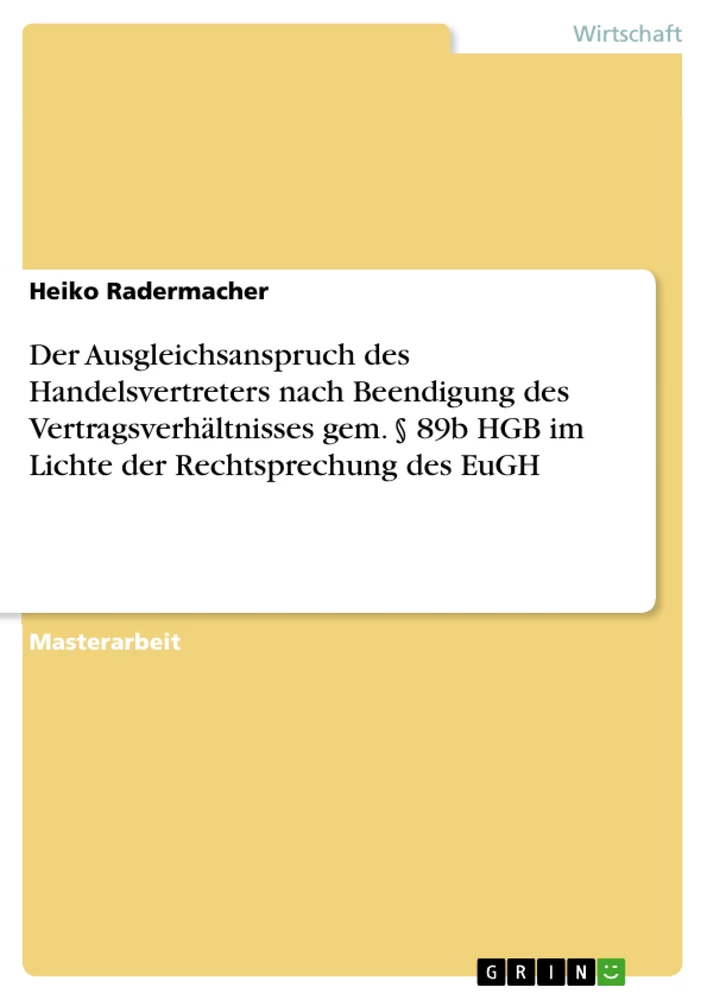
Der Ausgleichsanspruch des Handelsvertreters nach Beendigung des Vertragsverhältnisses gem. § 89b HGB im Lichte der Rechtsprechung des EuGH
Masterarbeit, 2015
107 Seiten, Note: 0,7
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Sinn und Zweck sowie Einordnung des Ausgleichsanspruchs
- Die Rolle des HGB
- Sinn und Zweck des Ausgleichsanspruchs
- Dogmatische Einordnung
- Der Handelsvertreter
- Kaufmannseigenschaft
- Selbständigkeit
- Ständige Betrauung
- Vermittlung oder Abschluss für einen Unternehmer
- Bezirks- und Alleinvertreter
- Versicherungs- und Bausparkassenvertreter
- Vertragshändler
- Franchisenehmer
- Unternehmer im Sinne des § 89b HGB
- Formelle Anspruchsvoraussetzungen
- Vertragsbeendigung
- Wirksamer Handelsvertretervertrag
- Vertragsbeendigung durch Kündigung, Aufhebungsvertrag, Ablauf, Tod oder Insolvenz
- Vertragsbeendigung durch Kündigung
- Vertragsbeendigung durch Aufhebungsvertrag
- Vertragsbeendigung durch Ablauf oder auflösende Bedingung
- Vertragsbeendigung durch Tod
- Vertragsbeendigung durch Insolvenz
- Betriebseinstellung oder -veräußerung
- Geltendmachung des Ausgleichsanspruchs
- Vertragsbeendigung
- Materielle Anspruchsvoraussetzungen
- Neukundenwerbung bzw. wesentliche Erweiterung der Geschäftsbeziehung
- Neukunden
- Werbung durch den Handelsvertreter
- Wesentliche Erweiterung der Geschäftsbeziehung
- Stammkunden bei Vertragshändlern
- Unternehmervorteile
- Billigkeit (bis 05.08.2009)
- Berechnungsmethoden für Eigenhändler
- Vertragswidrige Konkurrenztätigkeit vor Vertragsende
- Konkurrenztätigkeit nach Vertragsende oder Verstoß gegen ein nachvertragliches Wettbewerbsverbot
- Vertragsdauer
- Kosteneinsparungen
- Zahlung eines Fixums
- Sogwirkung
- Provisionspflicht gegenüber Nachfolger
- Ablehnung eines Folgevertrags
- Anlass zur außerordentlichen Kündigung
- Altersversorgung des Handelsvertreters
- Insolvenz des Handelsvertreters
- Mangelnder Vermittlungserfolg
- Vertragsaufhebung
- Vertragswidriges Verhalten des Unternehmers
- Wirtschaftliche und soziale Lage der Parteien
- Neukundenwerbung bzw. wesentliche Erweiterung der Geschäftsbeziehung
- Die neue Rechtslage seit dem 05.08.2009
- Rechtssache Turgay Semen gegen Deutsche Tamoil GmbH vor dem EuGH (C-348/07)
- Die Änderung des HGB und erste Reaktionen
- Möglichkeiten zur Berechnung der Unternehmensvorteile
- Exkurs: Verfahren zur Unternehmensbewertung
- Tatsächliche Ermittlung des Unternehmervorteils
- Billigkeit
- Angemessenheit
- Höchstgrenze
- Ausschluss des Ausgleichsanspruchs
- Kündigung des Handelsvertreters
- Alters- oder Krankheitsgründe
- Begründeter Anlass
- Ausgleichsverhindernde Eigenkündigung
- Kündigung des Unternehmers
- Widerspruch zwischen der EU-Richtlinie und dem HGB
- Rechtssache Volvo Car Germany GmbH gegen Autohof Weidensdorf GmbH vor dem EuGH (C-203/09)
- Die richtlinienkonforme Auslegung des BGH
- Folgen der Urteile des EuGH und BGH
- Der Sonderfall der Insolvenz
- Übernahme durch einen Dritten
- Kündigung des Handelsvertreters
- Unabdingbarkeit des Anspruchs
- Aufbau und Anrechnung einer Altersvorsorge
- Einmalprovisionen
- Vorauserfüllung
- Einstandszahlungen
- Abwälzungsvereinbarungen
- Fazit und Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Masterarbeit untersucht den Ausgleichsanspruch des Handelsvertreters nach Beendigung des Vertragsverhältnisses gemäß § 89b HGB, insbesondere im Lichte der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs (EuGH). Ziel ist es, die Rechtslage umfassend darzustellen und die Auswirkungen der EuGH-Rechtsprechung auf die Praxis zu analysieren.
- Der Ausgleichsanspruch nach § 89b HGB
- Die Rolle des EuGH in der Auslegung des § 89b HGB
- Materielle und formelle Anspruchsvoraussetzungen
- Berechnung des Ausgleichsanspruchs
- Ausschlussgründe des Ausgleichsanspruchs
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Diese Einleitung führt in die Thematik des Ausgleichsanspruchs des Handelsvertreters nach § 89b HGB ein und skizziert den Aufbau der Arbeit. Sie benennt die zentrale Forschungsfrage und die methodische Vorgehensweise.
Sinn und Zweck sowie Einordnung des Ausgleichsanspruchs: Dieses Kapitel erläutert den Sinn und Zweck des Ausgleichsanspruchs und ordnet ihn dogmatisch ein. Es untersucht die Rolle des HGB und analysiert die Funktion des Anspruchs im Kontext des Handelsvertreterrechts.
Der Handelsvertreter: Dieses Kapitel definiert den Handelsvertreter und seine Merkmale, wie z.B. die Kaufmannseigenschaft, Selbstständigkeit und die ständige Betrauung. Es differenziert zwischen verschiedenen Arten von Handelsvertretern und beleuchtet deren spezifische Merkmale im Hinblick auf den Ausgleichsanspruch.
Unternehmer im Sinne des § 89b HGB: Hier wird der Begriff des Unternehmers im Sinne des § 89b HGB präzisiert. Die Kriterien für die Unternehmerqualität werden detailliert untersucht und anhand von Beispielen illustriert. Die Abgrenzung zu anderen Rechtsfiguren wird vorgenommen.
Formelle Anspruchsvoraussetzungen: Dieses Kapitel behandelt die formalen Voraussetzungen für den Ausgleichsanspruch. Es analysiert die verschiedenen Arten der Vertragsbeendigung (Kündigung, Aufhebungsvertrag, etc.) und deren Auswirkungen auf den Anspruch. Die Geltendmachung des Anspruchs wird ebenfalls erörtert.
Materielle Anspruchsvoraussetzungen: Das Kapitel befasst sich ausführlich mit den materiellen Voraussetzungen des Ausgleichsanspruchs, insbesondere der Neukundenwerbung, der wesentlichen Erweiterung der Geschäftsbeziehung und den Vorteilen des Unternehmers. Die verschiedenen Berechnungsmethoden und die Rolle der Billigkeit werden detailliert analysiert, sowohl vor als auch nach der Rechtsprechung des EuGH.
Die neue Rechtslage seit dem 05.08.2009: Dieses Kapitel analysiert die Auswirkungen der EuGH-Rechtsprechung, insbesondere der Urteile in den Rechtssachen Turgay Semen und Volvo Car Germany, auf den Ausgleichsanspruch. Es untersucht die Anpassungen im HGB und die damit verbundenen Herausforderungen in der Praxis. Verschiedene Berechnungsmethoden und die Frage der Angemessenheit werden diskutiert.
Höchstgrenze: Dieses Kapitel untersucht die gesetzliche Höchstgrenze des Ausgleichsanspruchs und deren praktische Relevanz. Es analysiert, wie die Höchstgrenze im Einzelfall zu bestimmen ist und welche Faktoren dabei eine Rolle spielen.
Ausschluss des Ausgleichsanspruchs: Dieses Kapitel analysiert die verschiedenen Gründe für den Ausschluss des Ausgleichsanspruchs, sowohl bei Kündigung durch den Handelsvertreter als auch durch den Unternehmer. Die Rechtsprechung des EuGH und des BGH wird eingehend betrachtet, insbesondere der Konflikt zwischen EU-Richtlinie und nationalem Recht.
Unabdingbarkeit des Anspruchs: Hier wird die Unabdingbarkeit des Ausgleichsanspruchs erörtert. Es werden Möglichkeiten der Vertragsgestaltung beleuchtet, welche den Anspruch einschränken oder ausschließen sollen, und deren Zulässigkeit geprüft. Aspekte wie Altersvorsorge, Einmalprovisionen und Abwälzungsvereinbarungen werden analysiert.
Schlüsselwörter
Ausgleichsanspruch, Handelsvertreter, § 89b HGB, EuGH-Rechtsprechung, materielle Anspruchsvoraussetzungen, formelle Anspruchsvoraussetzungen, Unternehmervorteile, Billigkeit, Höchstgrenze, Vertragsbeendigung, Kündigung, Neukundenwerbung.
Häufig gestellte Fragen zum Ausgleichsanspruch des Handelsvertreters nach § 89b HGB
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Masterarbeit befasst sich umfassend mit dem Ausgleichsanspruch des Handelsvertreters nach Beendigung des Vertragsverhältnisses gemäß § 89b HGB. Besonderes Augenmerk liegt auf der Auslegung dieses Anspruchs durch den Europäischen Gerichtshof (EuGH) und den Auswirkungen der EuGH-Rechtsprechung auf die Praxis.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt sämtliche relevanten Aspekte des Ausgleichsanspruchs, beginnend mit seiner Definition und Einordnung im Handelsrecht (§ 89b HGB) bis hin zu konkreten Berechnungsmethoden und Ausschlussgründen. Dabei werden sowohl die formalen als auch die materiellen Anspruchsvoraussetzungen detailliert untersucht. Die Rolle des EuGH und die Auswirkungen der Rechtsprechung auf die Praxis werden besonders hervorgehoben.
Wer ist ein Handelsvertreter im Sinne des § 89b HGB?
Die Arbeit definiert den Handelsvertreter und seine Merkmale, wie Kaufmannseigenschaft, Selbstständigkeit, ständige Betrauung und die Vermittlung/Abschluss von Geschäften für einen Unternehmer. Es werden verschiedene Arten von Handelsvertretern (z.B. Bezirks- und Alleinvertreter, Versicherungsvertreter) unterschieden und deren spezifische Merkmale im Hinblick auf den Ausgleichsanspruch beleuchtet.
Welche Voraussetzungen muss ein Handelsvertreter erfüllen, um einen Ausgleichsanspruch geltend zu machen?
Die Arbeit unterscheidet zwischen formalen und materiellen Anspruchsvoraussetzungen. Zu den formalen Voraussetzungen gehört eine wirksame Vertragsbeendigung (Kündigung, Aufhebungsvertrag etc.) und die Geltendmachung des Anspruchs. Materielle Voraussetzungen sind unter anderem die Neukundenwerbung oder eine wesentliche Erweiterung der Geschäftsbeziehung durch den Handelsvertreter, sowie der Nachweis von Vorteilen für den Unternehmer.
Wie wird der Ausgleichsanspruch berechnet?
Die Arbeit erläutert verschiedene Berechnungsmethoden für den Ausgleichsanspruch, wobei die Berücksichtigung der Unternehmervorteile im Vordergrund steht. Sie analysiert die Entwicklung der Berechnungsmethoden im Kontext der EuGH-Rechtsprechung, insbesondere nach dem 05.08.2009. Die Rolle der Billigkeit (vor 05.08.2009) und der Angemessenheit (nach 05.08.2009) werden detailliert untersucht.
Gibt es eine Höchstgrenze für den Ausgleichsanspruch?
Ja, die Arbeit untersucht die gesetzliche Höchstgrenze des Ausgleichsanspruchs und deren praktische Relevanz. Es wird erläutert, wie diese Höchstgrenze im Einzelfall zu bestimmen ist.
Wann wird der Ausgleichsanspruch ausgeschlossen?
Die Arbeit analysiert verschiedene Gründe für den Ausschluss des Ausgleichsanspruchs, sowohl bei Kündigung durch den Handelsvertreter als auch durch den Unternehmer. Die Rechtsprechung des EuGH und des BGH, insbesondere zu den Konflikten zwischen EU-Richtlinie und nationalem Recht, wird eingehend betrachtet. Beispiele hierfür sind Kündigungen aus Alters- oder Krankheitsgründen, begründete Anlässe oder die Eigenkündigung des Handelsvertreters.
Ist der Ausgleichsanspruch unabdingbar?
Die Arbeit untersucht die Unabdingbarkeit des Ausgleichsanspruchs und beleuchtet Möglichkeiten der Vertragsgestaltung, die den Anspruch einschränken oder ausschließen sollen, sowie deren Zulässigkeit. Aspekte wie Altersvorsorge, Einmalprovisionen und Abwälzungsvereinbarungen werden analysiert.
Welche Rolle spielt die Rechtsprechung des EuGH?
Die Arbeit analysiert die entscheidende Rolle des EuGH in der Auslegung des § 89b HGB. Sie untersucht insbesondere die Urteile in den Rechtssachen Turgay Semen gegen Deutsche Tamoil GmbH (C-348/07) und Volvo Car Germany GmbH gegen Autohof Weidensdorf GmbH (C-203/09) und deren Auswirkungen auf die Berechnung und den Ausschluss des Ausgleichsanspruchs.
Welche Schlüsselwörter sind relevant?
Schlüsselwörter sind: Ausgleichsanspruch, Handelsvertreter, § 89b HGB, EuGH-Rechtsprechung, materielle Anspruchsvoraussetzungen, formelle Anspruchsvoraussetzungen, Unternehmervorteile, Billigkeit, Höchstgrenze, Vertragsbeendigung, Kündigung, Neukundenwerbung.
Details
- Titel
- Der Ausgleichsanspruch des Handelsvertreters nach Beendigung des Vertragsverhältnisses gem. § 89b HGB im Lichte der Rechtsprechung des EuGH
- Hochschule
- Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule Aachen
- Note
- 0,7
- Autor
- Heiko Radermacher (Autor:in)
- Erscheinungsjahr
- 2015
- Seiten
- 107
- Katalognummer
- V364649
- ISBN (eBook)
- 9783668445918
- ISBN (Buch)
- 9783668445925
- Dateigröße
- 2841 KB
- Sprache
- Deutsch
- Anmerkungen
- Die Abschlussarbeit wurde mit der Note 0,7 (herausragend) bewertet.
- Schlagworte
- Handelsvertreterrecht Handelsvertreter Handelsrecht Ausgleichsanspruch Provision Franchise Vertragshändler Unternehmer
- Produktsicherheit
- GRIN Publishing GmbH
- Preis (Ebook)
- US$ 38,99
- Preis (Book)
- US$ 49,99
- Arbeit zitieren
- Heiko Radermacher (Autor:in), 2015, Der Ausgleichsanspruch des Handelsvertreters nach Beendigung des Vertragsverhältnisses gem. § 89b HGB im Lichte der Rechtsprechung des EuGH, München, Page::Imprint:: GRINVerlagOHG, https://www.diplomarbeiten24.de/document/364649
- Autor werden
- Ihre Optionen
- Vertriebskanäle
- Premium Services
- Autorenprofil
- Textarten und Formate
- Services für Verlage, Hochschulen, Unternehmen

- © GRIN Publishing GmbH.
- Alle Inhalte urheberrechtlich geschützt. Kopieren und verbreiten untersagt.
- info@grin.com
- AGB
- Open Publishing
Der GRIN Verlag hat sich seit 1998 auf die Veröffentlichung akademischer eBooks und Bücher spezialisiert. Der GRIN Verlag steht damit als erstes Unternehmen für User Generated Quality Content. Die Verlagsseiten GRIN.com, Hausarbeiten.de und Diplomarbeiten24 bieten für Hochschullehrer, Absolventen und Studenten die ideale Plattform, wissenschaftliche Texte wie Hausarbeiten, Referate, Bachelorarbeiten, Masterarbeiten, Diplomarbeiten, Dissertationen und wissenschaftliche Aufsätze einem breiten Publikum zu präsentieren.
Kostenfreie Veröffentlichung: Hausarbeit, Bachelorarbeit, Diplomarbeit, Dissertation, Masterarbeit, Interpretation oder Referat jetzt veröffentlichen!
- GRIN Verlag GmbH
-
- Nymphenburger Str. 86
- 80636
- Munich, Deutschland
- +49 89-550559-0
- +49 89-550559-10
- info@grin.com
-