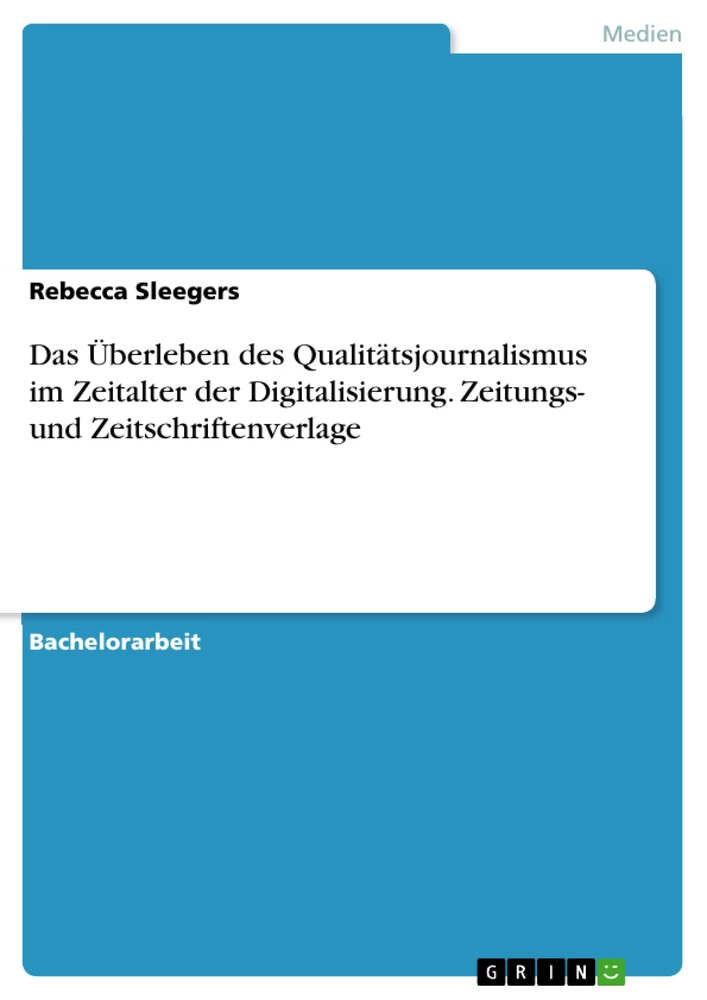
Das Überleben des Qualitätsjournalismus im Zeitalter der Digitalisierung. Zeitungs- und Zeitschriftenverlage
Bachelorarbeit, 2017
56 Seiten
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Problemstellung
- Zielsetzung, Relevanz und Aufbau der Arbeit
- Printmedienjournalismus
- Historischer Überblick 1995 bis 2015
- Medien als vierte Gewalt
- Digitaler Journalismus
- Technische Grundlagen und historische Entwicklungsphasen
- Besonderheiten des digitalen Journalismus
- Messgrößen im digitalen Journalismus
- Langjährige Fixierung der Verlage auf Werbeumsätze
- Nachhaltige Enttäuschung über Werbeumsätze
- Einstellungen und Verhaltensweisen des Publikums
- Handlungsmöglichkeiten der Verlage
- Print weiter pflegen und innovative Titel einführen
- Alle Erlösquellen für digitalen Journalismus erschließen
- Zusätzliche Nachfrage durch Internationalisierung erschließen
- In Journalismus-ferne Geschäftsfelder investieren
- Fazit und Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Bachelorarbeit untersucht die Herausforderungen des Qualitätsjournalismus im Zeitalter der Digitalisierung. Sie analysiert die Chancen und Risiken, die sich für Zeitungs- und Zeitschriftenverlage im digitalen Wandel ergeben. Die Arbeit beleuchtet die historischen Entwicklungen des Print- und digitalen Journalismus und untersucht die aktuellen Herausforderungen, denen sich Verlage gegenübersehen.
- Entwicklung des Print- und digitalen Journalismus
- Herausforderungen für Zeitungs- und Zeitschriftenverlage
- Möglichkeiten zur Sicherung des Qualitätsjournalismus in der digitalen Welt
- Verhaltensweisen des Publikums im digitalen Kontext
- Erlösquellen für digitalen Journalismus
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Die Einleitung stellt die Problemstellung der Arbeit dar und erläutert die Zielsetzung, Relevanz und den Aufbau der Arbeit.
- Printmedienjournalismus: Dieses Kapitel beleuchtet die Entwicklung des Printmedienjournalismus von 1995 bis 2015 und die Bedeutung der Medien als vierte Gewalt.
- Digitaler Journalismus: Dieses Kapitel befasst sich mit den technischen Grundlagen und der historischen Entwicklung des digitalen Journalismus. Es analysiert die Besonderheiten des digitalen Journalismus, die Messgrößen und die langjährige Fixierung der Verlage auf Werbeumsätze. Darüber hinaus werden die Einstellungen und Verhaltensweisen des Publikums im digitalen Kontext untersucht.
- Handlungsmöglichkeiten der Verlage: Dieses Kapitel beleuchtet die Handlungsmöglichkeiten der Verlage, um den Herausforderungen des digitalen Wandels zu begegnen. Es werden verschiedene Strategien wie die Weiterentwicklung des Printbereichs, die Erschließung neuer Erlösquellen und die Internationalisierung betrachtet.
Schlüsselwörter
Qualitätsjournalismus, Digitalisierung, Printmedien, Zeitungs- und Zeitschriftenverlage, Werbeumsätze, Publikumsverhalten, Handlungsmöglichkeiten, Internationalisierung.
Details
- Titel
- Das Überleben des Qualitätsjournalismus im Zeitalter der Digitalisierung. Zeitungs- und Zeitschriftenverlage
- Hochschule
- Hochschule für Technik und Wirtschaft Berlin
- Autor
- Rebecca Sleegers (Autor:in)
- Erscheinungsjahr
- 2017
- Seiten
- 56
- Katalognummer
- V367445
- ISBN (eBook)
- 9783668467705
- ISBN (Buch)
- 9783668467712
- Dateigröße
- 639 KB
- Sprache
- Deutsch
- Schlagworte
- Digitalisierung Journalismus Bigdata Print Verlage Zeitungen Zeitschriften Qualitätsjournalismus
- Produktsicherheit
- GRIN Publishing GmbH
- Preis (Ebook)
- US$ 19,99
- Preis (Book)
- US$ 29,99
- Arbeit zitieren
- Rebecca Sleegers (Autor:in), 2017, Das Überleben des Qualitätsjournalismus im Zeitalter der Digitalisierung. Zeitungs- und Zeitschriftenverlage, München, Page::Imprint:: GRINVerlagOHG, https://www.diplomarbeiten24.de/document/367445
- Autor werden
- Ihre Optionen
- Vertriebskanäle
- Premium Services
- Autorenprofil
- Textarten und Formate
- Services für Verlage, Hochschulen, Unternehmen

- © GRIN Publishing GmbH.
- Alle Inhalte urheberrechtlich geschützt. Kopieren und verbreiten untersagt.
- info@grin.com
- AGB
- Open Publishing
Der GRIN Verlag hat sich seit 1998 auf die Veröffentlichung akademischer eBooks und Bücher spezialisiert. Der GRIN Verlag steht damit als erstes Unternehmen für User Generated Quality Content. Die Verlagsseiten GRIN.com, Hausarbeiten.de und Diplomarbeiten24 bieten für Hochschullehrer, Absolventen und Studenten die ideale Plattform, wissenschaftliche Texte wie Hausarbeiten, Referate, Bachelorarbeiten, Masterarbeiten, Diplomarbeiten, Dissertationen und wissenschaftliche Aufsätze einem breiten Publikum zu präsentieren.
Kostenfreie Veröffentlichung: Hausarbeit, Bachelorarbeit, Diplomarbeit, Dissertation, Masterarbeit, Interpretation oder Referat jetzt veröffentlichen!
- GRIN Verlag GmbH
-
- Nymphenburger Str. 86
- 80636
- Munich, Deutschland
- +49 89-550559-0
- +49 89-550559-10
- info@grin.com
-



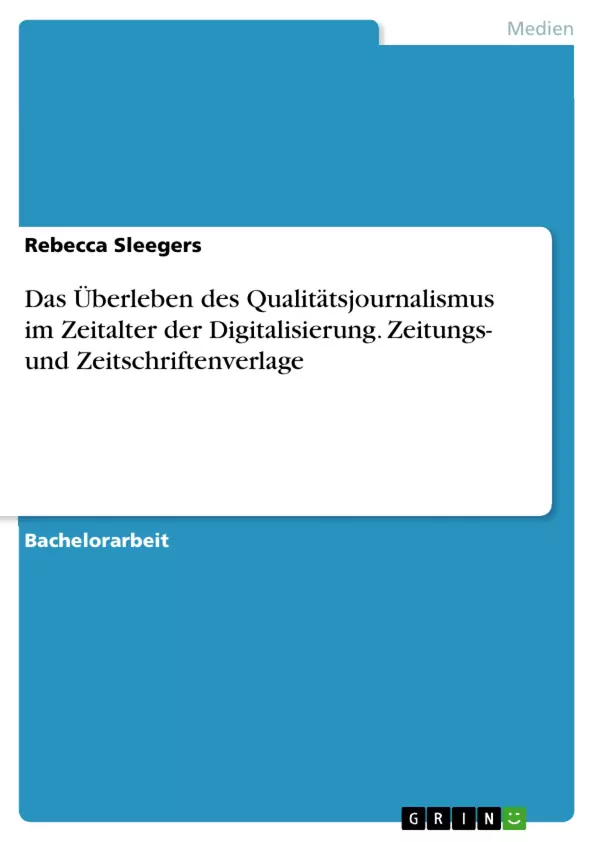






Kommentare