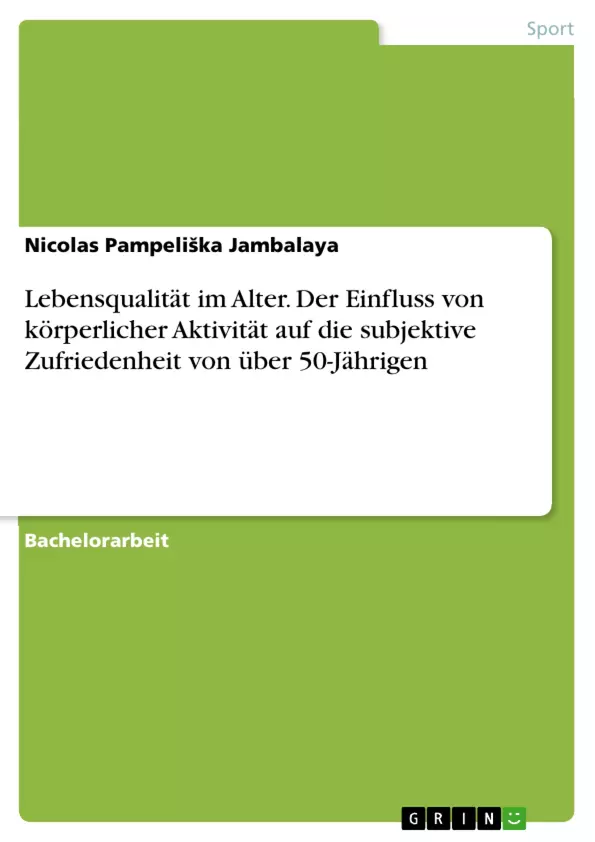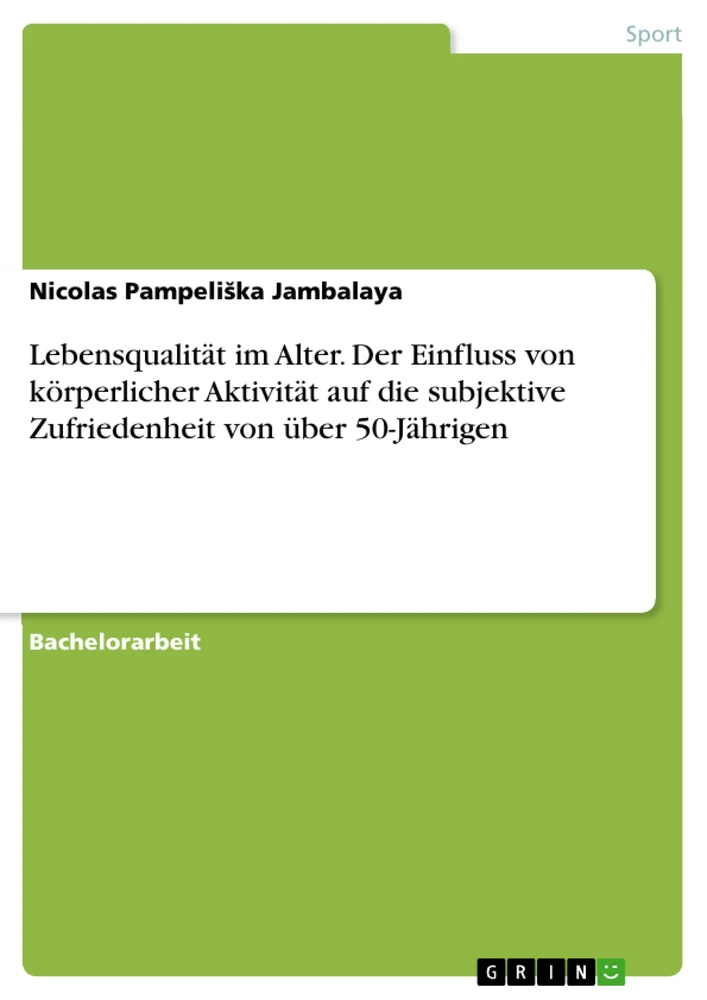
Lebensqualität im Alter. Der Einfluss von körperlicher Aktivität auf die subjektive Zufriedenheit von über 50-Jährigen
Bachelorarbeit, 2015
43 Seiten, Note: 1,8
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Theoretischer Hintergrund
- Forschungsstand
- Aktivitätstheorie
- Methodendarstellung
- Fragestellung und Hypothese
- Beschreibung des Untersuchungsguts
- Erhebungsinstrument
- Untersuchungsdesign
- Statistische Verfahren
- Deskriptive Statistik
- Analytische Statistik
- Ergebnisse
- Ergebnisse der deskriptiven Statistik
- Ergebnisse der analytischen Statistik
- Diskussion
- Diskussion der Methodik
- Diskussion der Ergebnisse
- Zusammenfassung und Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Bachelorarbeit befasst sich mit dem Einfluss von körperlicher Aktivität auf die subjektive Zufriedenheit von über 50-Jährigen. Ziel ist es, den Zusammenhang zwischen Bewegung und Befindlichkeit in dieser Altersgruppe zu untersuchen und zu analysieren. Die Arbeit beleuchtet den aktuellen Forschungsstand im Bereich des Alterssports und bezieht sich dabei auf die Aktivitätstheorie von Tartler.
- Die Bedeutung von Bewegung und Sport für die Lebensqualität im Alter
- Der Zusammenhang zwischen körperlicher Aktivität und der subjektiven Zufriedenheit
- Die Analyse des Einflusses von verschiedenen körperlichen Aktivitäten auf die Zufriedenheit
- Die Bedeutung der Wohnumgebung für die Mobilität und Lebensqualität von älteren Menschen
- Der Vergleich der Ergebnisse mit bisherigen Forschungsergebnissen
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt die demographische Entwicklung Deutschlands dar und zeigt die Herausforderungen auf, die mit der Alterung der Bevölkerung verbunden sind. Sie betont die Bedeutung von Sport und Bewegung für die Gesundheit und Lebensqualität im Alter.
Der theoretische Hintergrund beleuchtet den aktuellen Forschungsstand zum Einfluss von körperlicher Aktivität auf die Gesundheit und Zufriedenheit älterer Menschen. Zudem wird die Aktivitätstheorie von Tartler erläutert, die die Wichtigkeit von Aktivität und sozialer Einbindung im Alter hervorhebt.
Die Methodendarstellung beschreibt das Vorgehen der Studie, einschließlich der Fragestellung, Hypothese, Beschreibung des Untersuchungsguts, des Erhebungsinstruments, des Untersuchungsdesigns und der verwendeten statistischen Verfahren.
Die Ergebnisse präsentieren die deskriptiven und analytischen Ergebnisse der Studie. Dazu gehören die Häufigkeit von körperlichen Aktivitäten, die subjektive Zufriedenheit und die Korrelation zwischen diesen Variablen.
Die Diskussion befasst sich mit der Methodik der Studie und der Interpretation der Ergebnisse. Sie beleuchtet die Stärken und Schwächen der Studie und setzt die Ergebnisse in den Kontext der bestehenden Forschungsliteratur.
Die Zusammenfassung fasst die wichtigsten Ergebnisse der Studie zusammen und zeigt den Stellenwert der Studie im wissenschaftlichen Diskurs auf. Sie beleuchtet die Relevanz der Ergebnisse für die Praxis und gibt einen Ausblick auf zukünftige Forschungsvorhaben.
Schlüsselwörter
Lebensqualität im Alter, Alterssport, körperliche Aktivität, subjektive Zufriedenheit, Aktivitätstheorie, Demographischer Wandel, Fragebogenuntersuchung, Korrelationsanalyse, Wohnumgebung, Mobilität, Gerontologie.
Details
- Titel
- Lebensqualität im Alter. Der Einfluss von körperlicher Aktivität auf die subjektive Zufriedenheit von über 50-Jährigen
- Hochschule
- Deutsche Sporthochschule Köln
- Note
- 1,8
- Autor
- Nicolas Pampeliška Jambalaya (Autor:in)
- Erscheinungsjahr
- 2015
- Seiten
- 43
- Katalognummer
- V370699
- ISBN (eBook)
- 9783668483491
- ISBN (Buch)
- 9783668483507
- Dateigröße
- 1095 KB
- Sprache
- Deutsch
- Schlagworte
- lebensqualität alter einfluss aktivität zufriedenheit
- Produktsicherheit
- GRIN Publishing GmbH
- Preis (Ebook)
- US$ 19,99
- Preis (Book)
- US$ 29,99
- Arbeit zitieren
- Nicolas Pampeliška Jambalaya (Autor:in), 2015, Lebensqualität im Alter. Der Einfluss von körperlicher Aktivität auf die subjektive Zufriedenheit von über 50-Jährigen, München, Page::Imprint:: GRINVerlagOHG, https://www.diplomarbeiten24.de/document/370699
- Autor werden
- Ihre Optionen
- Vertriebskanäle
- Premium Services
- Autorenprofil
- Textarten und Formate
- Services für Verlage, Hochschulen, Unternehmen

- © GRIN Publishing GmbH.
- Alle Inhalte urheberrechtlich geschützt. Kopieren und verbreiten untersagt.
- info@grin.com
- AGB
- Open Publishing
Der GRIN Verlag hat sich seit 1998 auf die Veröffentlichung akademischer eBooks und Bücher spezialisiert. Der GRIN Verlag steht damit als erstes Unternehmen für User Generated Quality Content. Die Verlagsseiten GRIN.com, Hausarbeiten.de und Diplomarbeiten24 bieten für Hochschullehrer, Absolventen und Studenten die ideale Plattform, wissenschaftliche Texte wie Hausarbeiten, Referate, Bachelorarbeiten, Masterarbeiten, Diplomarbeiten, Dissertationen und wissenschaftliche Aufsätze einem breiten Publikum zu präsentieren.
Kostenfreie Veröffentlichung: Hausarbeit, Bachelorarbeit, Diplomarbeit, Dissertation, Masterarbeit, Interpretation oder Referat jetzt veröffentlichen!
- GRIN Verlag GmbH
-
- Nymphenburger Str. 86
- 80636
- Munich, Deutschland
- +49 89-550559-0
- +49 89-550559-10
- info@grin.com
-