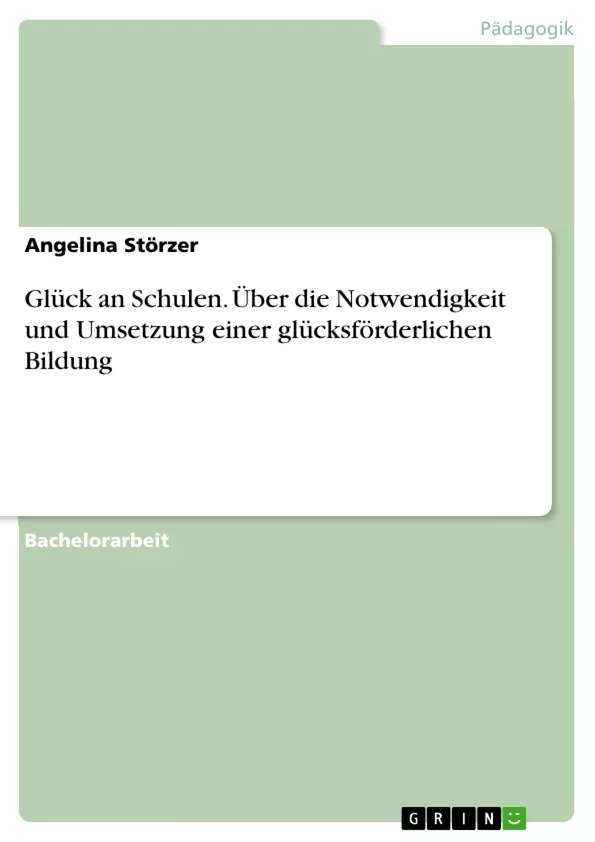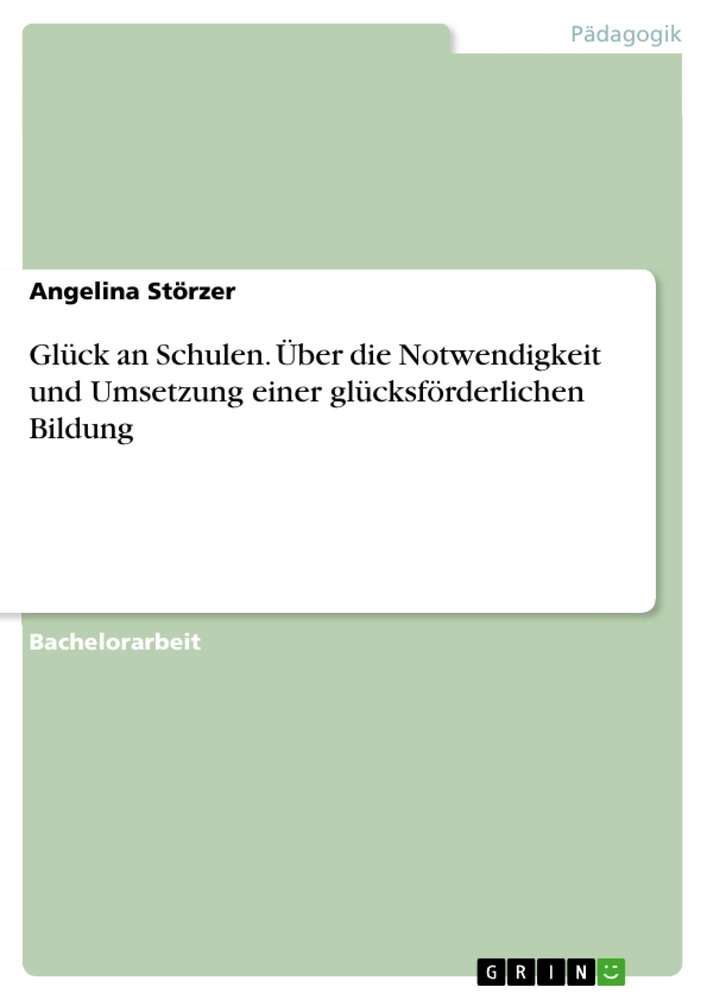
Glück an Schulen. Über die Notwendigkeit und Umsetzung einer glücksförderlichen Bildung
Bachelorarbeit, 2016
34 Seiten, Note: 1,3
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Über das Glück
- 2.1. Zum Glücksbegriff
- 2.2. Eudaimonismus versus Hedonismus
- 2.2.1. Eudaimonismus
- 2.2.2. Hedonismus
- 2.2.3. Lust und Tugend – Zusammenspiel statt Gegensatz
- 2.3. Erkenntnisse aus der Positiven Psychologie
- 2.3.1. Das PERMA-Modell nach Martin Seligman
- 2.3.2. Genetische Aspekte des Glücks
- 2.3.3. Macht Geld glücklich?
- 2.4. Anpassungs-Diskrepanz zwischen Steinzeit-Gehirn und Kulturwelt
- 2.5. Zusammenfassung
- 3. Glück in der Bildung
- 3.1. Effekte von Glückserleben auf kognitive Fähigkeiten
- 3.2. Schulfach Glück
- 3.2.1. Evaluation
- 3.2.2. Bewertung
- 3.3. Schulkritik
- 3.4. Die Montessori-Pädagogik
- 3.4.1. Studie von Rathunde & Csikszentmihalyi
- 3.4.2. Bewertung
- 4. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Bachelorarbeit untersucht die Notwendigkeit und Umsetzung glücksförderlicher Bildung an Schulen. Die Arbeit befasst sich mit der Frage, warum Schüler Kompetenzen zum Glücklichsein erlernen sollten und wie Schulen das Glück ihrer Schüler erhöhen können. Hierfür werden verschiedene Glückskonzepte, der Einfluss von Faktoren wie Genetik und sozioökonomischem Status auf das Glück, sowie pädagogische Ansätze zur Förderung des Wohlbefindens beleuchtet.
- Definition und verschiedene Konzepte von Glück (Hedonismus, Eudaimonismus)
- Einflussfaktoren auf das Glück (Genetik, sozioökonomischer Status)
- Der Zusammenhang zwischen Glück und kognitiven Fähigkeiten
- Pädagogische Ansätze zur Glücksförderung (Schulfach Glück, Montessori-Pädagogik)
- Kritik am deutschen Schulsystem hinsichtlich des Glücksempfindens von Schülern
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik der glücksförderlichen Bildung ein und stellt die zentrale Frage nach der Rolle von Schulen bei der Förderung des Schülerglücks. Ausgehend von der These, dass Glück mehrdimensional verstanden werden muss, werden die Forschungsfragen der Arbeit formuliert: Warum sollten Schüler Kompetenzen zum Glücklichsein an Schulen erlernen? Wie können Schulen das Glück der Schüler erhöhen? Die Einleitung skizziert den Aufbau der Arbeit und benennt die im Folgenden behandelten Aspekte, wie unterschiedliche Glückskonzepte, pädagogische Ansätze und Kritikpunkte am bestehenden Schulsystem.
2. Über das Glück: Dieses Kapitel befasst sich eingehend mit dem vielschichtigen Begriff des Glücks. Es werden Schwierigkeiten bei der Definition von „Glück“ im Deutschen aufgezeigt und verschiedene Glückskonzepte, insbesondere Hedonismus und Eudaimonismus, gegenübergestellt. Der Hedonismus, der auf der Maximierung von Lust und Vergnügen basiert, wird dem Eudaimonismus gegenübergestellt, der Tugendhaftigkeit und die Entfaltung des eigenen Potenzials als Schlüssel zum Glück betrachtet. Das Kapitel integriert Erkenntnisse aus der positiven Psychologie, insbesondere das PERMA-Modell von Seligman, und diskutiert den Einfluss von Faktoren wie Genetik und sozioökonomischem Status auf das subjektive Wohlbefinden. Die Frage nach dem Verhältnis von Glück und Zufriedenheit wird ebenfalls thematisiert.
3. Glück in der Bildung: Das Kapitel widmet sich der konkreten Umsetzung von Glücksförderung im Bildungskontext. Es untersucht den Einfluss des Glückserlebens auf kognitive Fähigkeiten und stellt das Konzept des „Schulfachs Glück“ von Ernst Fritz-Schubert vor. Eine kritische Auseinandersetzung mit dem deutschen Schulsystem hinsichtlich seiner Auswirkungen auf das Glücksempfinden der Schüler folgt. Abschließend wird die Montessori-Pädagogik als alternatives pädagogisches Konzept vorgestellt und hinsichtlich ihres Potenzials zur Glücksförderung bewertet. Dabei werden Studien zu diesem Thema herangezogen und die Ergebnisse kritisch diskutiert.
Schlüsselwörter
Glück, Glücksforschung, Hedonismus, Eudaimonismus, Positive Psychologie, PERMA-Modell, Bildung, Schule, Schülerwohlbefinden, Montessori-Pädagogik, Schulkritik, Wohlbefinden, Lebenszufriedenheit.
Häufig gestellte Fragen zur Bachelorarbeit: Glücksförderung in der Bildung
Was ist der Gegenstand dieser Bachelorarbeit?
Die Arbeit untersucht die Notwendigkeit und Umsetzung glücksfördernder Bildung an Schulen. Sie befasst sich mit der Frage, warum Schüler Kompetenzen zum Glücklichsein erlernen sollten und wie Schulen das Glück ihrer Schüler erhöhen können. Dafür werden verschiedene Glückskonzepte, der Einfluss von Faktoren wie Genetik und sozioökonomischem Status auf das Glück sowie pädagogische Ansätze zur Förderung des Wohlbefindens beleuchtet.
Welche Glückskonzepte werden behandelt?
Die Arbeit vergleicht vor allem Hedonismus und Eudaimonismus. Hedonismus wird als Maximierung von Lust und Vergnügen definiert, während Eudaimonismus Tugendhaftigkeit und die Entfaltung des eigenen Potenzials als Schlüssel zum Glück betrachtet. Zusätzlich wird das PERMA-Modell der Positiven Psychologie von Martin Seligman berücksichtigt.
Welche Einflussfaktoren auf das Glück werden untersucht?
Die Arbeit untersucht den Einfluss von genetischen Faktoren und dem sozioökonomischen Status auf das subjektive Wohlbefinden der Schüler. Der Zusammenhang zwischen Glück und kognitiven Fähigkeiten wird ebenfalls beleuchtet.
Welche pädagogischen Ansätze zur Glücksförderung werden vorgestellt?
Die Arbeit präsentiert das Konzept des „Schulfachs Glück“ und die Montessori-Pädagogik als alternative pädagogische Konzepte zur Glücksförderung. Studien zu diesen Ansätzen werden kritisch diskutiert.
Wie wird das deutsche Schulsystem kritisch betrachtet?
Die Arbeit enthält eine kritische Auseinandersetzung mit dem deutschen Schulsystem und seinen Auswirkungen auf das Glücksempfinden der Schüler. Es werden Schwachstellen aufgezeigt und Verbesserungspotenziale diskutiert.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einleitung, ein Kapitel über das Glück (inkl. Hedonismus, Eudaimonismus und positiver Psychologie), ein Kapitel über Glück in der Bildung (inkl. Schulfach Glück und Montessori-Pädagogik) und ein Fazit.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Glück, Glücksforschung, Hedonismus, Eudaimonismus, Positive Psychologie, PERMA-Modell, Bildung, Schule, Schülerwohlbefinden, Montessori-Pädagogik, Schulkritik, Wohlbefinden, Lebenszufriedenheit.
Welche Forschungsfragen werden in der Arbeit behandelt?
Die zentralen Forschungsfragen sind: Warum sollten Schüler Kompetenzen zum Glücklichsein an Schulen erlernen? Und: Wie können Schulen das Glück der Schüler erhöhen?
Welche Zusammenfassung der Kapitel bietet die Arbeit?
Die Arbeit bietet Kapitelzusammenfassungen, die jeweils die Kernaussagen und die behandelten Aspekte jedes Kapitels prägnant zusammenfassen.
Für wen ist diese Arbeit relevant?
Diese Arbeit ist relevant für Pädagogen, Bildungswissenschaftler, Studenten und alle, die sich für die Förderung des Wohlbefindens von Schülern und die Gestaltung eines glücksförderlichen Bildungssystems interessieren.
Details
- Titel
- Glück an Schulen. Über die Notwendigkeit und Umsetzung einer glücksförderlichen Bildung
- Hochschule
- Universität zu Köln
- Note
- 1,3
- Autor
- Angelina Störzer (Autor:in)
- Erscheinungsjahr
- 2016
- Seiten
- 34
- Katalognummer
- V370771
- ISBN (eBook)
- 9783668483750
- ISBN (Buch)
- 9783668483767
- Dateigröße
- 901 KB
- Sprache
- Deutsch
- Schlagworte
- Schulfach Glück Martin Seligman Eudaimonismus Hedonismus
- Produktsicherheit
- GRIN Publishing GmbH
- Preis (Ebook)
- US$ 16,99
- Preis (Book)
- US$ 18,99
- Arbeit zitieren
- Angelina Störzer (Autor:in), 2016, Glück an Schulen. Über die Notwendigkeit und Umsetzung einer glücksförderlichen Bildung, München, Page::Imprint:: GRINVerlagOHG, https://www.diplomarbeiten24.de/document/370771
- Autor werden
- Ihre Optionen
- Vertriebskanäle
- Premium Services
- Autorenprofil
- Textarten und Formate
- Services für Verlage, Hochschulen, Unternehmen

- © GRIN Publishing GmbH.
- Alle Inhalte urheberrechtlich geschützt. Kopieren und verbreiten untersagt.
- info@grin.com
- AGB
- Open Publishing
Der GRIN Verlag hat sich seit 1998 auf die Veröffentlichung akademischer eBooks und Bücher spezialisiert. Der GRIN Verlag steht damit als erstes Unternehmen für User Generated Quality Content. Die Verlagsseiten GRIN.com, Hausarbeiten.de und Diplomarbeiten24 bieten für Hochschullehrer, Absolventen und Studenten die ideale Plattform, wissenschaftliche Texte wie Hausarbeiten, Referate, Bachelorarbeiten, Masterarbeiten, Diplomarbeiten, Dissertationen und wissenschaftliche Aufsätze einem breiten Publikum zu präsentieren.
Kostenfreie Veröffentlichung: Hausarbeit, Bachelorarbeit, Diplomarbeit, Dissertation, Masterarbeit, Interpretation oder Referat jetzt veröffentlichen!
- GRIN Verlag GmbH
-
- Nymphenburger Str. 86
- 80636
- Munich, Deutschland
- +49 89-550559-0
- +49 89-550559-10
- info@grin.com
-