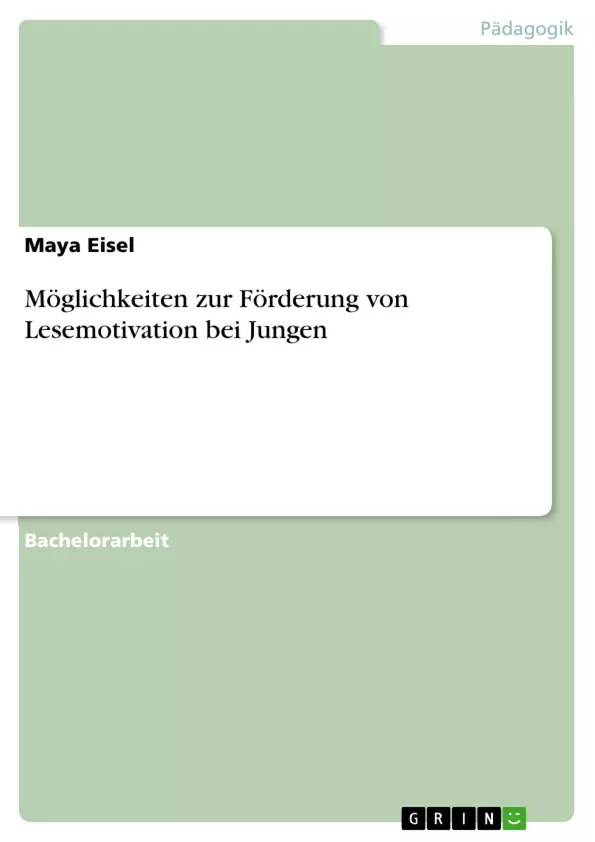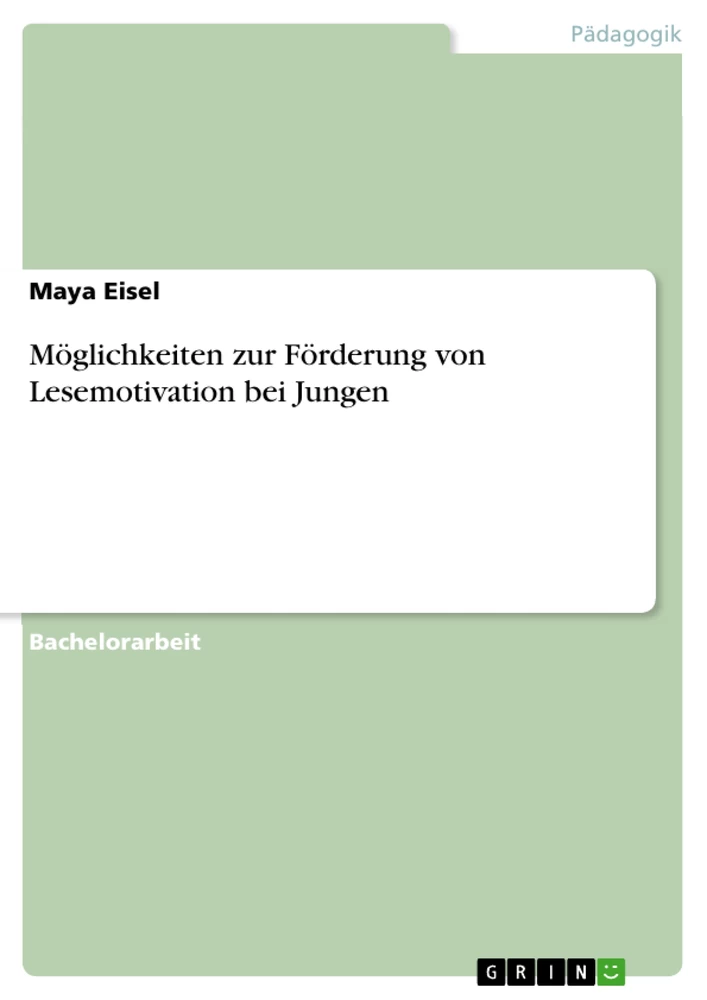
Möglichkeiten zur Förderung von Lesemotivation bei Jungen
Bachelorarbeit, 2017
56 Seiten, Note: 2,0
Didaktik für das Fach Deutsch - Pädagogik, Sprachwissenschaft
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- PISA
- Anliegen von PISA
- Ergebnisse zur Lesekompetenz
- Begriffstheoretische Überlegungen
- Lesekompetenz
- Lesemotivation
- Zusammenhang von Lesekompetenz und Lesemotivation
- Stabile Genderdifferenzen
- Lesequantität
- Lesestoffe und Lektürepräferenzen
- Lesefreude
- Lesekompetenz
- Erklärungsansätze für Genderdifferenzen im Lesen
- Biologische und hirnphysiologische Ansätze
- Soziologische und psychologische Erklärungsansätze
- Didaktische Konsequenzen
- Gesellschaftliche Aufgabenfelder
- Schulische Aufgabenfelder
- Förderung der Lesemotivation im Medienverbund
- Begriffliche Determination von neuen Medien und Medienverbund
- Medienkompetenz als Voraussetzung und Ziel
- Exemplarischer Medienverbund: „Die Wilden Fußballkerle“
- Ausgangstext
- Didaktisches Potenzial von Filmen
- Didaktisches Potenzial von Computerspielen
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit befasst sich mit der Förderung von Lesemotivation bei Jungen und untersucht die Ursachen für Genderdifferenzen im Lesen. Dabei wird der Zusammenhang zwischen Lesemotivation und Lesekompetenz beleuchtet und es werden didaktische Konsequenzen für die Förderung von Lesemotivation im Medienverbund aufgezeigt.
- Genderdifferenzen im Lesen und ihre Ursachen
- Zusammenhang zwischen Lesemotivation und Lesekompetenz
- Didaktische Konsequenzen für die Förderung von Lesemotivation
- Der Einsatz von digitalen Medien im Unterricht
- Medienkompetenz als Voraussetzung für erfolgreiche Leseförderung
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Die Einleitung stellt die Problemstellung dar, die sich aus den Ergebnissen der PISA-Studie ergibt. Es werden die Genderdifferenzen im Lesen und die damit einhergehende Bedeutung der Lesemotivation für Jungen beleuchtet. Die Arbeit soll einen Beitrag zur Förderung von Lesemotivation durch den Einsatz digitaler Medien leisten.
- PISA: Dieses Kapitel gibt eine kurze Übersicht über die wichtigsten Befunde der PISA-Studie aus dem Jahr 2000 und beleuchtet die defizitären Leistungen deutscher Schülerinnen und Schüler, insbesondere im Bereich der Lesekompetenz bei Jungen.
- Begriffstheoretische Überlegungen: Die Kapitel behandelt die zentralen Begriffe Lesekompetenz und Lesemotivation und verdeutlicht den Zusammenhang zwischen beiden. Es werden verschiedene Definitionen und Modelle vorgestellt.
- Stabile Genderdifferenzen: Dieses Kapitel präsentiert die Unterschiede zwischen Jungen und Mädchen hinsichtlich der Lesequantität, Lesestoffe, Lesefreude und Lesekompetenz. Es werden empirische Befunde und Studien zitiert, die diese Unterschiede belegen.
- Erklärungsansätze für Genderdifferenzen im Lesen: Dieses Kapitel diskutiert verschiedene Erklärungsansätze für die Genderdifferenzen im Lesen. Dabei werden sowohl biologische und hirnphysiologische als auch soziologische und psychologische Ansätze beleuchtet.
- Didaktische Konsequenzen: Dieses Kapitel behandelt die didaktischen Konsequenzen aus den vorgestellten Ergebnissen und stellt gesellschaftliche und schulische Aufgabenfelder für die Förderung von Lesemotivation bei Jungen vor.
- Förderung der Lesemotivation im Medienverbund: Dieses Kapitel widmet sich der Förderung von Lesemotivation im Medienverbund. Es werden die Begriffe "neue Medien" und "Medienverbund" definiert und die Bedeutung von Medienkompetenz für den erfolgreichen Einsatz von digitalen Medien im Unterricht herausgestellt.
Schlüsselwörter
Die vorliegende Arbeit befasst sich mit den Themen Lesemotivation, Genderdifferenzen im Lesen, digitale Medien im Unterricht, Medienkompetenz, PISA-Studie, Lesekompetenz und Förderung von Lesemotivation bei Jungen.
Häufig gestellte Fragen
Welche Ergebnisse lieferte die PISA-Studie 2000 zur Lesekompetenz von Jungen?
Die PISA-Studie 2000 zeigte deutliche Defizite in der Lesekompetenz deutscher Schüler auf, wobei Jungen im Vergleich zu Mädchen signifikant schlechter abschnitten.
Wie hängen Lesekompetenz und Lesemotivation zusammen?
Lesekompetenz und Lesemotivation beeinflussen sich gegenseitig: Eine hohe Motivation führt zu mehr Leseübung, was die Kompetenz steigert, während Erfolgserlebnisse beim Lesen wiederum die Motivation erhöhen.
Welche Genderdifferenzen gibt es bei den Lektürepräferenzen?
Jungen bevorzugen oft Sachtexte, Comics oder spannende Abenteuergeschichten, während Mädchen häufiger zu erzählender Literatur greifen. Diese Unterschiede beeinflussen die allgemeine Lesefreude.
Warum wird der Medienverbund zur Leseförderung genutzt?
Der Medienverbund (z. B. Buch, Film, Computerspiel) nutzt das Interesse von Jungen an digitalen Medien, um einen Zugang zum Text zu schaffen und die Lesemotivation zu steigern.
Welche Erklärungsansätze gibt es für die Leseunterschiede zwischen den Geschlechtern?
Es gibt sowohl biologisch-hirnphysiologische Ansätze als auch soziologische und psychologische Erklärungen, wobei letztere oft die Rolle von Rollenbildern und Erziehung betonen.
Wie kann das Beispiel „Die Wilden Fußballkerle“ im Unterricht helfen?
Da die Thematik Fußball Jungen im Grundschulalter stark anspricht, bietet dieser Medienverbund ein hohes didaktisches Potenzial, um über Filme und Spiele das Interesse am Lesen des Originaltextes zu wecken.
Details
- Titel
- Möglichkeiten zur Förderung von Lesemotivation bei Jungen
- Hochschule
- Universität zu Köln (Institut für deutsche Sprache und Literatur II)
- Note
- 2,0
- Autor
- Maya Eisel (Autor:in)
- Erscheinungsjahr
- 2017
- Seiten
- 56
- Katalognummer
- V374456
- ISBN (eBook)
- 9783668522381
- ISBN (Buch)
- 9783668522398
- Dateigröße
- 682 KB
- Sprache
- Deutsch
- Schlagworte
- möglichkeiten förderung lesemotivation jungen
- Produktsicherheit
- GRIN Publishing GmbH
- Preis (Ebook)
- US$ 20,99
- Preis (Book)
- US$ 29,99
- Arbeit zitieren
- Maya Eisel (Autor:in), 2017, Möglichkeiten zur Förderung von Lesemotivation bei Jungen, München, Page::Imprint:: GRINVerlagOHG, https://www.diplomarbeiten24.de/document/374456
- Autor werden
- Ihre Optionen
- Vertriebskanäle
- Premium Services
- Autorenprofil
- Textarten und Formate
- Services für Verlage, Hochschulen, Unternehmen

- © GRIN Publishing GmbH.
- Alle Inhalte urheberrechtlich geschützt. Kopieren und verbreiten untersagt.
- info@grin.com
- AGB
- Open Publishing
Der GRIN Verlag hat sich seit 1998 auf die Veröffentlichung akademischer eBooks und Bücher spezialisiert. Der GRIN Verlag steht damit als erstes Unternehmen für User Generated Quality Content. Die Verlagsseiten GRIN.com, Hausarbeiten.de und Diplomarbeiten24 bieten für Hochschullehrer, Absolventen und Studenten die ideale Plattform, wissenschaftliche Texte wie Hausarbeiten, Referate, Bachelorarbeiten, Masterarbeiten, Diplomarbeiten, Dissertationen und wissenschaftliche Aufsätze einem breiten Publikum zu präsentieren.
Kostenfreie Veröffentlichung: Hausarbeit, Bachelorarbeit, Diplomarbeit, Dissertation, Masterarbeit, Interpretation oder Referat jetzt veröffentlichen!
- GRIN Verlag GmbH
-
- Nymphenburger Str. 86
- 80636
- Munich, Deutschland
- +49 89-550559-0
- +49 89-550559-10
- info@grin.com
-