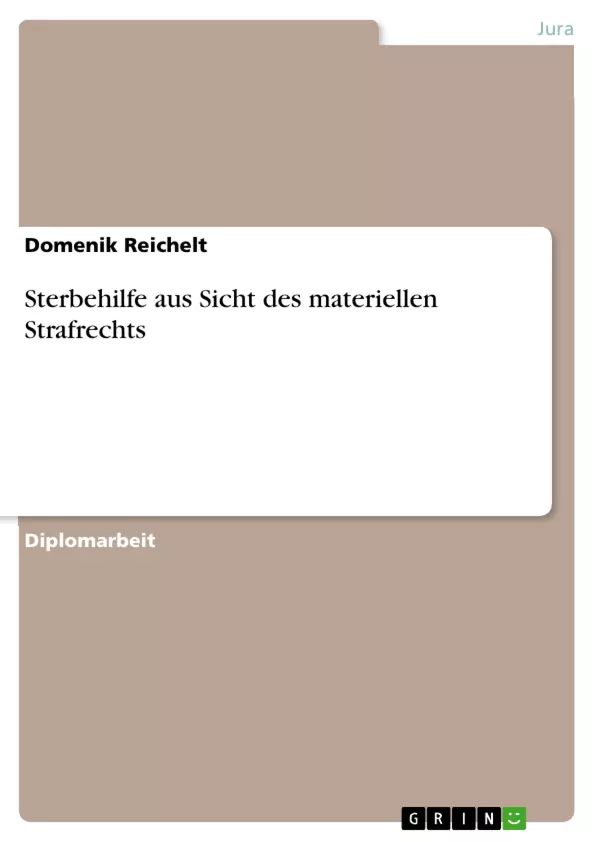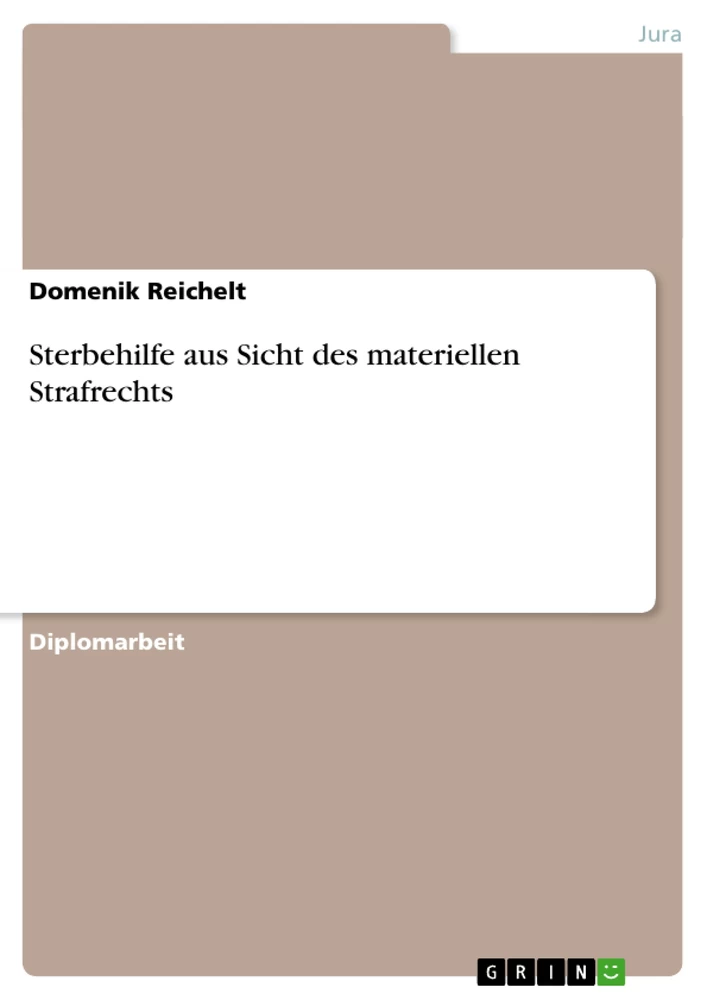
Sterbehilfe aus Sicht des materiellen Strafrechts
Diplomarbeit, 2004
140 Seiten, Note: 1,0
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
- Einführung
- Begriffsbestimmungen
- Aktive Sterbehilfe
- Indirekte Sterbehilfe
- Passive Sterbehilfe
- Sterbebegleitung
- Juristische Behandlung
- Aktive Sterbehilfe
- Auf Verlangen des Patienten
- Ohne Verlangen des Patienten
- Indirekte Sterbehilfe
- Auf Verlangen des Patienten
- Ohne Verlangen des Patienten
- Passive Sterbehilfe
- Abgrenzung der passiven Sterbehilfe von der aktiven Sterbehilfe
- Auf Verlangen des Patienten
- Ohne Verlangen des Patienten
- Gegen den Willen des Patienten
- Sterbebegleitung
- Auf Verlangen des Patienten
- Gegen den Willen des Patienten
- Aktive Sterbehilfe
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Diplomarbeit untersucht die Sterbehilfe aus der Perspektive des materiellen Strafrechts. Ziel ist es, die verschiedenen Formen der Sterbehilfe (aktiv, indirekt, passiv) und die damit verbundenen strafrechtlichen Aspekte zu analysieren und zu bewerten. Die Arbeit beleuchtet die Rechtslage in Deutschland und berücksichtigt dabei die jeweiligen Strafbarkeitsvorschriften und deren Auslegung durch die Rechtsprechung.
- Definition und Abgrenzung verschiedener Formen der Sterbehilfe
- Strafbarkeit der Sterbehilfe nach deutschem Strafrecht (§§ 211, 212, 216 StGB u.a.)
- Rechtfertigungs- und Entschuldigungsmöglichkeiten im Kontext der Sterbehilfe
- Untersuchung der Rolle des Patientenwillens
- Analyse der passiven Sterbehilfe und ihrer Abgrenzung zur aktiven Sterbehilfe
Zusammenfassung der Kapitel
Einführung: Die Einleitung legt den Fokus der Arbeit dar: die juristische Auseinandersetzung mit Sterbehilfe im deutschen Strafrecht. Sie skizziert den Aufbau und die Methodik der Arbeit und benennt die zentralen Fragestellungen, die im Laufe der Arbeit beantwortet werden sollen. Die Einleitung dient als Wegweiser durch die komplexen Themen und bereitet den Leser auf die detaillierte Analyse der verschiedenen Formen der Sterbehilfe vor.
Begriffsbestimmungen: Dieses Kapitel liefert präzise Definitionen der verschiedenen Arten von Sterbehilfe (aktiv, indirekt, passiv) und der Sterbebegleitung. Es wird klar zwischen dem aktiven Handeln, dem Unterlassen und der bloßen Begleitung am Lebensende unterschieden. Die Definitionen bilden die Grundlage für die anschließende juristische Analyse und ermöglichen ein präzises Verständnis der verschiedenen Konstellationen. Die klare Abgrenzung der Begriffe ist entscheidend für die spätere Bewertung der jeweiligen strafrechtlichen Relevanz.
Juristische Behandlung: Dieses umfangreiche Kapitel stellt den Kern der Arbeit dar. Es analysiert die verschiedenen Formen der Sterbehilfe unter Berücksichtigung der relevanten Paragrafen des Strafgesetzbuches (StGB). Für jede Form der Sterbehilfe und jede Konstellation (mit oder ohne Verlangen des Patienten) werden die einschlägigen Strafbestimmungen untersucht, Rechtfertigungs- und Entschuldigungsmöglichkeiten diskutiert und die Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs (BGH) und anderer Gerichte einbezogen. Das Kapitel gliedert sich in detaillierte Unterkapitel, die jeweils eine spezifische Form der Sterbehilfe und ihre strafrechtlichen Implikationen im Detail beleuchten. Die Analyse umfasst unter anderem die §§ 211, 212, 213, 216, 222, 223, 323c und 239 StGB.
Schlüsselwörter
Sterbehilfe, aktiver Sterbehilfe, passive Sterbehilfe, indirekte Sterbehilfe, Sterbebegleitung, Strafrecht, Strafgesetzbuch (StGB), §§ 211, 212, 216 StGB, Tötung auf Verlangen, Selbsttötung, Rechtfertigung, Entschuldigung, Patientenwille, Lebenserhaltungspflicht, Bundesgerichtshof (BGH), Rechtsprechung.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Diplomarbeit: Juristische Analyse der Sterbehilfe
Was ist der Gegenstand dieser Diplomarbeit?
Die Diplomarbeit analysiert die Sterbehilfe aus strafrechtlicher Perspektive in Deutschland. Sie untersucht die verschiedenen Formen der Sterbehilfe (aktiv, passiv, indirekt) und deren strafrechtliche Relevanz, berücksichtigt die jeweilige Rechtslage und die Rechtsprechung.
Welche Formen der Sterbehilfe werden behandelt?
Die Arbeit behandelt aktive, passive und indirekte Sterbehilfe sowie die Sterbebegleitung. Für jede Form werden die verschiedenen Konstellationen (mit oder ohne Verlangen des Patienten) betrachtet.
Welche Rechtsgrundlagen werden untersucht?
Die Arbeit analysiert die relevanten Paragraphen des deutschen Strafgesetzbuches (StGB), insbesondere §§ 211, 212, 213, 216, 222, 223, 323c und 239 StGB. Die Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs (BGH) und anderer Gerichte wird einbezogen.
Wie werden die verschiedenen Formen der Sterbehilfe abgegrenzt?
Das Kapitel „Begriffsbestimmungen“ liefert präzise Definitionen der verschiedenen Arten von Sterbehilfe und Sterbebegleitung. Es wird klar zwischen aktivem Handeln, Unterlassen und Begleitung am Lebensende unterschieden. Diese Abgrenzung ist Grundlage für die juristische Analyse.
Welche Rolle spielt der Patientenwille?
Der Patientenwille spielt eine zentrale Rolle in der Analyse. Die Arbeit untersucht die Strafbarkeit der Sterbehilfe mit und ohne Verlangen des Patienten für jede Form der Sterbehilfe.
Welche Rechtfertigungs- und Entschuldigungsmöglichkeiten werden betrachtet?
Die Arbeit diskutiert mögliche Rechtfertigungs- und Entschuldigungsgrundsätze im Kontext der Sterbehilfe, die im Einzelfall eine Strafbarkeit ausschließen könnten.
Wie ist die Arbeit aufgebaut?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einleitung, ein Kapitel mit Begriffsbestimmungen, ein umfangreiches Kapitel zur juristischen Behandlung der verschiedenen Sterbehilfeformen und ein Fazit. Sie enthält außerdem ein Inhaltsverzeichnis, die Zielsetzung und Themenschwerpunkte, Kapitelzusammenfassungen und Schlüsselwörter.
Welche Schlüsselwörter sind relevant?
Schlüsselwörter sind: Sterbehilfe, aktive Sterbehilfe, passive Sterbehilfe, indirekte Sterbehilfe, Sterbebegleitung, Strafrecht, Strafgesetzbuch (StGB), §§ 211, 212, 216 StGB, Tötung auf Verlangen, Selbsttötung, Rechtfertigung, Entschuldigung, Patientenwille, Lebenserhaltungspflicht, Bundesgerichtshof (BGH), Rechtsprechung.
Wo finde ich detaillierte Informationen zur passiven Sterbehilfe?
Das Kapitel „Juristische Behandlung“ enthält einen detaillierten Abschnitt zur passiven Sterbehilfe, inklusive der Abgrenzung zur aktiven Sterbehilfe und der Untersuchung der verschiedenen Konstellationen (mit und ohne Verlangen des Patienten, gegen den Willen des Patienten).
Welche konkreten Fragen werden in der Arbeit beantwortet?
Die Arbeit beantwortet Fragen zur Definition und Abgrenzung verschiedener Formen der Sterbehilfe, zur Strafbarkeit nach deutschem Strafrecht, zu Rechtfertigungs- und Entschuldigungsmöglichkeiten und zur Rolle des Patientenwillens bei den verschiedenen Formen der Sterbehilfe.
Details
- Titel
- Sterbehilfe aus Sicht des materiellen Strafrechts
- Hochschule
- Fachhochschule Villingen-Schwenningen - Hochschule für Polizei
- Note
- 1,0
- Autor
- Domenik Reichelt (Autor:in)
- Erscheinungsjahr
- 2004
- Seiten
- 140
- Katalognummer
- V37461
- ISBN (eBook)
- 9783638367943
- Dateigröße
- 992 KB
- Sprache
- Deutsch
- Schlagworte
- Sterbehilfe Sicht Strafrechts
- Produktsicherheit
- GRIN Publishing GmbH
- Preis (Ebook)
- US$ 38,99
- Arbeit zitieren
- Domenik Reichelt (Autor:in), 2004, Sterbehilfe aus Sicht des materiellen Strafrechts, München, Page::Imprint:: GRINVerlagOHG, https://www.diplomarbeiten24.de/document/37461
- Autor werden
- Ihre Optionen
- Vertriebskanäle
- Premium Services
- Autorenprofil
- Textarten und Formate
- Services für Verlage, Hochschulen, Unternehmen

- © GRIN Publishing GmbH.
- Alle Inhalte urheberrechtlich geschützt. Kopieren und verbreiten untersagt.
- info@grin.com
- AGB
- Open Publishing
Der GRIN Verlag hat sich seit 1998 auf die Veröffentlichung akademischer eBooks und Bücher spezialisiert. Der GRIN Verlag steht damit als erstes Unternehmen für User Generated Quality Content. Die Verlagsseiten GRIN.com, Hausarbeiten.de und Diplomarbeiten24 bieten für Hochschullehrer, Absolventen und Studenten die ideale Plattform, wissenschaftliche Texte wie Hausarbeiten, Referate, Bachelorarbeiten, Masterarbeiten, Diplomarbeiten, Dissertationen und wissenschaftliche Aufsätze einem breiten Publikum zu präsentieren.
Kostenfreie Veröffentlichung: Hausarbeit, Bachelorarbeit, Diplomarbeit, Dissertation, Masterarbeit, Interpretation oder Referat jetzt veröffentlichen!
- GRIN Verlag GmbH
-
- Nymphenburger Str. 86
- 80636
- Munich, Deutschland
- +49 89-550559-0
- +49 89-550559-10
- info@grin.com
-