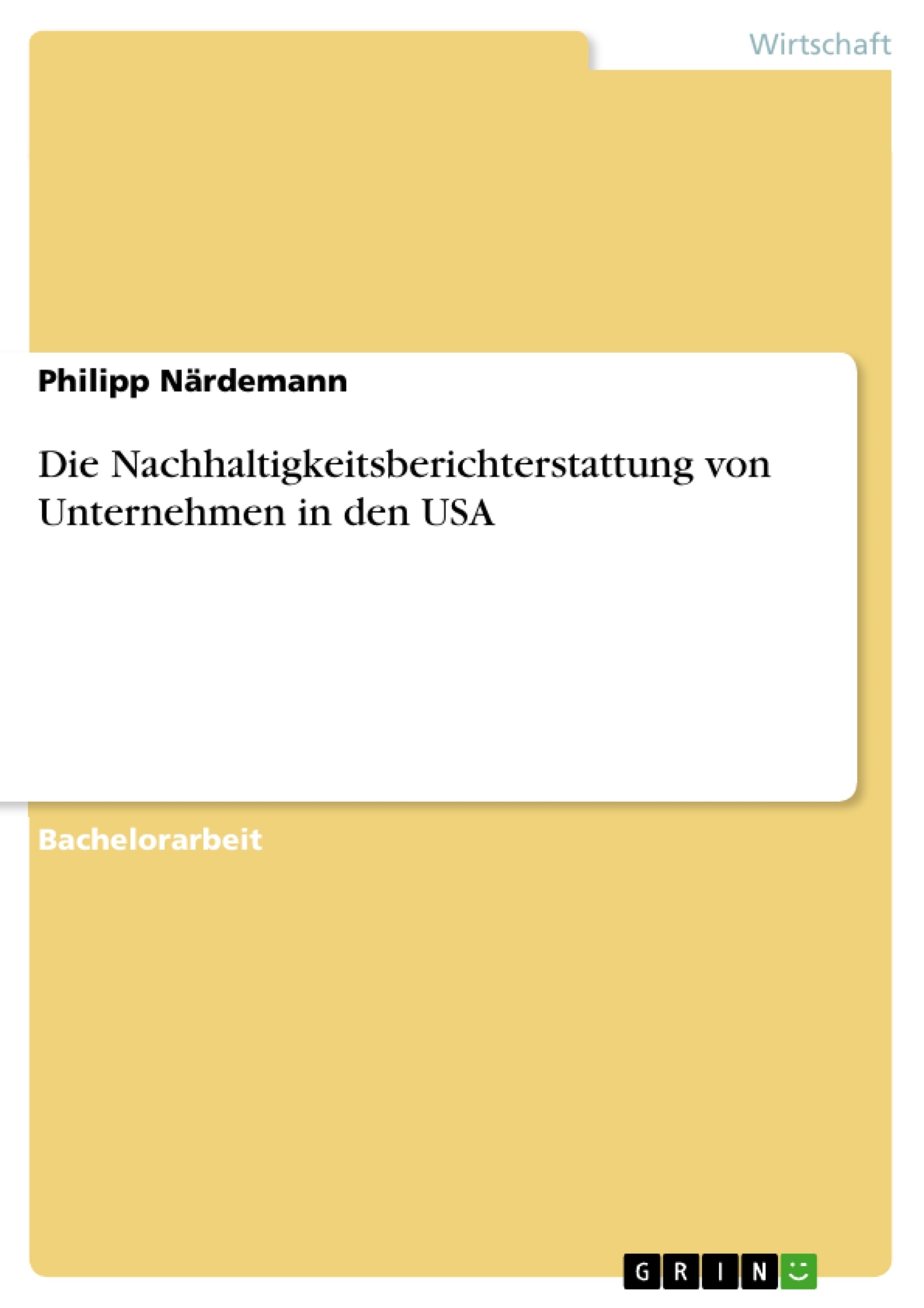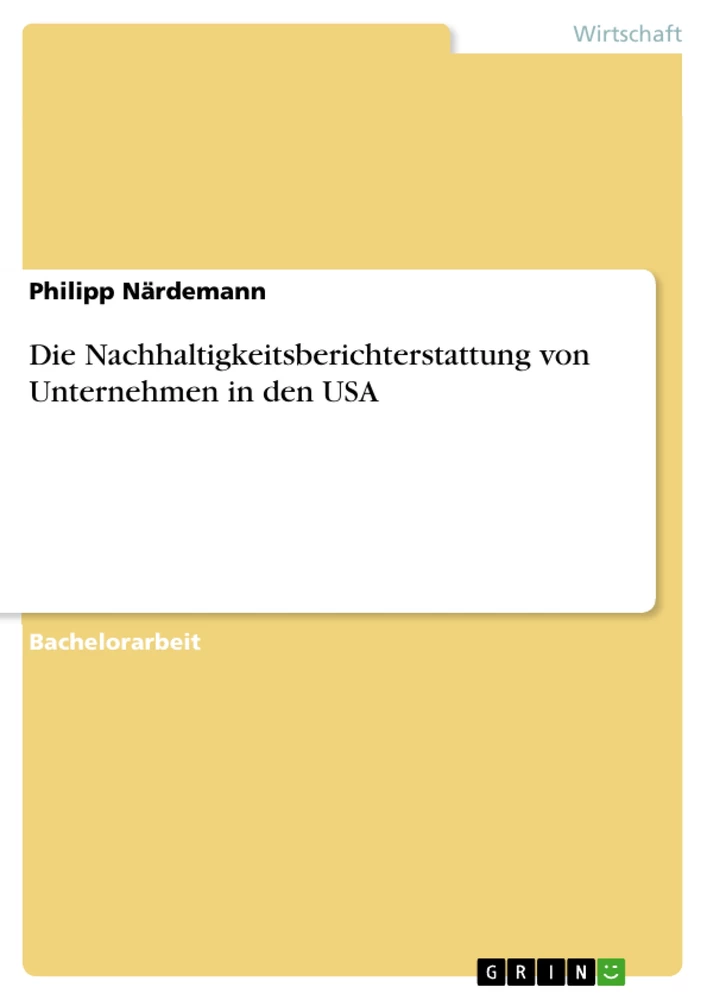
Die Nachhaltigkeitsberichterstattung von Unternehmen in den USA
Bachelorarbeit, 2013
41 Seiten, Note: 2,3
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 1.1 Problemstellung und Aufbau der Arbeit
- 1.2 Grundlagenwissen
- 2. Formen und Institutionen der Nachhaltigkeitsberichterstattung
- 2.1 Berichterstattung in den USA
- 2.2 Formen und Institutionen der Nachhaltigkeitsberichterstattung
- 2.3 Global Reporting Initiative (GRI)
- 2.4 Sustainability Accounting Standards Board (SASB)
- 3. Praxis der Nachhaltigkeitsberichterstattung
- 3.1 Praktische Berichterstattung
- 3.2 Synergien und Antagonismen angewandter Richtlinien
- 4. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit untersucht die Nachhaltigkeitsberichterstattung von Unternehmen in den USA und analysiert die Bedeutung der Global Reporting Initiative (GRI) und des Sustainability Accounting Standards Board (SASB) in diesem Kontext. Ziel ist es, die verschiedenen Formen und Institutionen der Nachhaltigkeitsberichterstattung vorzustellen, die GRI- und SASB-Richtlinien zu vergleichen und ihre Anwendbarkeit in der Praxis zu beleuchten.
- Entwicklung der Nachhaltigkeitsberichterstattung in den USA
- Vergleich der GRI- und SASB-Richtlinien
- Praxisbezogene Anwendung der Richtlinien
- Synergien und Antagonismen bei der Anwendung der Richtlinien
- Zukünftige Entwicklung der Nachhaltigkeitsberichterstattung
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung
Das erste Kapitel führt in die Problemstellung und den Aufbau der Arbeit ein. Es beleuchtet die steigende Bedeutung der Nachhaltigkeitsberichterstattung und die Notwendigkeit von Rahmenwerken für die Vergleichbarkeit von Informationen. Des Weiteren wird die Bedeutung des Shareholder Value Ansatzes und die Notwendigkeit einer breiteren Stakeholder-Perspektive in der Berichterstattung diskutiert.
2. Formen und Institutionen der Nachhaltigkeitsberichterstattung
Das zweite Kapitel stellt die wichtigsten Formen und Institutionen der Nachhaltigkeitsberichterstattung vor, mit besonderem Fokus auf die USA. Es erläutert die verschiedenen Richtlinien und Standards wie GRI und SASB und deren Bedeutung für Unternehmen in den USA. Darüber hinaus werden die Ziele und die Struktur der jeweiligen Richtlinien näher betrachtet.
3. Praxis der Nachhaltigkeitsberichterstattung
Das dritte Kapitel analysiert die praktische Anwendung der Nachhaltigkeitsberichterstattung in den USA. Es zeigt anhand von Praxisbeispielen, wie Unternehmen die GRI- und SASB-Richtlinien umsetzen und welche Daten durch das SASB ergänzt werden müssen. Darüber hinaus werden die Synergien und Antagonismen bei der Anwendung beider Richtlinien betrachtet.
Schlüsselwörter
Nachhaltigkeitsberichterstattung, Unternehmen, USA, Global Reporting Initiative (GRI), Sustainability Accounting Standards Board (SASB), Stakeholder, Finanzberichterstattung, IFRS, US-GAAP, HGB, Umweltverschmutzung, erneuerbare Energien, Mitarbeiterzufriedenheit, Performance, Investoren, Analysten, Rahmenwerk, Richtlinien.
Details
- Titel
- Die Nachhaltigkeitsberichterstattung von Unternehmen in den USA
- Hochschule
- Ruhr-Universität Bochum
- Note
- 2,3
- Autor
- Philipp Närdemann (Autor:in)
- Erscheinungsjahr
- 2013
- Seiten
- 41
- Katalognummer
- V377366
- ISBN (eBook)
- 9783668546189
- ISBN (Buch)
- 9783668546196
- Dateigröße
- 688 KB
- Sprache
- Deutsch
- Schlagworte
- Corporate Governance Corporate Social Responsibility Nachhaltigkeit Nachhaltigkeitsberichterstattung Integrated Reporting
- Produktsicherheit
- GRIN Publishing GmbH
- Preis (Ebook)
- US$ 20,99
- Preis (Book)
- US$ 29,99
- Arbeit zitieren
- Philipp Närdemann (Autor:in), 2013, Die Nachhaltigkeitsberichterstattung von Unternehmen in den USA, München, Page::Imprint:: GRINVerlagOHG, https://www.diplomarbeiten24.de/document/377366
- Autor werden
- Ihre Optionen
- Vertriebskanäle
- Premium Services
- Autorenprofil
- Textarten und Formate
- Services für Verlage, Hochschulen, Unternehmen

- © GRIN Publishing GmbH.
- Alle Inhalte urheberrechtlich geschützt. Kopieren und verbreiten untersagt.
- info@grin.com
- AGB
- Open Publishing
Der GRIN Verlag hat sich seit 1998 auf die Veröffentlichung akademischer eBooks und Bücher spezialisiert. Der GRIN Verlag steht damit als erstes Unternehmen für User Generated Quality Content. Die Verlagsseiten GRIN.com, Hausarbeiten.de und Diplomarbeiten24 bieten für Hochschullehrer, Absolventen und Studenten die ideale Plattform, wissenschaftliche Texte wie Hausarbeiten, Referate, Bachelorarbeiten, Masterarbeiten, Diplomarbeiten, Dissertationen und wissenschaftliche Aufsätze einem breiten Publikum zu präsentieren.
Kostenfreie Veröffentlichung: Hausarbeit, Bachelorarbeit, Diplomarbeit, Dissertation, Masterarbeit, Interpretation oder Referat jetzt veröffentlichen!
- GRIN Verlag GmbH
-
- Nymphenburger Str. 86
- 80636
- Munich, Deutschland
- +49 89-550559-0
- +49 89-550559-10
- info@grin.com
-