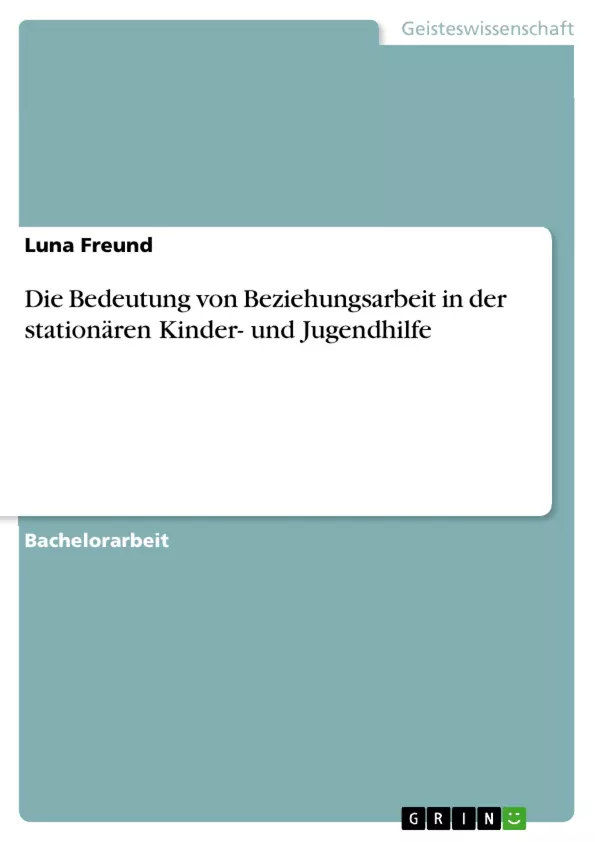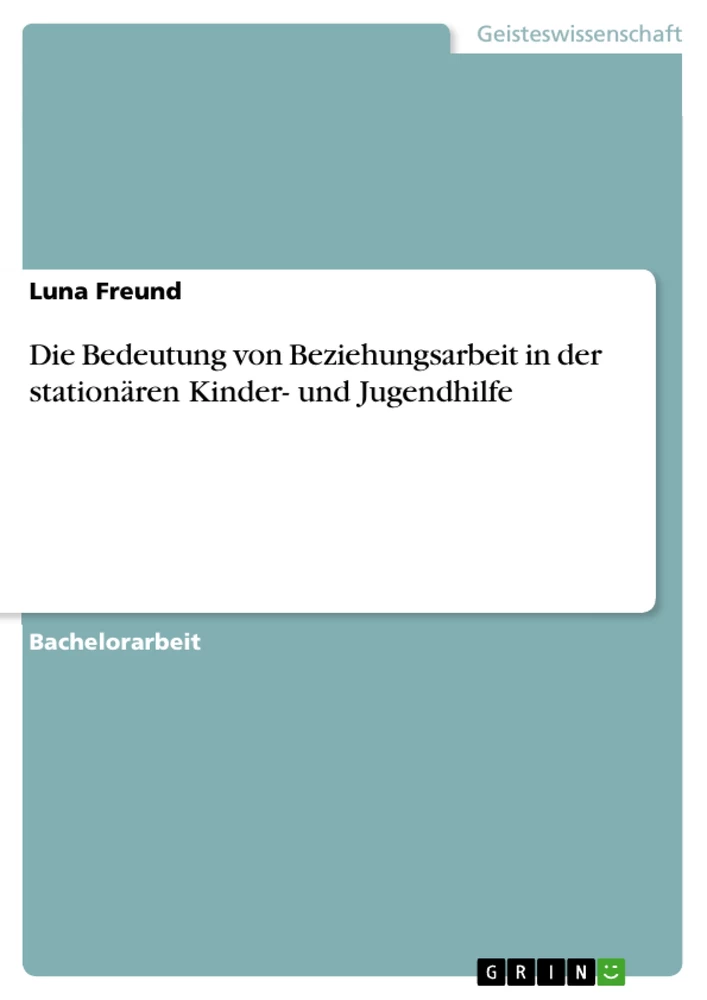
Die Bedeutung von Beziehungsarbeit in der stationären Kinder- und Jugendhilfe
Bachelorarbeit, 2017
64 Seiten, Note: 1,7
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einleitung
- 2 Stationäre Kinder- und Jugendhilfe
- 2.1 Historie der Heimerziehung
- 2.2 Entwicklung und Formen der Heimerziehung
- 2.3 Gründe für Fremdunterbringung
- 2.4 Ziele und Funktionen der Stationären Kinder- und Jugendhilfe
- 3 Die Bindungstheorie
- 3.1 Folgen von mangelnder Bindung
- 3.2 Bindungstheorie und Heimerziehung
- 4 Beziehungsarbeit in stationären der Kinder- und Jugendhilfe
- 4.1 Bezugserziehersystem
- 4.2 Elternarbeit
- 4.3 Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung
- 5 Fazit
- 6 Literaturrecherche – Erläuterung der Methode
- 7 Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Bachelorarbeit befasst sich mit der Bedeutung von Beziehungsarbeit in der stationären Kinder- und Jugendhilfe. Die Arbeit untersucht, wie der Verlust der Bindung zu den Eltern in der Heimerziehung ausgeglichen werden kann und welche Rolle Beziehungsarbeit in diesem Kontext spielt. Der Fokus liegt auf der Frage, wie intensiv die Beziehung zwischen Pädagogen und Kindern/Jugendlichen sein sollte und welche Methoden der Beziehungsarbeit in der Praxis Anwendung finden.
- Entwicklung und Formen der Heimerziehung
- Die Bindungstheorie und ihre Bedeutung für die Heimerziehung
- Beziehungsarbeit in der stationären Kinder- und Jugendhilfe
- Das Bezugserziehersystem und die intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung
- Elternarbeit als besondere Form der Beziehungsarbeit
Zusammenfassung der Kapitel
Kapitel 2 bietet einen umfassenden Überblick über die stationäre Kinder- und Jugendhilfe in Deutschland. Es werden die historische Entwicklung der Heimerziehung, die verschiedenen Formen der Fremdunterbringung, die Ziele und Funktionen der Heimerziehung sowie mögliche Gründe für die Fremdunterbringung beleuchtet.
Kapitel 3 widmet sich der Bindungstheorie, die von John Bowlby und Mary Ainsworth entwickelt wurde. Es werden die Bedeutung von Bindung sowie die Auswirkungen von einem Mangel an Bindung für die kindliche Entwicklung erörtert. Das Kapitel beleuchtet zudem, warum das Thema Bindung und Beziehung in der Heimerziehung von besonderer Bedeutung ist.
Kapitel 4 beschäftigt sich mit der praktischen Umsetzung von Beziehungsarbeit in der heutigen stationären Kinder- und Jugendhilfe. Es werden das Bezugserziehersystem, die intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung und die Elternarbeit als besondere Form der Beziehungsarbeit in Heimen vorgestellt.
Schlüsselwörter
Stationäre Kinder- und Jugendhilfe, Heimerziehung, Fremdunterbringung, Bindungstheorie, Beziehungsarbeit, Bezugserziehersystem, intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung, Elternarbeit.
Details
- Titel
- Die Bedeutung von Beziehungsarbeit in der stationären Kinder- und Jugendhilfe
- Hochschule
- Hochschule Magdeburg-Stendal; Standort Magdeburg
- Note
- 1,7
- Autor
- Luna Freund (Autor:in)
- Erscheinungsjahr
- 2017
- Seiten
- 64
- Katalognummer
- V378155
- ISBN (eBook)
- 9783668554177
- ISBN (Buch)
- 9783668554184
- Dateigröße
- 723 KB
- Sprache
- Deutsch
- Schlagworte
- Beziehungsarbeit Elternarbeit Kinder- und Jugendhilfe stationäre Kinder- und Jugendhilfe SGB VIII Bezugserziehersystem Heimerziehung Intensive Sozialpädagogische Einzelbetreuung Bindung Bindungstheorie John Bowlby Ainsworth Heimkampagne Heimreform Kinderheim Soziale Arbeit
- Produktsicherheit
- GRIN Publishing GmbH
- Preis (Ebook)
- US$ 31,99
- Preis (Book)
- US$ 45,99
- Arbeit zitieren
- Luna Freund (Autor:in), 2017, Die Bedeutung von Beziehungsarbeit in der stationären Kinder- und Jugendhilfe, München, Page::Imprint:: GRINVerlagOHG, https://www.diplomarbeiten24.de/document/378155
- Autor werden
- Ihre Optionen
- Vertriebskanäle
- Premium Services
- Autorenprofil
- Textarten und Formate
- Services für Verlage, Hochschulen, Unternehmen

- © GRIN Publishing GmbH.
- Alle Inhalte urheberrechtlich geschützt. Kopieren und verbreiten untersagt.
- info@grin.com
- AGB
- Open Publishing
Der GRIN Verlag hat sich seit 1998 auf die Veröffentlichung akademischer eBooks und Bücher spezialisiert. Der GRIN Verlag steht damit als erstes Unternehmen für User Generated Quality Content. Die Verlagsseiten GRIN.com, Hausarbeiten.de und Diplomarbeiten24 bieten für Hochschullehrer, Absolventen und Studenten die ideale Plattform, wissenschaftliche Texte wie Hausarbeiten, Referate, Bachelorarbeiten, Masterarbeiten, Diplomarbeiten, Dissertationen und wissenschaftliche Aufsätze einem breiten Publikum zu präsentieren.
Kostenfreie Veröffentlichung: Hausarbeit, Bachelorarbeit, Diplomarbeit, Dissertation, Masterarbeit, Interpretation oder Referat jetzt veröffentlichen!
- GRIN Verlag GmbH
-
- Nymphenburger Str. 86
- 80636
- Munich, Deutschland
- +49 89-550559-0
- +49 89-550559-10
- info@grin.com
-