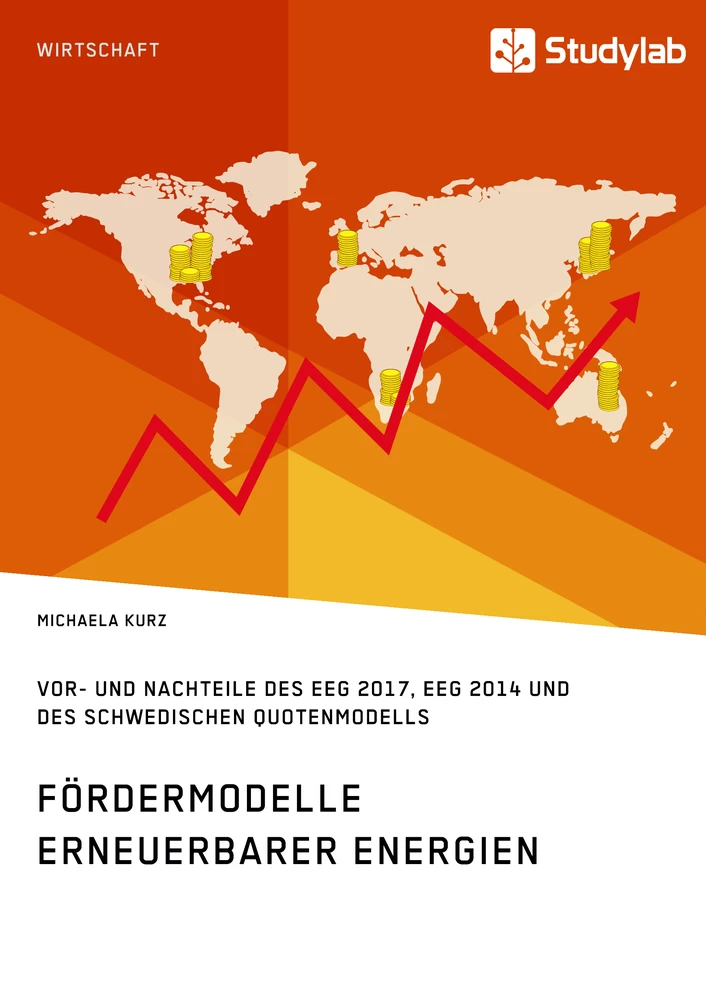
Fördermodelle Erneuerbarer Energien. Vor- und Nachteile des EEG 2017, EEG 2014 und des schwedischen Quotenmodells
Masterarbeit, 2017
129 Seiten, Note: 1,0
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einleitung und Untersuchungsgang
- 2 Grundlagen des Rechts der Erneuerbaren Energien
- 2.1 Der Begriff der Erneuerbaren Energien
- 2.2 Der Begriff der Erneuerbaren Energien im Sinne des EEG
- 2.3 Völkerrecht
- 2.4 Europäisches Gemeinschaftsrecht
- 2.5 Nationales Recht
- 2.6 Vom Stromeinspeisegesetz bis zum EEG 2014
- 3 Förderwürdigkeit der Erneuerbaren Energien
- 3.1 Förderungswürdigkeit
- 3.2 Rechtfertigung
- 4 Instrumente zur Förderung Erneuerbarer Energien
- 4.1 Preisbasierte Förderinstrumente
- 4.2 Mengenbasierte Förderinstrumente
- 5 Erfolgskriterien und Zieldimensionen von Förderinstrumenten
- 5.1 Allgemeine Erfolgskriterien
- 5.2 Instrumentenspezifische Erfolgskriterien
- 6 EEG 2014 - Festpreissystem
- 6.1 Gesetzeszweck und Ziele des EEG 2014
- 6.2 Grundsätze und Steuerungsinstrumente des EEG 2014
- 6.3 Anwendungsbereich, Förderungsgegenstand und Verpflichteter
- 6.4 Gesetzliches Schuldverhältnis
- 6.5 Finanzielle Förderung
- 6.6 Netzanschlusspflicht
- 6.7 Abnahme- und Übertragungspflicht
- 6.8 Ausgleichsmechanismus
- 6.9 Herkunftsnachweise
- 6.10 Streitbeilegung Clearingstelle § 81 EEG
- 6.11 Kontroll- und Sanktionsmechanismus
- 6.12 Zielerreichung
- 7 EEG 2017 - Das Ausschreibungssystem
- 7.1 Gesetzeszweck und Ziele des EEG 2017
- 7.2 Grundsätze und Steuerungsinstrumente des EEG 2017
- 7.3 Anwendungsbereich, Förderungsgegenstand und Verpflichteter
- 7.4 Gesetzliches Schuldverhältnis
- 7.5 Finanzielle Förderung
- 7.6 Netzanschlusspflicht
- 7.7 Abnahme- und Übertragungspflicht
- 7.8 Ausgleichsmechanismus
- 7.9 Herkunftsnachweise
- 7.10 Streitbeilegung Clearingstelle
- 7.11 Kontroll- und Sanktionsmechanismus
- 7.12 Zielerreichung
- 8 Das Quotenmodell Schwedens
- 8.1 Grundsätze des schwedischen Quotensystems
- 8.2 Zielerreichung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit untersucht verschiedene Fördermodelle für erneuerbare Energien, vergleicht deren Vor- und Nachteile und analysiert deren Effektivität. Der Fokus liegt auf dem Vergleich des deutschen EEG 2014 und 2017 mit dem schwedischen Quotenmodell.
- Rechtliche Grundlagen der Förderung erneuerbarer Energien
- Analyse verschiedener Förderinstrumente (preis- und mengenbasiert)
- Erfolgskriterien und Zieldimensionen von Förderinstrumenten
- Detaillierte Betrachtung des EEG 2014 und 2017
- Vergleich mit dem schwedischen Quotenmodell
Zusammenfassung der Kapitel
1 Einleitung und Untersuchungsgang: Dieses Kapitel führt in die Thematik der Fördermodelle für erneuerbare Energien ein und beschreibt den Aufbau und die Methodik der Arbeit. Es skizziert die Forschungsfrage und die zu untersuchenden Fördermodelle (EEG 2014, EEG 2017 und das schwedische Quotenmodell), um den Leser auf die darauffolgenden Kapitel vorzubereiten und die Zielsetzung der Arbeit zu verdeutlichen. Es wird die Notwendigkeit der Förderung erneuerbarer Energien im Kontext des Klimawandels und der Energiewende herausgestellt.
2 Grundlagen des Rechts der Erneuerbaren Energien: Dieses Kapitel legt die rechtlichen Grundlagen für die Förderung erneuerbarer Energien dar. Es definiert den Begriff "erneuerbare Energien" im Kontext des Völkerrechts, des europäischen Gemeinschaftsrechts und des deutschen nationalen Rechts. Es beleuchtet die historische Entwicklung der gesetzlichen Rahmenbedingungen von den Anfängen des Stromeinspeisegesetzes bis zum EEG 2014, um den Kontext der aktuellen Fördermodelle zu verstehen und die Entwicklung der rechtlichen Regulierung nachzuvollziehen. Die Kapitelteil beschreibt den Wandel der Rechtslage, die Herausforderungen und die Entwicklung der Rechtsprechung, um ein ganzheitliches Bild der Rechtslage zu vermitteln.
3 Förderwürdigkeit der Erneuerbaren Energien: Dieses Kapitel befasst sich mit der Frage der Rechtfertigung und Notwendigkeit staatlicher Förderungen für erneuerbare Energien. Es analysiert die Gründe für die Förderungswürdigkeit, die ökonomischen und ökologischen Vorteile und die Bedeutung der Energiewende. Das Kapitel diskutiert die Herausforderungen bei der Durchsetzung erneuerbarer Energien und die Notwendigkeit politischer Interventionen. Es beleuchtet die Problematik der externen Effekte und wie diese durch Fördermaßnahmen internalisiert werden können.
4 Instrumente zur Förderung Erneuerbarer Energien: In diesem Kapitel werden verschiedene Instrumente zur Förderung erneuerbarer Energien vorgestellt und verglichen. Es differenziert zwischen preis- und mengenbasierten Förderinstrumenten, analysiert deren jeweilige Vor- und Nachteile und diskutiert ihre Anwendbarkeit in unterschiedlichen Kontexten. Das Kapitel legt einen Schwerpunkt auf die Wirkungsweise der Instrumente und die Auswirkungen auf den Markt für erneuerbare Energien, sowie die Herausforderungen, die mit der Implementierung dieser Förderinstrumente verbunden sind.
5 Erfolgskriterien und Zieldimensionen von Förderinstrumenten: Das Kapitel definiert allgemeine und instrumentenspezifische Erfolgskriterien für die Bewertung der Fördermodelle. Es analysiert die relevanten Zieldimensionen, wie z.B. der Ausbau erneuerbarer Energien, die Senkung der CO2-Emissionen und die Wirtschaftlichkeit der Förderprogramme. Es wird erläutert, wie die Wirksamkeit der Fördermaßnahmen gemessen werden kann und welche Indikatoren dafür relevant sind. Die Analyse der Erfolgskriterien legt den Grundstein für die Bewertung der im Folgenden untersuchten Fördermodelle.
6 EEG 2014 - Festpreissystem: Dieses Kapitel beschreibt detailliert das deutsche Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) 2014 mit seinem Festpreissystem. Es erläutert die Gesetzesziele, die Grundsätze und Steuerungsinstrumente, den Anwendungsbereich und die finanziellen Fördermechanismen. Die Analyse umfasst die Netzanschlusspflicht, die Abnahme- und Übertragungspflicht, den Ausgleichsmechanismus, die Streitbeilegung und den Kontrollmechanismus. Der Schwerpunkt liegt auf der Funktionsweise des Systems und der Zielerreichung im Kontext des Ausbaus erneuerbarer Energien.
7 EEG 2017 - Das Ausschreibungssystem: Ähnlich wie Kapitel 6, beschreibt dieses Kapitel das EEG 2017 mit seinem Ausschreibungssystem. Es beleuchtet die Änderungen gegenüber dem EEG 2014 und analysiert die Auswirkungen des neuen Systems auf den Markt für erneuerbare Energien. Die Analyse umfasst die Gesetzesziele, die Grundsätze und Steuerungsinstrumente, den Anwendungsbereich und die finanziellen Fördermechanismen. Die Funktionsweise des Ausschreibungssystems wird im Detail erklärt, einschließlich der Netzanschlusspflicht, der Abnahme- und Übertragungspflicht, des Ausgleichsmechanismus und des Kontrollmechanismus. Die Zielerreichung des EEG 2017 wird im Kontext des Ausbaus erneuerbarer Energien analysiert.
8 Das Quotenmodell Schwedens: Dieses Kapitel stellt das schwedische Quotenmodell für erneuerbare Energien vor. Es beschreibt die Grundsätze des Systems und analysiert dessen Zielerreichung im Vergleich zu den deutschen EEG-Modellen. Der Fokus liegt auf den Unterschieden und Gemeinsamkeiten der verschiedenen Systeme, um deren jeweilige Stärken und Schwächen herauszuarbeiten. Der Vergleich ermöglicht eine umfassende Bewertung der unterschiedlichen Ansätze zur Förderung erneuerbarer Energien.
Schlüsselwörter
Erneuerbare Energien, EEG 2014, EEG 2017, Quotenmodell, Schweden, Fördermodelle, Preisbasierte Förderung, Mengenbasierte Förderung, Energiewende, Rechtliche Rahmenbedingungen, Erfolgskriterien, Zielerreichung, Ausbau erneuerbarer Energien.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zum Dokument: Fördermodelle für Erneuerbare Energien
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Die Arbeit untersucht verschiedene Fördermodelle für erneuerbare Energien, vergleicht deren Vor- und Nachteile und analysiert deren Effektivität. Der Fokus liegt auf dem Vergleich des deutschen EEG 2014 und 2017 mit dem schwedischen Quotenmodell.
Welche Themen werden im Detail behandelt?
Die Arbeit behandelt die rechtlichen Grundlagen der Förderung erneuerbarer Energien, analysiert verschiedene Förderinstrumente (preis- und mengenbasiert), untersucht Erfolgskriterien und Zieldimensionen von Förderinstrumenten, betrachtet detailliert das EEG 2014 und 2017 und vergleicht diese mit dem schwedischen Quotenmodell.
Welche Fördermodelle werden verglichen?
Es werden das deutsche Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) 2014 und 2017 sowie das schwedische Quotenmodell verglichen.
Wie ist das EEG 2014 aufgebaut?
Das EEG 2014 basiert auf einem Festpreissystem. Die Arbeit beschreibt detailliert die Gesetzesziele, Grundsätze und Steuerungsinstrumente, den Anwendungsbereich und die finanziellen Fördermechanismen. Die Analyse umfasst die Netzanschlusspflicht, die Abnahme- und Übertragungspflicht, den Ausgleichsmechanismus, die Streitbeilegung und den Kontrollmechanismus.
Was sind die Unterschiede zwischen dem EEG 2014 und dem EEG 2017?
Das EEG 2017 führt ein Ausschreibungssystem ein. Die Arbeit beleuchtet die Änderungen gegenüber dem EEG 2014 und analysiert die Auswirkungen des neuen Systems auf den Markt für erneuerbare Energien. Ähnlich wie beim EEG 2014 werden die Gesetzesziele, Grundsätze und Steuerungsinstrumente, der Anwendungsbereich und die finanziellen Fördermechanismen analysiert.
Wie funktioniert das schwedische Quotenmodell?
Die Arbeit beschreibt die Grundsätze des schwedischen Quotenmodells für erneuerbare Energien und analysiert dessen Zielerreichung im Vergleich zu den deutschen EEG-Modellen. Der Fokus liegt auf den Unterschieden und Gemeinsamkeiten der verschiedenen Systeme.
Welche Arten von Förderinstrumenten werden unterschieden?
Die Arbeit unterscheidet zwischen preisbasierten und mengenbasierten Förderinstrumenten und analysiert deren jeweilige Vor- und Nachteile.
Wie werden die Erfolgskriterien der Fördermodelle bewertet?
Die Arbeit definiert allgemeine und instrumentenspezifische Erfolgskriterien für die Bewertung der Fördermodelle und analysiert relevante Zieldimensionen wie den Ausbau erneuerbarer Energien, die Senkung der CO2-Emissionen und die Wirtschaftlichkeit der Förderprogramme.
Welche rechtlichen Grundlagen werden behandelt?
Die Arbeit legt die rechtlichen Grundlagen für die Förderung erneuerbarer Energien dar, definiert den Begriff "erneuerbare Energien" im Kontext des Völkerrechts, des europäischen Gemeinschaftsrechts und des deutschen nationalen Rechts und beleuchtet die historische Entwicklung der gesetzlichen Rahmenbedingungen.
Welche Schlussfolgerungen zieht die Arbeit?
Die Arbeit zieht Schlussfolgerungen aus dem Vergleich der verschiedenen Fördermodelle, bewertet deren Effektivität und gibt möglicherweise Empfehlungen für zukünftige Förderpolitik. (Die konkreten Schlussfolgerungen sind im Dokument selbst nachzulesen).
Details
- Titel
- Fördermodelle Erneuerbarer Energien. Vor- und Nachteile des EEG 2017, EEG 2014 und des schwedischen Quotenmodells
- Hochschule
- Carl von Ossietzky Universität Oldenburg (Wirtschafts- und Rechtswissenschaften)
- Note
- 1,0
- Autor
- Michaela Kurz (Autor:in)
- Erscheinungsjahr
- 2017
- Seiten
- 129
- Katalognummer
- V379116
- ISBN (eBook)
- 9783668583962
- ISBN (Buch)
- 9783960951438
- Dateigröße
- 1827 KB
- Sprache
- Deutsch
- Schlagworte
- EEG 2017 Fördermodelle Ausschreibungsmodel Erneuerbare Energien Förderinstrumente Einspeisevergütung Versorgungssicherheit
- Produktsicherheit
- GRIN Publishing GmbH
- Preis (Ebook)
- US$ 38,99
- Preis (Book)
- US$ 49,99
- Arbeit zitieren
- Michaela Kurz (Autor:in), 2017, Fördermodelle Erneuerbarer Energien. Vor- und Nachteile des EEG 2017, EEG 2014 und des schwedischen Quotenmodells, München, Page::Imprint:: GRINVerlagOHG, https://www.diplomarbeiten24.de/document/379116
- Autor werden
- Ihre Optionen
- Vertriebskanäle
- Premium Services
- Autorenprofil
- Textarten und Formate
- Services für Verlage, Hochschulen, Unternehmen

- © GRIN Publishing GmbH.
- Alle Inhalte urheberrechtlich geschützt. Kopieren und verbreiten untersagt.
- info@grin.com
- AGB
- Open Publishing
Der GRIN Verlag hat sich seit 1998 auf die Veröffentlichung akademischer eBooks und Bücher spezialisiert. Der GRIN Verlag steht damit als erstes Unternehmen für User Generated Quality Content. Die Verlagsseiten GRIN.com, Hausarbeiten.de und Diplomarbeiten24 bieten für Hochschullehrer, Absolventen und Studenten die ideale Plattform, wissenschaftliche Texte wie Hausarbeiten, Referate, Bachelorarbeiten, Masterarbeiten, Diplomarbeiten, Dissertationen und wissenschaftliche Aufsätze einem breiten Publikum zu präsentieren.
Kostenfreie Veröffentlichung: Hausarbeit, Bachelorarbeit, Diplomarbeit, Dissertation, Masterarbeit, Interpretation oder Referat jetzt veröffentlichen!
- GRIN Verlag GmbH
-
- Nymphenburger Str. 86
- 80636
- Munich, Deutschland
- +49 89-550559-0
- +49 89-550559-10
- info@grin.com
-









