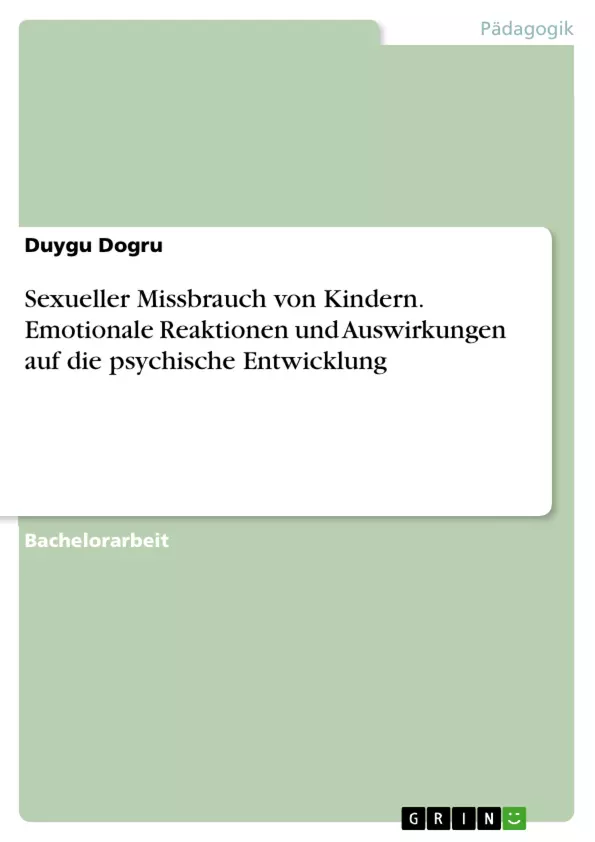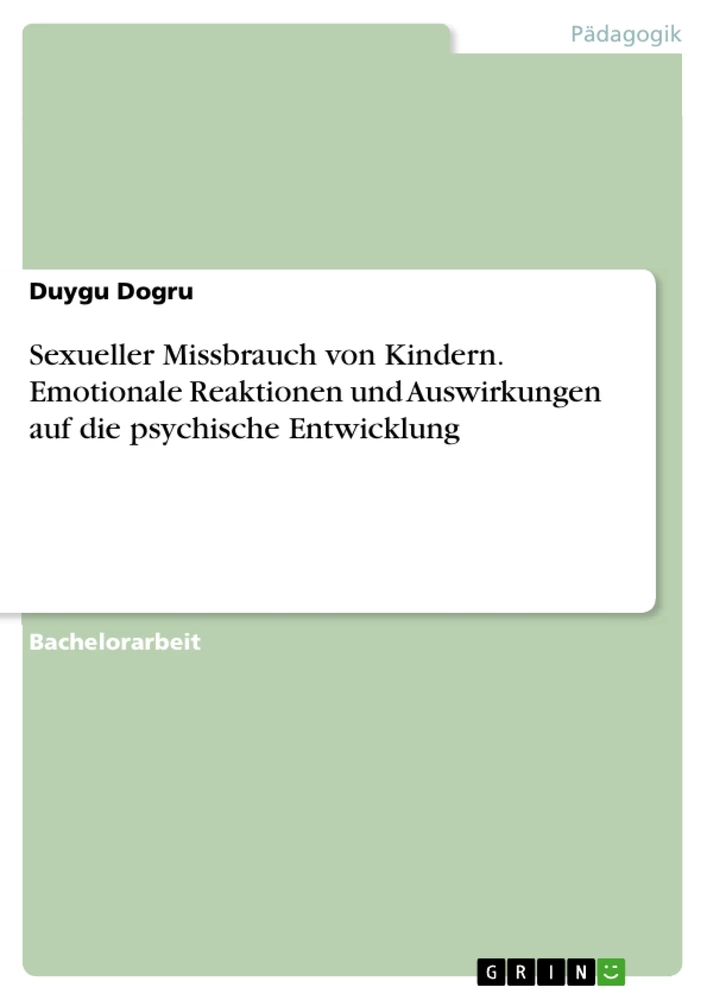
Sexueller Missbrauch von Kindern. Emotionale Reaktionen und Auswirkungen auf die psychische Entwicklung
Bachelorarbeit, 2017
58 Seiten, Note: 2,0
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
- Abstract...
- Tabellenverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Begriffsverständnis von sexuellem Kindesmissbrauch
- 2.1 Begriffliche Abgrenzung
- 2.2 Begriffserklärung
- 2.3 Formen sexueller Missbrauchshandlungen
- 3. Ausmaß, Häufigkeit und Dauer des sexuellen Kindesmissbrauchs
- 4. Opfer-Täter-Dynamik
- 4.1 Die Täter und Täterinnen
- 4.2 Das Vorgehen der Täter und Täterinnen und ihre Opfer
- 5. Fragestellung
- 6. Methode
- 7. Mögliche Auswirkungen des sexuellen Kindesmissbrauchs
- 7.1 Traumabelastungsstörungen
- 7.2 Emotionale und weitere intrapsychische Reaktionen
- 7.2.1 Schamgefühle
- 7.2.2 Schuldgefühle
- 7.2.3 Angst
- 7.2.4 Vertrauensverlust
- 7.2.5 Sprachlosigkeit
- 7.2.6 Ohnmacht
- 7.3 Auffälligkeiten im Sozialverhalten
- 7.4 Sexualverhalten
- 7.5 Psychosomatische Beschwerden
- 8. Diskussion
- Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit befasst sich mit den Auswirkungen sexuellen Missbrauchs von Kindern auf deren psychische Entwicklung. Im Fokus steht die Darlegung des aktuellen Forschungsstands basierend auf einer umfassenden Literaturrecherche.
- Begriffliche Klärung des sexuellen Kindesmissbrauchs
- Analyse der Opfer-Täter-Dynamik
- Untersuchung der Auswirkungen sexuellen Missbrauchs auf die psychische Entwicklung von Kindern
- Darstellung der möglichen Folgen für das Sozial- und Sexualverhalten
- Einbezug psychosomatischer Beschwerden als potenzielle Folgeerscheinungen
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in das Thema sexueller Missbrauch ein und verdeutlicht die Bedeutung der Thematik. Im Anschluss erfolgt eine detaillierte Begriffsklärung und Abgrenzung des Begriffs „sexueller Kindesmissbrauch“. Kapitel 3 beleuchtet das Ausmaß, die Häufigkeit und Dauer des sexuellen Kindesmissbrauchs. Die Opfer-Täter-Dynamik wird im nächsten Kapitel untersucht, wobei sowohl das Vorgehen der Täter als auch die verschiedenen Opfergruppen betrachtet werden. Das sechste Kapitel beschäftigt sich mit den möglichen Auswirkungen des sexuellen Kindesmissbrauchs auf die psychische Entwicklung von Kindern. Hierbei werden insbesondere Traumabelastungsstörungen, emotionale Reaktionen und Auffälligkeiten im Sozial- und Sexualverhalten sowie psychosomatische Beschwerden thematisiert.
Schlüsselwörter
Die vorliegende Arbeit befasst sich mit dem Thema sexueller Missbrauch im Kindesalter. Dabei werden wichtige Aspekte wie die psychischen Beeinträchtigungen und Erkrankungen von Opfern des sexuellen Missbrauchs beleuchtet.
Details
- Titel
- Sexueller Missbrauch von Kindern. Emotionale Reaktionen und Auswirkungen auf die psychische Entwicklung
- Hochschule
- Pädagogische Hochschule in Schwäbisch Gmünd
- Note
- 2,0
- Autor
- Duygu Dogru (Autor:in)
- Erscheinungsjahr
- 2017
- Seiten
- 58
- Katalognummer
- V379230
- ISBN (eBook)
- 9783668578609
- ISBN (Buch)
- 9783668578616
- Dateigröße
- 880 KB
- Sprache
- Deutsch
- Anmerkungen
- Mein besonderer Preiswunsch ist 25 €
- Schlagworte
- sexueller missbrauch kindern emotionale reaktionen auswirkungen entwicklung
- Produktsicherheit
- GRIN Publishing GmbH
- Preis (Ebook)
- US$ 17,99
- Preis (Book)
- US$ 26,99
- Arbeit zitieren
- Duygu Dogru (Autor:in), 2017, Sexueller Missbrauch von Kindern. Emotionale Reaktionen und Auswirkungen auf die psychische Entwicklung, München, Page::Imprint:: GRINVerlagOHG, https://www.diplomarbeiten24.de/document/379230
- Autor werden
- Ihre Optionen
- Vertriebskanäle
- Premium Services
- Autorenprofil
- Textarten und Formate
- Services für Verlage, Hochschulen, Unternehmen

- © GRIN Publishing GmbH.
- Alle Inhalte urheberrechtlich geschützt. Kopieren und verbreiten untersagt.
- info@grin.com
- AGB
- Open Publishing
Der GRIN Verlag hat sich seit 1998 auf die Veröffentlichung akademischer eBooks und Bücher spezialisiert. Der GRIN Verlag steht damit als erstes Unternehmen für User Generated Quality Content. Die Verlagsseiten GRIN.com, Hausarbeiten.de und Diplomarbeiten24 bieten für Hochschullehrer, Absolventen und Studenten die ideale Plattform, wissenschaftliche Texte wie Hausarbeiten, Referate, Bachelorarbeiten, Masterarbeiten, Diplomarbeiten, Dissertationen und wissenschaftliche Aufsätze einem breiten Publikum zu präsentieren.
Kostenfreie Veröffentlichung: Hausarbeit, Bachelorarbeit, Diplomarbeit, Dissertation, Masterarbeit, Interpretation oder Referat jetzt veröffentlichen!
- GRIN Verlag GmbH
-
- Nymphenburger Str. 86
- 80636
- Munich, Deutschland
- +49 89-550559-0
- +49 89-550559-10
- info@grin.com
-