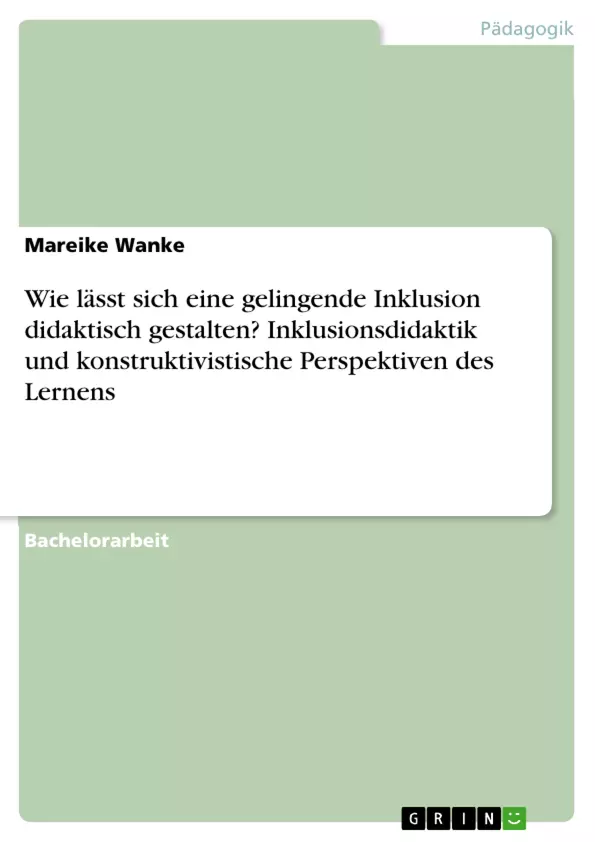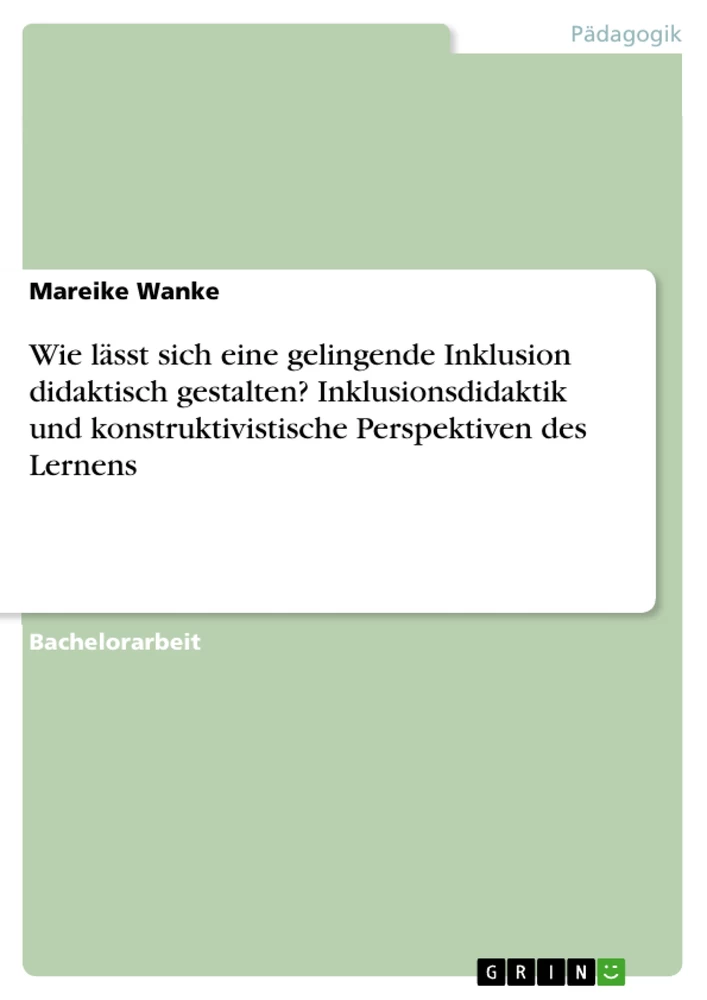
Wie lässt sich eine gelingende Inklusion didaktisch gestalten? Inklusionsdidaktik und konstruktivistische Perspektiven des Lernens
Bachelorarbeit, 2011
54 Seiten, Note: 1,0
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Inklusion
- Begrifflichkeit
- Exkurs: „Die Schule für alle“ – eine neue Idee?
- Integration versus oder gleich Inklusion?
- Macht die Verwendung der Begrifflichkeit Inklusion Sinn?
- Exkurs: Ist Inklusion zu exklusiv?!
- Forderungen der Inklusionsbewegung
- Exkurs: Inklusive Schule = Inklusive Gesellschaft?
- Welchen Handlungsbedarf gibt es speziell in Deutschland?
- ,,Inklusionsdidaktik“
- Was ist Didaktik?
- Konstruktivistische Perspektive auf das Lernen
- Lernen ist aktiv.
- Lernen ist selbstgesteuert.
- Lernen ist nicht Vermittlung.
- Lernen ist ein konstruktiver Prozess
- Lernen ist ein situativer Prozess.
- Lernen ist ein sozialer Prozess
- Welche Lehrerrolle „braucht“ das konstruktivistische Lernen?
- Didaktik der Perspektivenvielfalt bzw. Mehrperspektivität
- Welche Möglichkeiten bietet die Didaktik der Perspektivenvielfalt?
- Didaktik des Offenen Unterrichts
- Welche Möglichkeiten bietet die Didaktik des Offenen Unterrichts?
- Exkurs: Was ist das Ziel des Gesellschaftsauftrages der Schule?
- Die \"richtige\" Didaktik für Inklusion?!
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit dem Konzept der Inklusion im Bildungssystem, insbesondere der Frage, welche Didaktik für eine gelingende Inklusion geeignet ist. Der Fokus liegt auf der Definition von Inklusion, der Abgrenzung von Integration und den Forderungen der Inklusionsbewegung. Die Arbeit analysiert verschiedene didaktische Ansätze, insbesondere den konstruktivistischen Ansatz, die Didaktik der Perspektivenvielfalt und die Didaktik des Offenen Unterrichts. Sie befasst sich mit den Anforderungen an eine Inklusionsdidaktik und der Frage, ob diese tatsächlich existiert.
- Definition und Abgrenzung von Inklusion und Integration
- Forderungen der Inklusionsbewegung
- Analyse konstruktivistischer Lerntheorien
- Bewertung der Didaktik der Perspektivenvielfalt und des Offenen Unterrichts
- Anforderungen und Möglichkeiten einer Inklusionsdidaktik
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt die zentrale Fragestellung der Arbeit vor: welche Didaktik ist geeignet für die Lehrer der „Generation Inklusion“? Kapitel zwei definiert den Begriff Inklusion und stellt ihn der Integration gegenüber. Es werden die Forderungen der Inklusionsbewegung diskutiert und der Handlungsbedarf in Deutschland beleuchtet. Kapitel drei beleuchtet die Definition und Grundprinzipien der Didaktik sowie die konstruktivistische Lerntheorie. Kapitel drei behandelt die Didaktik der Perspektivenvielfalt und des Offenen Unterrichts, sowie die damit verbundenen Möglichkeiten für inklusiven Unterricht.
Schlüsselwörter
Die Arbeit fokussiert auf die Themen Inklusion, Integration, Didaktik, konstruktivistisches Lernen, Perspektivenvielfalt, Offener Unterricht und die Anforderungen an eine Inklusionsdidaktik. Es werden die Forderungen der Inklusionsbewegung und die Herausforderungen der Inklusion in der deutschen Schullandschaft beleuchtet.
Häufig gestellte Fragen
Was ist der Unterschied zwischen Integration und Inklusion?
Integration zielt darauf ab, Menschen mit Behinderungen in ein bestehendes System einzugegliedern. Inklusion fordert, dass das System von vornherein so gestaltet ist, dass alle Individuen gleichermaßen teilhaben können.
Wie sieht Lernen aus konstruktivistischer Sicht aus?
Lernen wird als aktiver, selbstgesteuerter und sozialer Prozess verstanden. Wissen wird nicht einfach übertragen, sondern vom Lernenden individuell konstruiert.
Welche Didaktik eignet sich für inklusiven Unterricht?
Besonders geeignet sind die Didaktik des Offenen Unterrichts und die Didaktik der Perspektivenvielfalt, da sie individuelles Tempo und unterschiedliche Sichtweisen fördern.
Welche Rolle hat der Lehrer in der Inklusionsdidaktik?
Der Lehrer agiert weniger als Wissensvermittler, sondern eher als Lernbegleiter, Berater und Gestalter von Lernumgebungen.
Ist Inklusion eine neue Idee?
Die Idee der „Schule für alle“ hat historische Vorläufer, wurde aber durch moderne Inklusionsbewegungen und völkerrechtliche Vorgaben neu belebt und politisch forciert.
Details
- Titel
- Wie lässt sich eine gelingende Inklusion didaktisch gestalten? Inklusionsdidaktik und konstruktivistische Perspektiven des Lernens
- Hochschule
- Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover (Institut für Sachunterricht und Inklusive Didaktik)
- Note
- 1,0
- Autor
- Mareike Wanke (Autor:in)
- Erscheinungsjahr
- 2011
- Seiten
- 54
- Katalognummer
- V379768
- ISBN (eBook)
- 9783668582866
- ISBN (Buch)
- 9783668582873
- Dateigröße
- 567 KB
- Sprache
- Deutsch
- Schlagworte
- Inklusion Didaktik Lebensweltorientierung Mehrperspektivität
- Produktsicherheit
- GRIN Publishing GmbH
- Preis (Ebook)
- US$ 20,99
- Preis (Book)
- US$ 29,99
- Arbeit zitieren
- Mareike Wanke (Autor:in), 2011, Wie lässt sich eine gelingende Inklusion didaktisch gestalten? Inklusionsdidaktik und konstruktivistische Perspektiven des Lernens, München, Page::Imprint:: GRINVerlagOHG, https://www.diplomarbeiten24.de/document/379768
- Autor werden
- Ihre Optionen
- Vertriebskanäle
- Premium Services
- Autorenprofil
- Textarten und Formate
- Services für Verlage, Hochschulen, Unternehmen

- © GRIN Publishing GmbH.
- Alle Inhalte urheberrechtlich geschützt. Kopieren und verbreiten untersagt.
- info@grin.com
- AGB
- Open Publishing
Der GRIN Verlag hat sich seit 1998 auf die Veröffentlichung akademischer eBooks und Bücher spezialisiert. Der GRIN Verlag steht damit als erstes Unternehmen für User Generated Quality Content. Die Verlagsseiten GRIN.com, Hausarbeiten.de und Diplomarbeiten24 bieten für Hochschullehrer, Absolventen und Studenten die ideale Plattform, wissenschaftliche Texte wie Hausarbeiten, Referate, Bachelorarbeiten, Masterarbeiten, Diplomarbeiten, Dissertationen und wissenschaftliche Aufsätze einem breiten Publikum zu präsentieren.
Kostenfreie Veröffentlichung: Hausarbeit, Bachelorarbeit, Diplomarbeit, Dissertation, Masterarbeit, Interpretation oder Referat jetzt veröffentlichen!
- GRIN Verlag GmbH
-
- Nymphenburger Str. 86
- 80636
- Munich, Deutschland
- +49 89-550559-0
- +49 89-550559-10
- info@grin.com
-