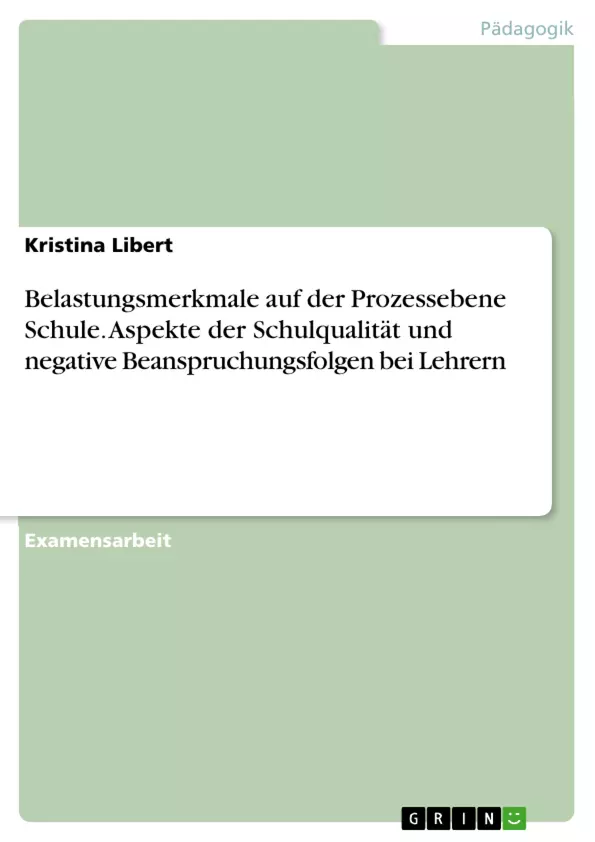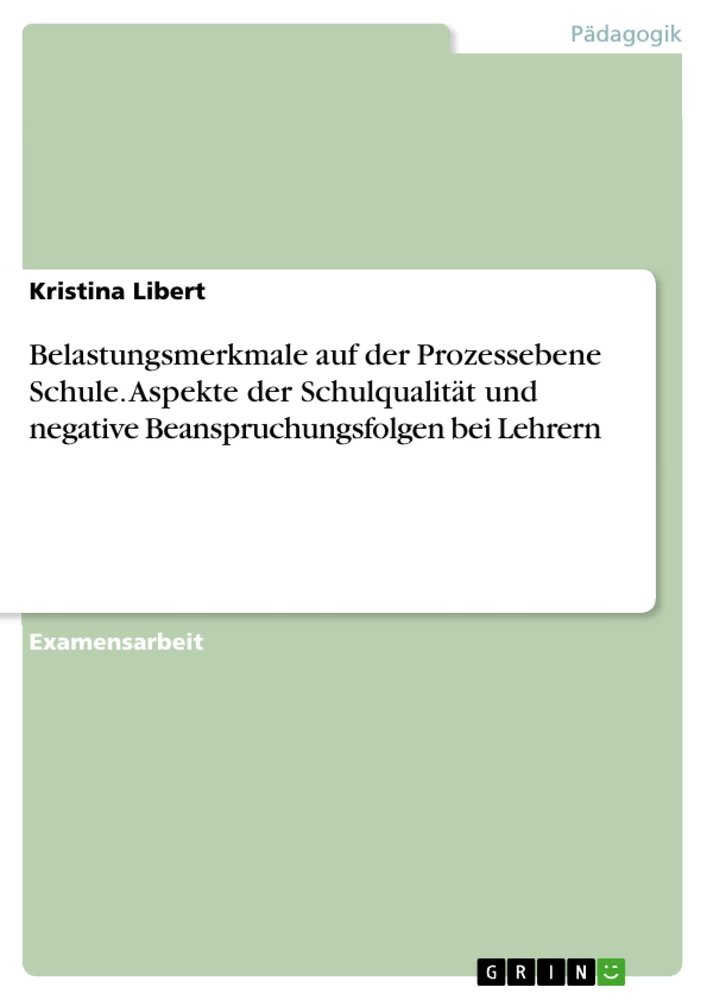
Belastungsmerkmale auf der Prozessebene Schule. Aspekte der Schulqualität und negative Beanspruchungsfolgen bei Lehrern
Examensarbeit, 2013
76 Seiten, Note: 1,0
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einleitung und Übersicht
- 1.1 Problemaufriss
- 1.2 Aufbau der Arbeit
- 2 Theoretische Grundlagen zur Belastung
- 2.1 Der Belastungsbegriff in Abgrenzung zu Beanspruchung, Stress und Anforderungen
- 2.2 Aktuelle Belastungsmodelle
- 2.2.1 Das Belastungs-Beanspruchungsmodell nach Rudow
- 2.2.2 Das transaktionale Stressmodell nach Lazarus
- 2.3 Belastung und Gesundheit: Gesundheitliche Beeinträchtigungen als Reaktion von Belastungen im Lehrerberuf
- 3 Zur speziellen Belastungssituation bei Lehrer und Lehrerinnen
- 3.1 Anforderungen und Erwartungen im Lehrerberuf
- 3.2 Empirische Studien zur Belastung von Lehrer und Lehrerinnen
- 3.2.1 Überblick über die Lehrerbelastungsforschung
- 3.2.2 Aktuellste Befunde: Ergebnisse der Potsdamer Lehrerstudie
- 3.2.3 Forschungsdefizite: Betrachtung der Schulebene in der Lehrerbelastungsforschung
- 4 Belastungsmerkmale auf der Prozessebene Schule
- 4.1 Das Schulqualitätsmodell von Ditton als Analysemodell zur Eingrenzung von Belastungsfaktoren
- 4.2 Belastungsmerkmale und Schulkultur
- 4.3 Kooperationen auf der Schulebene und Belastungen
- 4.3.1 Kooperation mit Partnern außerhalb der Schule
- 4.3.2 Kooperation und Interaktion im Kollegium als Belastungsfaktor
- 4.4 Belastungsmerkmale und Schulmanagement: Die Rolle der Schulleitung als Belastungsfaktor
- 4.4.1 Der Forschungsstand zur Schulleitung als Belastung
- 4.4.2 Zum Einfluss von Führung auf das Belastungserleben der Lehrkräfte
- 4.5 Personalpolitik und Personalentwicklungen im Kontext von Belastungen
- 5 Eigene Untersuchung: qualitative Lehrerstudie zur Belastung von Lehrpersonen auf der Schulebene in Hauptschulen
- 5.1 Durchführung und Methode der eigenen Untersuchung
- 5.2 Analyse der Interviewdaten
- 5.2.1 Fallschule A
- 5.2.3 Fallschule B
- 5.3 Diskussion der Ergebnisse
- 6 Ausblick und Implikationen
- 6.1 Implikationen für die Kooperation im Kollegium
- 6.2 Implikationen für Schulleitungshandeln
- 6.3 Implikationen für Forschung
- 6.4 Implikationen für Lehrernachwuchs
- 6.5 Implikationen für Schulentwicklung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit analysiert die Belastungen von Lehrpersonen auf der Prozessebene der Schule, um das Belastungsempfinden der Lehrkräfte besser zu verstehen. Dabei wird untersucht, welche Bedingungen auf der Schulebene zu erhöhten Belastungen führen. Die Arbeit konzentriert sich dabei auf soziale Beziehungen und Konflikte auf der Schulebene und will ein realistisches Bild der beruflichen Tätigkeiten und Anforderungen der Lehrpersonen vermitteln.
- Belastungsfaktoren auf der Prozessebene der Schule
- Die Rolle von Schulkultur und Kooperationen in der Lehrerbelastung
- Der Einfluss von Schulmanagement und Schulleitung auf das Belastungserleben der Lehrkräfte
- Personalpolitik und Personalentwicklung im Kontext von Belastungen
- Qualitative Untersuchung zur Lehrerbelastung in Hauptschulen
Zusammenfassung der Kapitel
Die Arbeit beginnt mit einer Einführung in das Thema Lehrerbelastung und der Abgrenzung von Begriffen wie Beanspruchung, Stress und Anforderungen. Es werden zwei gängige Belastungsmodelle vorgestellt, die die Entstehung und Wirkung von Belastungen erklären. Anschließend werden die gesundheitlichen Folgen von Belastungen im Lehrerberuf näher betrachtet.
Kapitel 3 widmet sich der speziellen Belastungssituation von Lehrpersonen. Es werden die vielfältigen Anforderungen des Lehrerberufs aufgezeigt und der aktuelle Forschungsstand zur Lehrerbelastung präsentiert, wobei die Ergebnisse der Potsdamer Lehrerstudie im Vordergrund stehen.
Kapitel 4 untersucht die Belastungsmerkmale auf der Prozessebene der Schule. Dabei wird das Schulqualitätsmodell von Ditton als Grundlage zur Eingrenzung der Belastungsfaktoren genutzt. Die einzelnen Belastungsmerkmale werden im Zusammenhang mit Schulkultur, Kooperationen auf der Schulebene und Schulmanagement analysiert.
Kapitel 5 präsentiert eine eigene qualitative Untersuchung zur Belastung von Lehrpersonen auf der Schulebene in Hauptschulen. Die Ergebnisse dieser Untersuchung werden im Vergleich zu den bereits bestehenden empirischen Befunden diskutiert.
Schlüsselwörter
Lehrerbelastung, Schulebene, Schulkultur, Kooperation, Schulmanagement, Schulleitung, Personalpolitik, Personalentwicklung, qualitative Forschung, Hauptschule, empirische Forschung
Details
- Titel
- Belastungsmerkmale auf der Prozessebene Schule. Aspekte der Schulqualität und negative Beanspruchungsfolgen bei Lehrern
- Hochschule
- Universität Paderborn
- Note
- 1,0
- Autor
- Kristina Libert (Autor:in)
- Erscheinungsjahr
- 2013
- Seiten
- 76
- Katalognummer
- V380702
- ISBN (eBook)
- 9783668584587
- ISBN (Buch)
- 9783668584594
- Dateigröße
- 1376 KB
- Sprache
- Deutsch
- Anmerkungen
- Diese Examensarbeit erhielt von der Universität Paderborn einen Preis und wurde als besonders gelungene Abschlussarbeit ausgezeichnet.
- Schlagworte
- Lehrerbelastung Lehrergesundheit Fallstudie
- Produktsicherheit
- GRIN Publishing GmbH
- Preis (Ebook)
- US$ 31,99
- Preis (Book)
- US$ 51,99
- Arbeit zitieren
- Kristina Libert (Autor:in), 2013, Belastungsmerkmale auf der Prozessebene Schule. Aspekte der Schulqualität und negative Beanspruchungsfolgen bei Lehrern, München, Page::Imprint:: GRINVerlagOHG, https://www.diplomarbeiten24.de/document/380702
- Autor werden
- Ihre Optionen
- Vertriebskanäle
- Premium Services
- Autorenprofil
- Textarten und Formate
- Services für Verlage, Hochschulen, Unternehmen

- © GRIN Publishing GmbH.
- Alle Inhalte urheberrechtlich geschützt. Kopieren und verbreiten untersagt.
- info@grin.com
- AGB
- Open Publishing
Der GRIN Verlag hat sich seit 1998 auf die Veröffentlichung akademischer eBooks und Bücher spezialisiert. Der GRIN Verlag steht damit als erstes Unternehmen für User Generated Quality Content. Die Verlagsseiten GRIN.com, Hausarbeiten.de und Diplomarbeiten24 bieten für Hochschullehrer, Absolventen und Studenten die ideale Plattform, wissenschaftliche Texte wie Hausarbeiten, Referate, Bachelorarbeiten, Masterarbeiten, Diplomarbeiten, Dissertationen und wissenschaftliche Aufsätze einem breiten Publikum zu präsentieren.
Kostenfreie Veröffentlichung: Hausarbeit, Bachelorarbeit, Diplomarbeit, Dissertation, Masterarbeit, Interpretation oder Referat jetzt veröffentlichen!
- GRIN Verlag GmbH
-
- Nymphenburger Str. 86
- 80636
- Munich, Deutschland
- +49 89-550559-0
- +49 89-550559-10
- info@grin.com
-