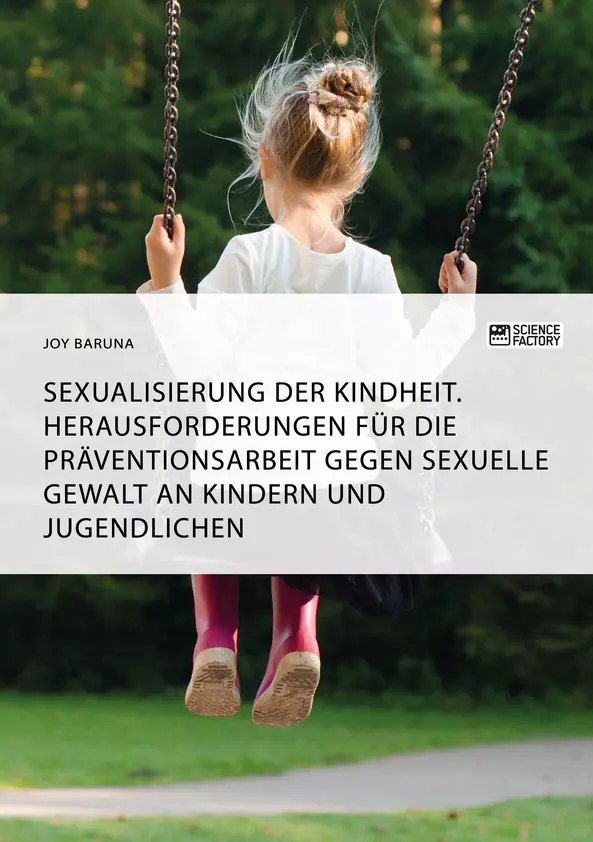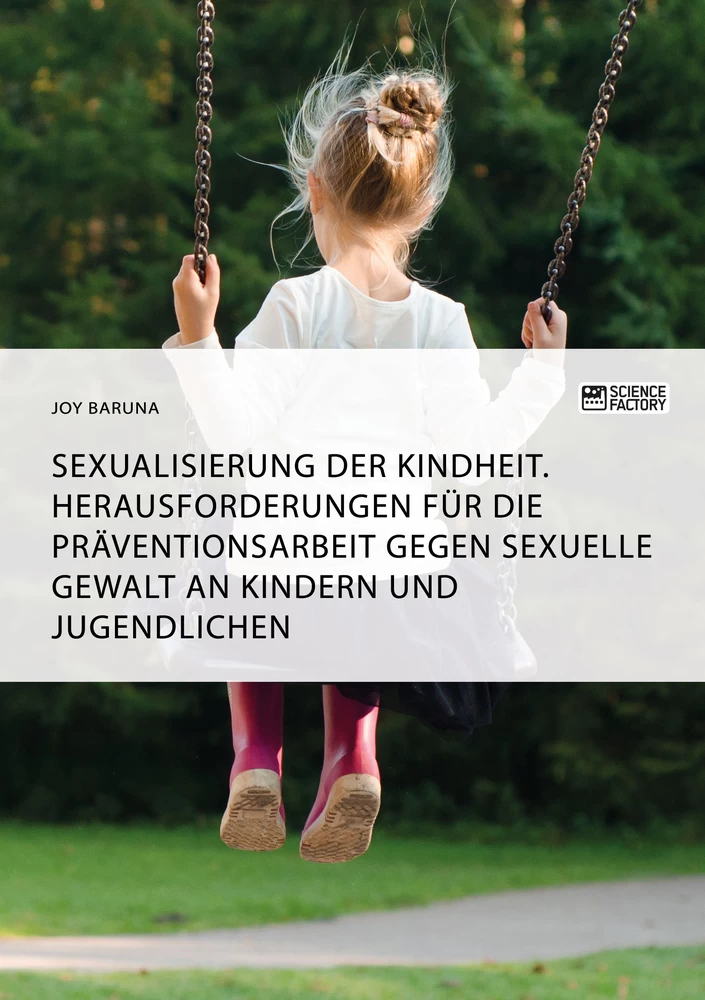
Sexualisierung der Kindheit. Herausforderungen für die Präventionsarbeit gegen sexuelle Gewalt an Kindern und Jugendlichen
Bachelorarbeit, 2017
42 Seiten, Note: 1,0
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
- Einleitende Bemerkungen
- Sexuelle Gewalt an Kindern und Jugendlichen
- Kritische Betrachtung der Bezeichnung „Sexueller Missbrauch“
- Definitionen, Häufigkeit und Auswirkungen sexueller Gewalt an Kindern
- Täterprofile und Täterstrategien
- Kindzentrierte Präventionsansätze als Antwort auf Täterstrategien
- Mediatisierung und Sexualisierung der Kindheit
- Begriffsbestimmungen und Beschreibung der Wechselwirkung zwischen Mediatisierung und Sexualisierung
- Zur Verbreitung und Bedeutung von Medien im kindlichen Lebenslauf
- Der Sexualisierungsdiskurs unter besonderer Berücksichtigung der medialen Repräsentation von Frauen und Symbolik der Mädchenfigur
- „Das Recht auf körperliche und sexuelle Selbstbestimmung“ – Diskussion einer Präventionsbotschaft bezüglich sexueller Gewalt im Kontext der Selbstsexualisierung frühadoleszenter Mädchen
- Fazit und Implikationen für die Prävention sexueller Gewalt von Kindern und Jugendlichen
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit untersucht die ambivalenten Botschaften, denen Kinder und Jugendliche, insbesondere Mädchen, in Bezug auf sexuelle Selbstbestimmung und Prävention sexueller Gewalt ausgesetzt sind. Sie analysiert die Wechselwirkung zwischen Mediatisierung und Sexualisierung der Kindheit und deren Einfluss auf das Selbstbild von Mädchen. Der Fokus liegt auf der indirekten Sexualisierung und der daraus resultierenden Selbstsexualisierung im Kontext gesellschaftlicher und medialer Repräsentationen von Frauen.
- Sexuelle Gewalt an Kindern und Jugendlichen: Definitionen, Auswirkungen und Präventionsansätze.
- Mediatisierung und Sexualisierung der Kindheit: Einfluss von Medien auf das Selbstbild von Mädchen.
- Ambivalente Botschaften: Der Widerspruch zwischen dem Recht auf sexuelle Selbstbestimmung und sexualisierten Medieninhalten.
- Gesellschaftliche Konstruktion von Weiblichkeit und die Mädchenfigur als Emblem der Unschuld.
- Kindzentrierte Präventionsstrategien im Kontext der Selbstsexualisierung.
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitende Bemerkungen: Der Text führt in die Thematik ein und stellt die zentrale Frage nach dem Widerspruch zwischen dem Recht auf körperliche und sexuelle Selbstbestimmung und der allgegenwärtigen Sexualisierung von Kindern und Jugendlichen in Medien. Er verweist auf den gesellschaftlichen Kontext, der einerseits sexuelle Gewalt thematisiert und andererseits zur Sexualisierung und Pornografisierung beiträgt, besonders in digitalen Medien. Der Fokus liegt auf der Selbstsexualisierung von Mädchen, wobei der Einfluss auf Jungen und Männer ebenfalls erwähnt wird.
Sexuelle Gewalt an Kindern und Jugendlichen: Dieses Kapitel definiert sexuelle Gewalt an Kindern, beleuchtet die Häufigkeit und Auswirkungen, analysiert Täterprofile und -strategien und diskutiert kindzentrierte Präventionsansätze. Es zeigt auf, wie Täter Strategien nutzen, um Kinder und Jugendliche zu manipulieren und wie präventive Maßnahmen darauf reagieren können. Die Bedeutung von Aufklärung und Empowerment wird hervorgehoben.
Mediatisierung und Sexualisierung der Kindheit: Dieser Abschnitt analysiert die komplexen Zusammenhänge zwischen Mediatisierung und Sexualisierung der Kindheit. Er definiert die Begriffe und untersucht die Verbreitung und Bedeutung von Medien im Leben von Kindern. Ein besonderer Schwerpunkt liegt auf der medialen Repräsentation von Frauen und der Symbolik der Mädchenfigur, die oft mit Unschuld assoziiert wird, im Kontext der postfeministischen Ära. Die Darstellung zeigt, wie Medienbilder das Selbstverständnis und die Körperwahrnehmung von Kindern beeinflussen.
„Das Recht auf körperliche und sexuelle Selbstbestimmung“ – Diskussion einer Präventionsbotschaft bezüglich sexueller Gewalt im Kontext der Selbstsexualisierung frühadoleszenter Mädchen: Dieses Kapitel beleuchtet den scheinbaren Widerspruch zwischen dem Recht auf Selbstbestimmung und der allgegenwärtigen Sexualisierung in der Medienlandschaft. Es untersucht, wie diese widersprüchlichen Botschaften die Entwicklung von Mädchen beeinflussen und wie Präventionsarbeit diese Herausforderungen berücksichtigen muss. Der Text analysiert die Auswirkungen der Selbstsexualisierung auf das Selbstbild und die Vulnerabilität von Mädchen gegenüber sexueller Gewalt.
Schlüsselwörter
Sexuelle Gewalt, Kinder, Jugendliche, Prävention, Mediatisierung, Sexualisierung, Selbstbestimmung, Mädchen, Selbstsexualisierung, Medienrepräsentation, Körperbild, Postfeminismus.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Ambivalente Botschaften: Sexuelle Selbstbestimmung und Prävention sexueller Gewalt im Kontext der Mediatisierung und Sexualisierung der Kindheit
Was ist das zentrale Thema der Arbeit?
Die Arbeit untersucht den Widerspruch zwischen dem Recht auf sexuelle Selbstbestimmung und der allgegenwärtigen Sexualisierung von Kindern und Jugendlichen, insbesondere Mädchen, in den Medien. Sie analysiert die Wechselwirkung von Mediatisierung und Sexualisierung und deren Einfluss auf das Selbstbild von Mädchen. Ein Schwerpunkt liegt auf der indirekten Sexualisierung und der daraus resultierenden Selbstsexualisierung.
Welche Aspekte der sexuellen Gewalt an Kindern und Jugendlichen werden behandelt?
Die Arbeit definiert sexuelle Gewalt, beleuchtet Häufigkeit und Auswirkungen, analysiert Täterprofile und -strategien und diskutiert kindzentrierte Präventionsansätze. Es wird gezeigt, wie Täter Kinder manipulieren und wie Präventionsmaßnahmen darauf reagieren können. Die Bedeutung von Aufklärung und Empowerment wird hervorgehoben.
Wie wird die Mediatisierung und Sexualisierung der Kindheit analysiert?
Die Arbeit analysiert den komplexen Zusammenhang zwischen Mediatisierung und Sexualisierung. Sie untersucht die Verbreitung und Bedeutung von Medien im Leben von Kindern und legt einen Schwerpunkt auf die mediale Repräsentation von Frauen und die Symbolik der Mädchenfigur im Kontext der postfeministischen Ära. Es wird gezeigt, wie Medienbilder das Selbstverständnis und die Körperwahrnehmung beeinflussen.
Welcher Widerspruch steht im Mittelpunkt der Betrachtung?
Die Arbeit beleuchtet den Widerspruch zwischen dem Recht auf sexuelle Selbstbestimmung und der allgegenwärtigen Sexualisierung in den Medien. Es wird untersucht, wie diese widersprüchlichen Botschaften die Entwicklung von Mädchen beeinflussen und wie Präventionsarbeit diese Herausforderungen berücksichtigen muss. Die Auswirkungen der Selbstsexualisierung auf das Selbstbild und die Vulnerabilität von Mädchen werden analysiert.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit umfasst folgende Kapitel: Einleitende Bemerkungen, Sexuelle Gewalt an Kindern und Jugendlichen, Mediatisierung und Sexualisierung der Kindheit, „Das Recht auf körperliche und sexuelle Selbstbestimmung“ – Diskussion einer Präventionsbotschaft bezüglich sexueller Gewalt im Kontext der Selbstsexualisierung frühadoleszenter Mädchen, und Fazit und Implikationen für die Prävention sexueller Gewalt von Kindern und Jugendlichen.
Welche Schlüsselbegriffe sind relevant?
Wichtige Schlüsselbegriffe sind: Sexuelle Gewalt, Kinder, Jugendliche, Prävention, Mediatisierung, Sexualisierung, Selbstbestimmung, Mädchen, Selbstsexualisierung, Medienrepräsentation, Körperbild, Postfeminismus.
Welche Zielsetzung verfolgt die Arbeit?
Die Arbeit untersucht die ambivalenten Botschaften bezüglich sexueller Selbstbestimmung und Prävention sexueller Gewalt, denen Kinder und Jugendliche ausgesetzt sind. Sie analysiert den Einfluss der Mediatisierung und Sexualisierung der Kindheit auf das Selbstbild von Mädchen, wobei der Fokus auf der indirekten Sexualisierung und der daraus resultierenden Selbstsexualisierung liegt.
Details
- Titel
- Sexualisierung der Kindheit. Herausforderungen für die Präventionsarbeit gegen sexuelle Gewalt an Kindern und Jugendlichen
- Hochschule
- Freie Universität Berlin (Erziehungswissenschaft und Psychologie)
- Note
- 1,0
- Autor
- Joy Baruna (Autor:in)
- Erscheinungsjahr
- 2017
- Seiten
- 42
- Katalognummer
- V381216
- ISBN (eBook)
- 9783668637528
- ISBN (Buch)
- 9783956872280
- Dateigröße
- 531 KB
- Sprache
- Deutsch
- Schlagworte
- Bachelorarbeit sexuelle Gewalt sexueller Missbrauch Kinder sexualisierte Gewalt Prävention Gewaltprävention Sexualisierung Mediatisierung Medialisierung Kindheit Mädchen Frühadoleszenz Mädchenfigur Gesellschaft Kindesmissbrauch Medien Digitalisierung Soziologie Psychologie Erziehungswissenschaft soziale Arbeit Präventionsthemen Wechselwirkung Ambivalenz Präventionsbotschaft Diskussion
- Produktsicherheit
- GRIN Publishing GmbH
- Preis (Ebook)
- US$ 19,99
- Preis (Book)
- US$ 28,99
- Arbeit zitieren
- Joy Baruna (Autor:in), 2017, Sexualisierung der Kindheit. Herausforderungen für die Präventionsarbeit gegen sexuelle Gewalt an Kindern und Jugendlichen, München, Page::Imprint:: GRINVerlagOHG, https://www.diplomarbeiten24.de/document/381216
- Autor werden
- Ihre Optionen
- Vertriebskanäle
- Premium Services
- Autorenprofil
- Textarten und Formate
- Services für Verlage, Hochschulen, Unternehmen

- © GRIN Publishing GmbH.
- Alle Inhalte urheberrechtlich geschützt. Kopieren und verbreiten untersagt.
- info@grin.com
- AGB
- Open Publishing
Der GRIN Verlag hat sich seit 1998 auf die Veröffentlichung akademischer eBooks und Bücher spezialisiert. Der GRIN Verlag steht damit als erstes Unternehmen für User Generated Quality Content. Die Verlagsseiten GRIN.com, Hausarbeiten.de und Diplomarbeiten24 bieten für Hochschullehrer, Absolventen und Studenten die ideale Plattform, wissenschaftliche Texte wie Hausarbeiten, Referate, Bachelorarbeiten, Masterarbeiten, Diplomarbeiten, Dissertationen und wissenschaftliche Aufsätze einem breiten Publikum zu präsentieren.
Kostenfreie Veröffentlichung: Hausarbeit, Bachelorarbeit, Diplomarbeit, Dissertation, Masterarbeit, Interpretation oder Referat jetzt veröffentlichen!
- GRIN Verlag GmbH
-
- Nymphenburger Str. 86
- 80636
- Munich, Deutschland
- +49 89-550559-0
- +49 89-550559-10
- info@grin.com
-