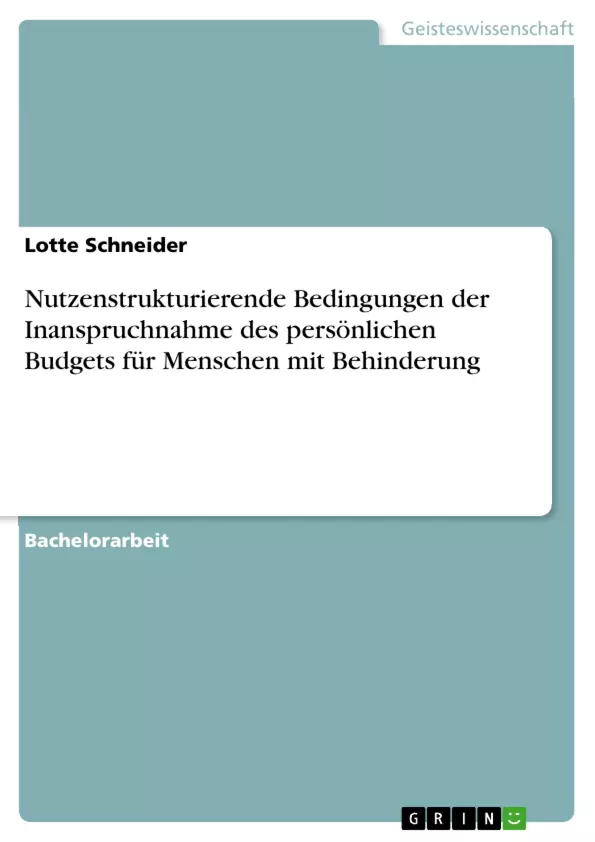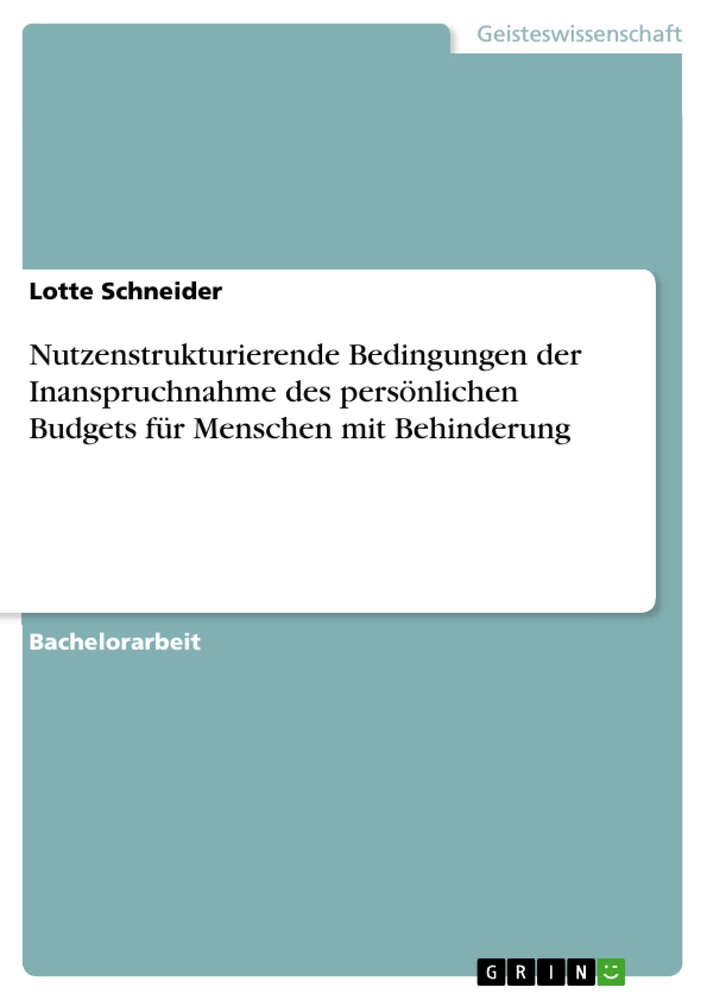
Nutzenstrukturierende Bedingungen der Inanspruchnahme des persönlichen Budgets für Menschen mit Behinderung
Bachelorarbeit, 2017
90 Seiten, Note: 1,0
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einleitung
- 2 Einordnung der Begrifflichkeiten
- 2.1 Behinderung
- 2.2 Selbstbestimmung
- 2.3 Rehabilitation und Teilhabe
- 3 Das Persönliche Budget
- 3.1 Eine begriffliche Annäherung
- 3.2 Konzeptionelle Grundlagen - Von der Sach- zur Geldleistung
- 3.3 Zur Entstehung der Leistungsform
- 3.3.1 Der Paradigmenwechsel in der Behindertenhilfe
- 3.3.2 Das Persönliche Budget im Kontext des Paradigmenwechsels
- 3.3.3 Einführung und Entwicklung des Persönlichen Budgets in Deutschland
- 3.4 Sozialrechtliche Grundlagen
- 3.4.1 SGB IX und Budgetverordnung (BudgetV)
- 3.4.2 Leistungsberechtigte Personen
- 3.4.3 Budgetfähige Leistungen und Leistungsträger
- 3.4.4 Das Persönliche Budget als Komplexleistung
- 3.4.5 Bewilligungsverfahren
- 4 Aktueller Forschungsstand
- 5 Die Nutzer*innenforschung
- 5.1 Perspektiven der Forschung – Nutzen und Nutzung
- 5.2 Kontextualisierung der Nutzer*innenforschung
- 6 Forschungsdesign
- 6.1 Erhebungsmethode: Das problemzentrierte Interview
- 6.2 Entwicklung des Leitfadens und Kategorienbildung – Relevanzkontexte des Persönlichen Budgets
- 6.3 Feldzugang
- 6.4 Durchführung
- 6.5 Auswertungsmethode: Die qualitative Inhaltsanalyse
- 7 Empirie: Ergebnisse der Studie und Diskussion
- 7.1 Nutzenstrukturierende Bedingungen auf der Ebene des subjektiven Relevanzkontextes
- 7.2 Nutzenstrukturierende Bedingungen auf der Ebene des institutionellen Relevanzkontextes
- 7.3 Nutzenstrukturierende Bedingungen auf der Makroebene
- 7.4 Zusammenfassung
- 8 Handlungsempfehlungen
- 9 Fazit und Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Bachelor-Thesis befasst sich mit dem Persönlichen Budget für Menschen mit Behinderung und analysiert die nutzenstrukturierenden Bedingungen aus der Perspektive der Nutzer*innen. Ziel ist es, die Bedingungen zu identifizieren, die die Inanspruchnahme des Persönlichen Budgets beeinflussen und somit die tatsächliche Nutzung fördern oder behindern.
- Konzeptionelle Grundlagen und Entstehung des Persönlichen Budgets
- Sozialrechtliche Grundlagen und Rahmenbedingungen
- Analyse der Nutzer*innenperspektive im Rahmen einer qualitativen Studie
- Identifizierung nutzenstrukturierender Bedingungen auf verschiedenen Ebenen
- Ableitung von Handlungsempfehlungen zur Optimierung der Inanspruchnahme
Zusammenfassung der Kapitel
Die Arbeit beginnt mit einer Einordnung der relevanten Begrifflichkeiten wie Behinderung, Selbstbestimmung und Rehabilitation und Teilhabe. Anschließend wird das Persönliche Budget in seiner konzeptionellen Entwicklung, seinen sozialrechtlichen Grundlagen und seiner Bedeutung im Paradigmenwechsel der Behindertenhilfe beleuchtet. Der aktuelle Forschungsstand zu Nutzen und Nutzung des Persönlichen Budgets wird dargelegt.
Die Nutzer*innenforschung, die im Mittelpunkt der Arbeit steht, wird im Detail vorgestellt, mit Fokus auf das Forschungsdesign, die Datenerhebungsmethode (problemzentriertes Interview) und die Auswertungsmethode (qualitative Inhaltsanalyse).
Die empirischen Ergebnisse der Studie werden präsentiert und diskutiert, wobei die nutzenstrukturierenden Bedingungen auf der Ebene des subjektiven Relevanzkontextes, des institutionellen Relevanzkontextes und auf der Makroebene untersucht werden. Schließlich werden Handlungsempfehlungen zur Optimierung der Inanspruchnahme des Persönlichen Budgets abgeleitet.
Schlüsselwörter
Persönliches Budget, Behinderung, Selbstbestimmung, Teilhabe, Nutzer*innenforschung, qualitative Forschung, problemzentriertes Interview, Relevanzkontext, nutzenstrukturierende Bedingungen, Handlungsempfehlungen.
Häufig gestellte Fragen
Was ist das Persönliche Budget für Menschen mit Behinderung?
Es ist eine Geldleistung, die es Menschen mit Behinderung ermöglicht, notwendige Unterstützungsleistungen selbstbestimmt einzukaufen, anstatt Sachleistungen zu erhalten.
Seit wann gibt es einen Rechtsanspruch auf das Persönliche Budget?
In Deutschland besteht der Rechtsanspruch auf das Persönliche Budget seit dem 1. Januar 2008 gemäß SGB IX.
Welche Vorteile bietet das Persönliche Budget für die Nutzer?
Es fördert die Selbstbestimmung und Wahlfreiheit, da die Nutzer als Arbeitgeber fungieren und selbst entscheiden, wer ihnen wann und wie hilft.
Welche Bedingungen limitieren den Nutzen des Budgets?
Bürokratische Hürden, mangelnde Beratung, institutionelle Widerstände und die Überforderung mit der Arbeitgeberrolle können die Inanspruchnahme erschweren.
Was bedeutet der „Paradigmenwechsel“ in der Behindertenhilfe?
Der Wechsel weg von einem defizitorientierten hin zu einem sozialen Verständnis von Behinderung, bei dem Teilhabe und Selbstbestimmung im Mittelpunkt stehen.
Details
- Titel
- Nutzenstrukturierende Bedingungen der Inanspruchnahme des persönlichen Budgets für Menschen mit Behinderung
- Hochschule
- Fachhochschule Düsseldorf
- Note
- 1,0
- Autor
- Lotte Schneider (Autor:in)
- Erscheinungsjahr
- 2017
- Seiten
- 90
- Katalognummer
- V383726
- ISBN (eBook)
- 9783668591028
- ISBN (Buch)
- 9783668591035
- Dateigröße
- 867 KB
- Sprache
- Deutsch
- Schlagworte
- Behinderung Selbstbestimmung Inklusion Teilhabe Rehabilitation SGB IX Behindertenhilfe Paradigmenwechsel Nutzerforschung Mayring Nutzerinnenforschung
- Produktsicherheit
- GRIN Publishing GmbH
- Preis (Ebook)
- US$ 39,99
- Preis (Book)
- US$ 51,99
- Arbeit zitieren
- Lotte Schneider (Autor:in), 2017, Nutzenstrukturierende Bedingungen der Inanspruchnahme des persönlichen Budgets für Menschen mit Behinderung, München, Page::Imprint:: GRINVerlagOHG, https://www.diplomarbeiten24.de/document/383726
- Autor werden
- Ihre Optionen
- Vertriebskanäle
- Premium Services
- Autorenprofil
- Textarten und Formate
- Services für Verlage, Hochschulen, Unternehmen

- © GRIN Publishing GmbH.
- Alle Inhalte urheberrechtlich geschützt. Kopieren und verbreiten untersagt.
- info@grin.com
- AGB
- Open Publishing
Der GRIN Verlag hat sich seit 1998 auf die Veröffentlichung akademischer eBooks und Bücher spezialisiert. Der GRIN Verlag steht damit als erstes Unternehmen für User Generated Quality Content. Die Verlagsseiten GRIN.com, Hausarbeiten.de und Diplomarbeiten24 bieten für Hochschullehrer, Absolventen und Studenten die ideale Plattform, wissenschaftliche Texte wie Hausarbeiten, Referate, Bachelorarbeiten, Masterarbeiten, Diplomarbeiten, Dissertationen und wissenschaftliche Aufsätze einem breiten Publikum zu präsentieren.
Kostenfreie Veröffentlichung: Hausarbeit, Bachelorarbeit, Diplomarbeit, Dissertation, Masterarbeit, Interpretation oder Referat jetzt veröffentlichen!
- GRIN Verlag GmbH
-
- Nymphenburger Str. 86
- 80636
- Munich, Deutschland
- +49 89-550559-0
- +49 89-550559-10
- info@grin.com
-