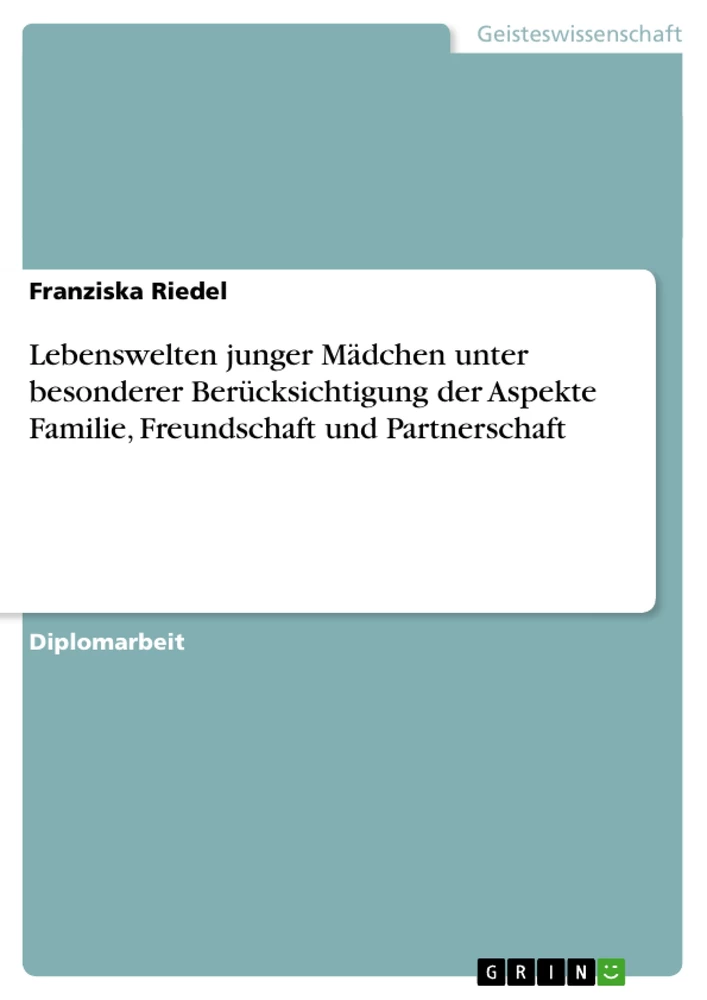
Lebenswelten junger Mädchen unter besonderer Berücksichtigung der Aspekte Familie, Freundschaft und Partnerschaft
Diplomarbeit, 2005
83 Seiten, Note: 1
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Theorien und aktuelle Beobachtungen zur Lebensphase Jugend
- 2.1 Theoretischer Abriss über die Jugendphase
- 2.2 Strukturwandel der Lebensphase Jugend
- 3. Weibliche Adoleszenz- Junge Mädchen zwischen individuellen Lebensstil und Rollenkonformität
- 3.1 Geschlechterrollen und Stereotype im Wandel
- 3.2 Geschlechterrollen in der Kinderliteratur der 90er Jahre
- 4. Die Bedeutung von Freundschaft im Leben junger Mädchen
- 4.1 Die Rolle der Peer Group im Jugendalter
- 4.2 Mädchengruppen- Stellenwert und Funktion von „Freundinnen“
- 4.3 Die Freizeitgestaltung weiblicher Jugendlicher
- 5. Liebe und Partnerschaft im Leben junger Mädchen
- 5.1 Erwartungen und Verhalten junger Mädchen an- und in Partnerschaften
- 5.2 Sexualverhalten junger Mädchen im Spiegel moderner Jugendsexualität
- 6. Das Lebensthema Familie- junge Mädchen zwischen Herkunftsfamilie und eigener Lebensform
- 6.1 Die Bedeutung der Herkunftsfamilie und Ablösungsprozesse junger Mädchen
- 6.2 Familie und Beruf - zentrale Elemente der Zukunftsplanung junger Mädchen?
- 7. Die Bedeutung veränderter Lebenswelten für die soziale Mädchenarbeit
- 8. Zusammenfassung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit zielt darauf ab, ein aktuelles Bild von den Lebenswelten junger Mädchen zu zeichnen, indem sie aktuelle Studien und Forschungsergebnisse heranzieht. Dabei wird der Fokus auf die Aspekte Freundschaft, Partnerschaft und Familie gelegt, um zu untersuchen, inwiefern stereotype Zuschreibungen die heutige Generation junger Mädchen beeinflussen und welche Konsequenzen dies für die sozialpädagogische Mädchenarbeit hat.
- Analyse der Lebenswelten junger Mädchen im Kontext von Freundschaft, Partnerschaft und Familie
- Untersuchung des Einflusses von Geschlechterrollen und Stereotypen auf die Lebensentwürfe junger Mädchen
- Bewertung der Rolle der Familie, der Peer Group und des Partnerschaftslebens in der Entwicklung von jungen Mädchen
- Relevanz der Ergebnisse für die sozialpädagogische Mädchenarbeit
- Hervorhebung der Bedeutung der Lebenswelten junger Mädchen für die Gesellschaft
Zusammenfassung der Kapitel
Die Arbeit beginnt mit einer Einleitung, die die Relevanz des Themas „Lebenswelten junger Mädchen“ beleuchtet und die Forschungsfrage der Arbeit definiert. Anschließend erfolgt im zweiten Kapitel ein theoretischer Abriss über die Lebensphase Jugend, inklusive der Darstellung des Strukturwandels in der heutigen Zeit. Das dritte Kapitel befasst sich mit dem Thema Geschlecht und erläutert, wie Geschlechterrollen und Stereotype entstehen und sich auf die Lebenswelt junger Mädchen auswirken. Das vierte Kapitel untersucht die Bedeutung von Freundschaft im Leben junger Mädchen, mit einem Fokus auf Mädchengruppen und die Gestaltung von Beziehungen. Das fünfte Kapitel analysiert die Einstellungen und Verhaltensweisen junger Mädchen in ihren Partnerschaften und sexuellen Aktivitäten. Das sechste Kapitel widmet sich dem Einfluss der Herkunftsfamilie auf die Lebensentwürfe junger Mädchen, sowie der Bedeutung von Familie und Beruf in ihren Zukunftsplänen. Das siebte Kapitel beleuchtet die Relevanz der Ergebnisse für die soziale Mädchenarbeit und zeigt mögliche Perspektiven für die zukünftige geschlechtsbezogene Jugendarbeit auf.
Schlüsselwörter
Diese Arbeit beschäftigt sich mit den Lebenswelten junger Mädchen, unter besonderer Berücksichtigung der Aspekte Familie, Freundschaft und Partnerschaft. Der Fokus liegt auf der Analyse von Geschlechterrollen und Stereotypen, der Bedeutung von Peer Groups und der Rolle der Familie im Jugendalter. Darüber hinaus werden Themen wie moderne Jugendsexualität, Ablösungsprozesse und Zukunftsplanung junger Mädchen behandelt. Die Arbeit bezieht sich auf aktuelle Forschungsergebnisse und beleuchtet die Relevanz der Erkenntnisse für die soziale Mädchenarbeit.
Häufig gestellte Fragen
Was prägt die Lebenswelt junger Mädchen heute besonders?
Die Lebenswelt ist geprägt durch ein Spannungsfeld zwischen individuellem Lebensstil und fortbestehenden Rollenanforderungen sowie der hohen Bedeutung von Peer Groups und Familie.
Welche Rolle spielt die Freundschaft für weibliche Jugendliche?
Mädchengruppen und „Freundinnen“ haben eine zentrale Funktion für die Identitätsbildung, die Freizeitgestaltung und als emotionales Unterstützungssystem.
Wie beeinflussen Geschlechterrollen die Zukunftsplanung von Mädchen?
Trotz moderner Mädchenbilder sind junge Frauen oft noch mit stereotypen Zuschreibungen konfrontiert, was sich in ihren Vorstellungen zur Vereinbarkeit von Familie und Beruf zeigt.
Was sind die Konsequenzen für die sozialpädagogische Mädchenarbeit?
Die Arbeit fordert eine geschlechtsbezogene Jugendarbeit, die die veränderten Lebenswelten ernst nimmt und Mädchen bei der Bewältigung von Rollenkonflikten unterstützt.
Wie wird "Geschlecht" in dieser Untersuchung verstanden?
Geschlecht wird im Sinne der modernen Forschung als eine soziale und kulturelle Konstruktion („Doing Gender“) betrachtet, nicht nur als biologische Kategorie.
Details
- Titel
- Lebenswelten junger Mädchen unter besonderer Berücksichtigung der Aspekte Familie, Freundschaft und Partnerschaft
- Hochschule
- Fachhochschule Braunschweig / Wolfenbüttel; Standort Wolfenbüttel
- Note
- 1
- Autor
- Franziska Riedel (Autor:in)
- Erscheinungsjahr
- 2005
- Seiten
- 83
- Katalognummer
- V38468
- ISBN (eBook)
- 9783638375252
- Dateigröße
- 770 KB
- Sprache
- Deutsch
- Schlagworte
- Lebenswelten Mädchen Berücksichtigung Aspekte Familie Freundschaft Partnerschaft
- Produktsicherheit
- GRIN Publishing GmbH
- Preis (Ebook)
- US$ 39,99
- Arbeit zitieren
- Franziska Riedel (Autor:in), 2005, Lebenswelten junger Mädchen unter besonderer Berücksichtigung der Aspekte Familie, Freundschaft und Partnerschaft, München, Page::Imprint:: GRINVerlagOHG, https://www.diplomarbeiten24.de/document/38468
- Autor werden
- Ihre Optionen
- Vertriebskanäle
- Premium Services
- Autorenprofil
- Textarten und Formate
- Services für Verlage, Hochschulen, Unternehmen

- © GRIN Publishing GmbH.
- Alle Inhalte urheberrechtlich geschützt. Kopieren und verbreiten untersagt.
- info@grin.com
- AGB
- Open Publishing
Der GRIN Verlag hat sich seit 1998 auf die Veröffentlichung akademischer eBooks und Bücher spezialisiert. Der GRIN Verlag steht damit als erstes Unternehmen für User Generated Quality Content. Die Verlagsseiten GRIN.com, Hausarbeiten.de und Diplomarbeiten24 bieten für Hochschullehrer, Absolventen und Studenten die ideale Plattform, wissenschaftliche Texte wie Hausarbeiten, Referate, Bachelorarbeiten, Masterarbeiten, Diplomarbeiten, Dissertationen und wissenschaftliche Aufsätze einem breiten Publikum zu präsentieren.
Kostenfreie Veröffentlichung: Hausarbeit, Bachelorarbeit, Diplomarbeit, Dissertation, Masterarbeit, Interpretation oder Referat jetzt veröffentlichen!
- GRIN Verlag GmbH
-
- Nymphenburger Str. 86
- 80636
- Munich, Deutschland
- +49 89-550559-0
- +49 89-550559-10
- info@grin.com
-









