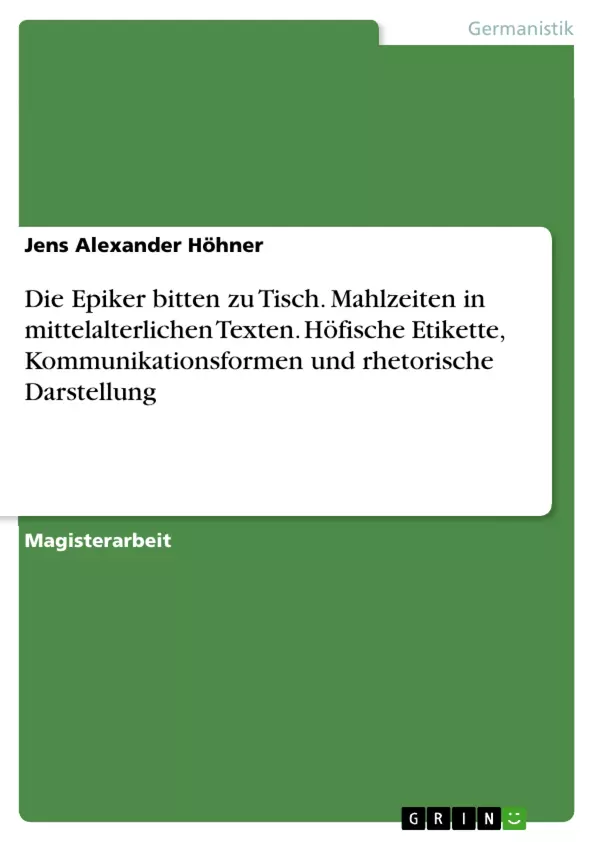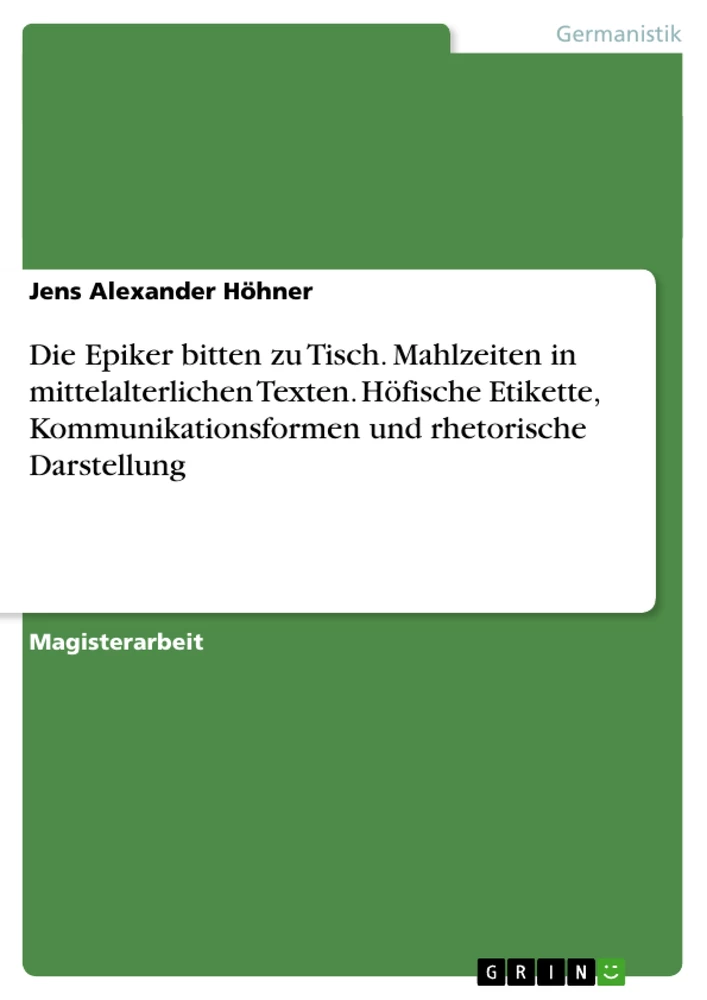
Die Epiker bitten zu Tisch. Mahlzeiten in mittelalterlichen Texten. Höfische Etikette, Kommunikationsformen und rhetorische Darstellung
Magisterarbeit, 2003
153 Seiten, Note: 1,7
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Das epische Mahl: Begriffe und grundlegende Komponenten
- 2.1 Der Begriff des Höfischen
- 2.2 Das Spektrum der epischen Wirtschaft
- 2.3 Die Begriffe der êre und der zuht
- 2.4 Die Wirtschaft als episches Motiv
- 2.4.1 Warum überhaupt essen?
- 2.4.2 Was kommt auf den Tisch?
- 2.4.3 Wie verhält sich der vorbildliche Gastgeber?
- 2.5 Speisen als Festereignis
- 2.5.1 Nibelungenlied: Die Reihe der gelungenen Feste
- 2.5.2 Nibelungenlied: Das fatale Hoffest König Gunthers
- 3. Das epische Mahl: Analysen eines Handlungsschauplatzes
- 3.1 Speisen in Wunderwelten
- 3.1.1 Alexanderlied: Die Tafel der Königin Candacis
- 3.1.2 Herzog Ernst: Das Hochzeitsmahl des Kranichkönigs
- 3.1.3 Salman und Morolf: An der Tafel des Bibelkönigs
- 3.1.4 Trojanerkrieg: Speisen mit Göttern und Zentauren
- 3.2 Speisen im leeren Palas: Das Tischlein-Deck-Dich-Motiv
- 3.3 Mähler im religiös-kultischen Kontext
- 3.3.1 Münchner Oswald: Der christliche König
- 3.3.1.1 Das Zahlenschema
- 3.3.1.2 Das Motiv der Eucharistie
- 3.3.2 Parzival: Die Munsalvaesche-Mähler
- 3.3.2.1 Das erste Festmahl in Munsalvaesche
- 3.3.2.1.1 Motive der Designation
- 3.3.2.1.2 Reichtum und Trauer
- 3.3.2.1.3 Der Ablauf des Gralsmahles
- 3.3.2.1.3.1 Die Prozession und ihr Aufbau
- 3.3.2.1.3.2 Das Mahl
- 3.3.2.1.3.3 Fazit
- 3.3.2.2 Das zweite Festmahl auf Munsalvaesche
- 3.3.2.1 Das erste Festmahl in Munsalvaesche
- 3.3.1 Münchner Oswald: Der christliche König
- 3.4 Mähler als Inszenierung und Demonstration von Herrschaft
- 3.4.1 Motivation politischer Festmähler: Der Rat zum Fest
- 3.4.2 Vorbereitung als erster Akt der Repräsentation
- 3.4.2.1 Mai und Beaflor: Das Tauffest Beaflors
- 3.4.2.3 Wilhelm von Wenden: Der festliche Hoftag
- 3.4.2.4 Der guote Gêrhart: Die Perspektive des Aktiven
- 3.4.3 Positive Herrscherbilder: Die Tischgemeinschaft als Forum
- 3.4.3.1 Kudrun: Das Krönungsfest von Hagen und Hilde
- 3.4.3.2 Morant und Galie: Der reuige Herrscher
- 3.4.3.3 Mai und Beaflor: Hochzeit und Armenspeisung
- 3.4.3.4 Wilhelm von Wenden: Das Friedensversprechen
- 3.5 Mähler als Schauplatz des Versagens
- 3.5.1 Mahlesgemeinschaften als öffentliche Zeugengemeinschaften
- 3.5.1.1 Kaiserchronik: Der Selbstmord Lucretias
- 3.5.1.2 König Rother: Die Schwäche König Konstantins
- 3.5.1.3 Heinrich von Kempten: Der Fall der Kaiserkrone
- 3.5.2 Der Tod an der Tafel
- 3.5.2.1 Nibelungenlied: Das verhängnisvolle Jagdmahl
- 3.5.2.2 Alexander: Der Gifttod des Herrschers
- 3.5.3 Nibelungenlied: Vom Mahl zur offenen Schlacht
- 3.5.1 Mahlesgemeinschaften als öffentliche Zeugengemeinschaften
- 3.6 Mähler als Zeichen der sozialen Abgrenzung
- 3.6.1 Parzival: Das höfische Mahl im Hause des Fährmanns Plippalinot
- 3.6.2 Willehalm: Die in Frage gestellten Werte des Höfischen
- 3.6.3 Helmbrecht: Die Entlarvung des Rittertums
- 3.1 Speisen in Wunderwelten
- 4. Das epische Mahl: Mahlesszenen aus den Artus-Epen als Schauplatz idealer höfischer Etikette
- 4.1 Die Tafelrunde: Das Funktionieren eines Idealgebildes
- 4.2 Das in Frage gestellte Artus-Ideal
- 4.2.1 Krone: Die Becherprobe beim Artus-Fest
- 4.2.2 Garel vom blühenden Tal: Das Versöhnungsmahl
- 4.3 Die Darstellung von höfischer Idealität
- 4.3.1 Parzival: Die Erziehung des jungen Parzival
- 4.3.2 Tandareis und Flordibel: Formen des Ehrerweises
- 4.3.3 Meleranz: Das Walten der Minne
- 4.3.4 Prächtige Hoffeste jenseits des Artus-Hofes
- 4.3.5 Fehlverhalten im Tandareis und Flordibel und Tristan (HvF)
- 4.3.6 Ehre an König Artus: Der Empfang im Tristan (HvF)
- 4.4 Mähler als Instanz der Prüfung
- 4.4.1 Krone: Die gemeisterte Erlösungsfrage
- 4.4.2 Daniel vom blühenden Tal: Die Herausforderung
- 5. Zusammenfassung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Magisterarbeit untersucht die Darstellung von Mahlzeiten in mittelalterlichen Texten. Ziel ist es, die Bedeutung von Mahlszenen im Kontext höfischer Etikette, Kommunikationsformen und rhetorischer Darstellung zu analysieren. Dabei wird der Fokus auf die Funktion von Mahlzeiten als Handlungsort und Spiegel gesellschaftlicher Normen und Werte gelegt.
- Das epische Mahl als sozialer und kultureller Raum
- Die Rolle von Essen und Trinken in der höfischen Etikette
- Die rhetorische Gestaltung von Mahlszenen in epischen Texten
- Mahlzeiten als Schauplatz von Machtdemonstration und gesellschaftlicher Abgrenzung
- Die Darstellung von Idealität und deren Infragestellung im Kontext von Mahlszenen
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Diese Einleitung führt in das Thema der Magisterarbeit ein und skizziert den Forschungsstand sowie die Methodik der Untersuchung. Sie begründet die Relevanz der Analyse von Mahlszenen in mittelalterlichen Texten und umreißt die zentralen Fragestellungen der Arbeit.
2. Das epische Mahl: Begriffe und grundlegende Komponenten: Dieses Kapitel definiert zentrale Begriffe wie "höfisch," "êre," und "zuht" und untersucht die grundlegenden Komponenten epischer Mahlszenen. Es analysiert die Funktion von Essen und Trinken in mittelalterlichen Texten und beleuchtet unterschiedliche Aspekte des epischen Mahls, von der Vorbereitung und dem Ablauf bis hin zur Bedeutung der Speisen selbst. Besonderes Augenmerk wird auf die Rolle des Gastgebers gelegt und exemplarisch an Hand des Nibelungenliedes erörtert, welches sowohl gelungene als auch fatale Feste darstellt.
3. Das epische Mahl: Analysen eines Handlungsschauplatzes: Dieses Kapitel analysiert Mahlszenen aus verschiedenen mittelalterlichen Texten als Handlungsort. Es werden Beispiele aus Werken wie dem Alexanderlied, Herzog Ernst, Salman und Morolf, und dem Trojanerkrieg untersucht, um die vielschichtigen Funktionen des Mahls zu beleuchten – von der Darstellung von Wunderwelten bis hin zu religiös-kultischen Kontexten (z.B. Parzival und die Munsalvaesche-Mähler). Des Weiteren wird analysiert, wie Mahlszenen Herrschaftsansprüche repräsentieren oder aber das Versagen von Herrschern illustrieren (z.B. Nibelungenlied). Abschließend betrachtet das Kapitel die Funktion von Mahlszenen als Zeichen sozialer Abgrenzung.
4. Das epische Mahl: Mahlesszenen aus den Artus-Epen als Schauplatz idealer höfischer Etikette: Dieses Kapitel konzentriert sich auf die Darstellung von Mahlen in den Artus-Epen. Es analysiert die Tafelrunde als Idealbild höfischer Etikette und untersucht, wie dieses Ideal in verschiedenen Texten dargestellt und mitunter auch in Frage gestellt wird. Die Analyse umfasst die Betrachtung von Mahlszenen als Instanzen der Prüfung und die Darstellung von höfischer Idealität und deren Abweichungen.
Schlüsselwörter
Mittelalterliche Literatur, Epik, Mahlszenen, Hofkultur, höfische Etikette, Kommunikationsformen, Rhetorik, Herrschaftsdarstellung, soziale Abgrenzung, Artus-Epen, Nibelungenlied, Parzival, êre, zuht.
Häufig gestellte Fragen zur Magisterarbeit: Das Epische Mahl
Was ist das Thema der Magisterarbeit?
Die Magisterarbeit untersucht die Darstellung von Mahlzeiten in mittelalterlichen Texten. Der Fokus liegt auf der Bedeutung von Mahlszenen im Kontext höfischer Etikette, Kommunikationsformen und rhetorischer Darstellung. Analysiert wird die Funktion von Mahlzeiten als Handlungsort und Spiegel gesellschaftlicher Normen und Werte.
Welche Texte werden in der Arbeit analysiert?
Die Arbeit analysiert Mahlszenen aus verschiedenen mittelalterlichen Texten, darunter das Nibelungenlied, Parzival, das Alexanderlied, Herzog Ernst, Salman und Morolf, der Trojanerkrieg, Münchner Oswald, König Rother, Heinrich von Kempten, Mai und Beaflor, Wilhelm von Wenden, Der guote Gêrhart, Kudrun, Morant und Galie, Willehalm, Helmbrecht, und verschiedene Artus-Epen (z.B. Krone, Garel vom blühenden Tal, Daniel vom blühenden Tal).
Welche Aspekte der Mahlszenen werden untersucht?
Die Analyse umfasst verschiedene Aspekte der Mahlszenen, darunter die Rolle von Essen und Trinken in der höfischen Etikette, die rhetorische Gestaltung der Szenen, Mahlszenen als Schauplatz von Machtdemonstration und gesellschaftlicher Abgrenzung, die Darstellung von Idealität und deren Infragestellung, sowie die Funktion des Mahls als Handlungsort und sozialer Raum.
Welche zentralen Begriffe werden definiert und untersucht?
Zentrale Begriffe wie "höfisch," "êre," und "zuht" werden definiert und im Kontext der Mahlszenen untersucht. Die Arbeit beleuchtet die Bedeutung dieser Begriffe für das Verständnis der dargestellten höfischen Kultur und der gesellschaftlichen Normen.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in fünf Kapitel: Eine Einleitung, ein Kapitel zur Definition der grundlegenden Begriffe und Komponenten des epischen Mahls, ein Kapitel zur Analyse von Mahlszenen als Handlungsort in verschiedenen Texten, ein Kapitel zur Analyse von Mahlszenen in den Artus-Epen, und eine Zusammenfassung der Ergebnisse. Jedes Kapitel umfasst detaillierte Analysen spezifischer Textabschnitte und deren Interpretation.
Was sind die zentralen Forschungsfragen der Arbeit?
Die Arbeit untersucht, wie Mahlszenen in mittelalterlichen Texten die höfische Kultur, gesellschaftliche Normen und Werte widerspiegeln. Sie fragt nach der Funktion von Mahlzeiten als Handlungsort, nach der Bedeutung von Essen und Trinken in der höfischen Etikette, und nach der rhetorischen Gestaltung von Mahlszenen als Mittel der Kommunikation und Machtdemonstration.
Welche Schlussfolgerungen zieht die Arbeit?
Die Zusammenfassung der Arbeit fasst die zentralen Ergebnisse der Analyse zusammen und bietet einen umfassenden Überblick über die Bedeutung des epischen Mahls als sozialer, kultureller und rhetorischer Raum im Mittelalter.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit am besten?
Mittelalterliche Literatur, Epik, Mahlszenen, Hofkultur, höfische Etikette, Kommunikationsformen, Rhetorik, Herrschaftsdarstellung, soziale Abgrenzung, Artus-Epen, Nibelungenlied, Parzival, êre, zuht.
Details
- Titel
- Die Epiker bitten zu Tisch. Mahlzeiten in mittelalterlichen Texten. Höfische Etikette, Kommunikationsformen und rhetorische Darstellung
- Hochschule
- Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn (Germanistik)
- Note
- 1,7
- Autor
- Jens Alexander Höhner (Autor:in)
- Erscheinungsjahr
- 2003
- Seiten
- 153
- Katalognummer
- V38469
- ISBN (eBook)
- 9783638375269
- ISBN (Buch)
- 9783638705646
- Dateigröße
- 1248 KB
- Sprache
- Deutsch
- Schlagworte
- Epiker Tisch Mähler Texten Kontext Etikette Kommunikationsformen Darstellung
- Produktsicherheit
- GRIN Publishing GmbH
- Preis (Ebook)
- US$ 62,99
- Preis (Book)
- US$ 72,99
- Arbeit zitieren
- Jens Alexander Höhner (Autor:in), 2003, Die Epiker bitten zu Tisch. Mahlzeiten in mittelalterlichen Texten. Höfische Etikette, Kommunikationsformen und rhetorische Darstellung, München, Page::Imprint:: GRINVerlagOHG, https://www.diplomarbeiten24.de/document/38469
- Autor werden
- Ihre Optionen
- Vertriebskanäle
- Premium Services
- Autorenprofil
- Textarten und Formate
- Services für Verlage, Hochschulen, Unternehmen

- © GRIN Publishing GmbH.
- Alle Inhalte urheberrechtlich geschützt. Kopieren und verbreiten untersagt.
- info@grin.com
- AGB
- Open Publishing
Der GRIN Verlag hat sich seit 1998 auf die Veröffentlichung akademischer eBooks und Bücher spezialisiert. Der GRIN Verlag steht damit als erstes Unternehmen für User Generated Quality Content. Die Verlagsseiten GRIN.com, Hausarbeiten.de und Diplomarbeiten24 bieten für Hochschullehrer, Absolventen und Studenten die ideale Plattform, wissenschaftliche Texte wie Hausarbeiten, Referate, Bachelorarbeiten, Masterarbeiten, Diplomarbeiten, Dissertationen und wissenschaftliche Aufsätze einem breiten Publikum zu präsentieren.
Kostenfreie Veröffentlichung: Hausarbeit, Bachelorarbeit, Diplomarbeit, Dissertation, Masterarbeit, Interpretation oder Referat jetzt veröffentlichen!
- GRIN Verlag GmbH
-
- Nymphenburger Str. 86
- 80636
- Munich, Deutschland
- +49 89-550559-0
- +49 89-550559-10
- info@grin.com
-