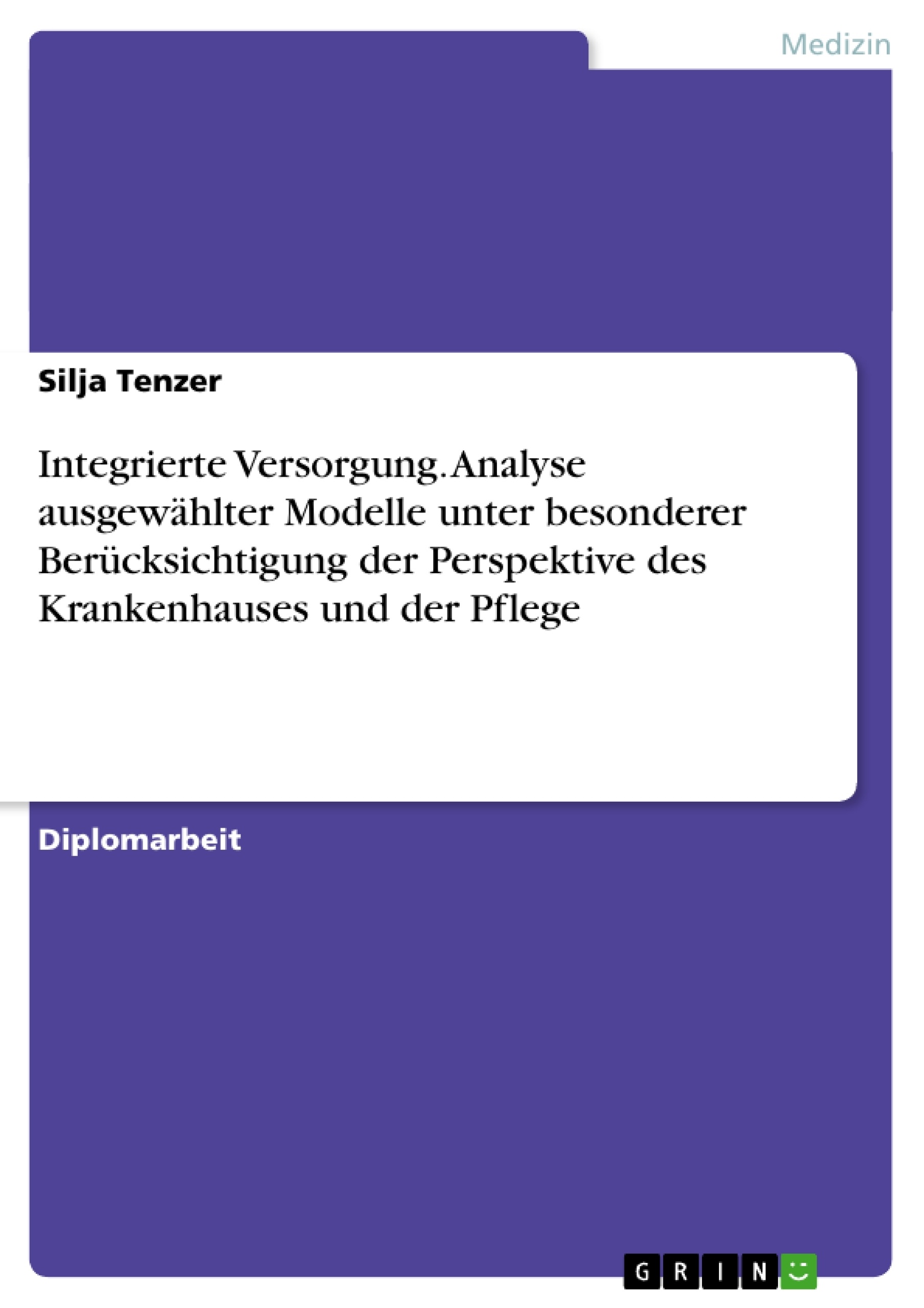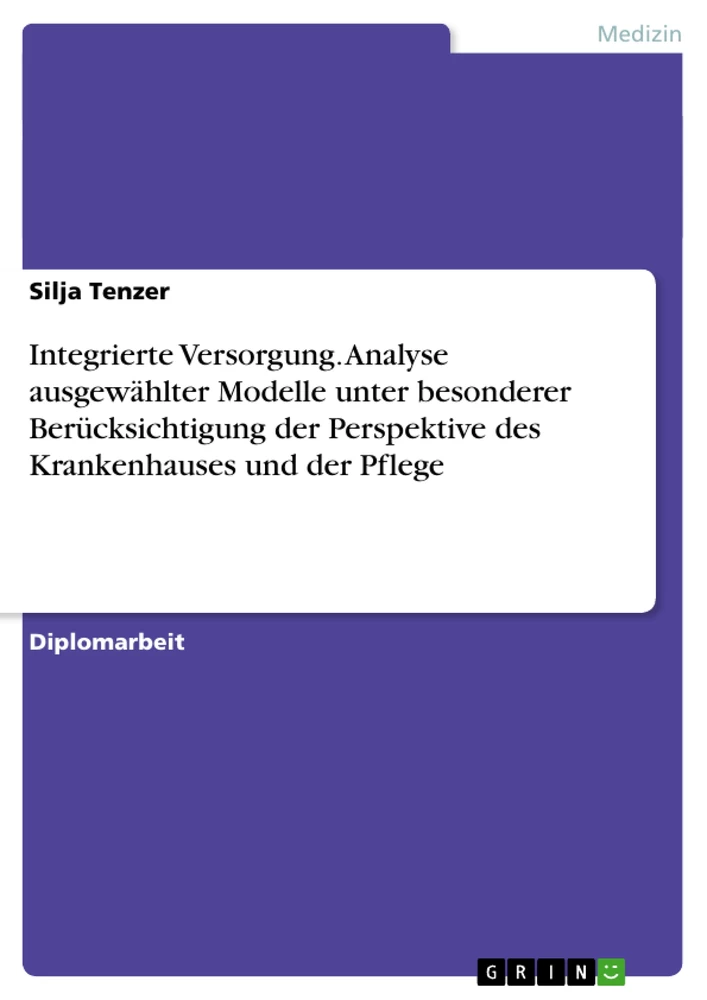
Integrierte Versorgung. Analyse ausgewählter Modelle unter besonderer Berücksichtigung der Perspektive des Krankenhauses und der Pflege
Diplomarbeit, 2004
70 Seiten, Note: sehr gut (1,3)
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
- Die sektorale Trennung des deutschen Gesundheitswesens und die sich daraus ergebenden Probleme
- Hypothesen der Diplomarbeit
- Integrierte Versorgung
- Begriffsbestimmung
- Ziele
- Formen
- Managed Care als Weiterentwicklung der Integrierten Versorgung
- Die gesetzlichen Grundlagen der Integrierten Versorgung
- Die Gesetzgebung zur Integrierten Versorgung seit Mitte der 1990er Jahre
- Die Regelungen des § 140 a-d SGB V
- Grundlagen
- Vertragsinhalte
- Vergütung
- Anschubfinanzierung und Bereinigung
- Integrierte Versorgung und Qualitätssicherung (§ 137 SGB V)
- § 6 der Bundespflegesatzverordnung
- Einflussfaktoren auf die Entwicklung von Modellen Integrierter Versorgung
- Die demografische Entwicklung in Deutschland
- Die ökonomische Situation der gesetzlichen Krankenversicherung
- Die Einführung des morbiditätsorientierten Risikostrukturausgleichs und der Wettbewerb zwischen den Krankenkassen
- Die Einführung der DRGs
- Disease-Management-Programme
- Der Grundsatz „Ambulant vor stationär“
- Die wachsende Bedeutung von Prävention und Gesundheitsförderung
- Zunehmende Patientensouveränität
- Der medizinisch-technische Fortschritt
- Auswertung von Fachliteratur zum Stand und den Perspektiven der Integrierten Versorgung in Deutschland
- Beteiligung von Krankenhäusern an Modellen zur Integrierten Versorgung
- Hindernisse
- Bedingungen
- Chancen
- Auswirkungen auf die Versorgung der Patienten und ihre Zufriedenheit
- Qualität der Leistungen
- Datenfluss und Datenschutz
- Die Kosten
- Auswirkungen auf die Kostensituation bei den Krankenkassen
- Finanzielle Konsequenzen für die Krankenhäuser
- Die Rolle der Pflege in Modellen Integrierter Versorgung
- Die integrierenden Kompetenzen der Pflege
- Faktoren, die die Einbindung der Pflege in Modelle zur Integrierten Versorgung erschweren
- Die Grenzen Integrierter Versorgung
- Ausgewählte Beispiele für Modelle Integrierter Versorgung
- Die „Prosper proGesund“- Netze der Bundesknappschaft
- Ziele und Konzept
- Die Qualität der Patientenversorgung und die Patientenzufriedenheit
- Datenfluss und Datenschutz
- Die Kostensituation
- Die Rolle der Pflege
- Das „Dahner-Modell“ / Konzept „Hausarztzentrierte Versorgung chronisch kranker Menschen gemäß §§ 140 a ff SGB V“
- Ziele und Konzept
- Die Qualität der Patientenversorgung und die Patientenzufriedenheit
- Datenfluss und Datenschutz
- Die Kostensituation
- Die Rolle der Pflege
- Die „IV-Fachkraft“ als Case-Manager
- Die Vergütung der „IV-Fachkraft“
- Das Modell „Integra“ Halle
- Ziele und Konzept
- Die Qualität der Patientenversorgung und die Patientenzufriedenheit
- Die Kostensituation
- Die Rolle der Pflege
- Das „Ludwigsburger Netzwerk“
- Ziele und Konzept
- Die Qualität der Patientenversorgung und die Patientenzufriedenheit
- Die Kostensituation
- Die Rolle der Pflege
- Beratung, Schulung, Anleitung
- Brückenpflege
- Pflegeüberleitung
- Qualitätssicherung
- Überprüfung der Hypothesen
- Die Qualität der Patientenversorgung und die Patientenzufriedenheit
- Die Kostensituation
- Die Perspektiven für die Pflege
- Kritische Bewertung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Diplomarbeit analysiert ausgewählte Modelle der integrierten Versorgung im deutschen Gesundheitswesen, wobei die Perspektiven von Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen im Fokus stehen. Ziel ist es, die Herausforderungen und Chancen der integrierten Versorgung aufzuzeigen und die Rolle der Pflege in diesem Kontext zu beleuchten.
- Sektorale Trennung des Gesundheitswesens und daraus resultierende Probleme
- Definition und Ziele der integrierten Versorgung
- Gesetzliche Grundlagen und Einflussfaktoren auf die Entwicklung von Modellen
- Auswirkungen auf Patientenversorgung, Kosten und die Rolle der Pflege
- Analyse ausgewählter Modelle der integrierten Versorgung
Zusammenfassung der Kapitel
Die sektorale Trennung des deutschen Gesundheitswesens und die sich daraus ergebenden Probleme: Dieses Kapitel legt die Grundlage der Arbeit, indem es die traditionellen Sektorengrenzen im deutschen Gesundheitswesen beschreibt und die daraus resultierenden Ineffizienzen und Probleme für Patienten und das System aufzeigt. Es dient als Ausgangspunkt für die anschließende Diskussion der integrierten Versorgung als Lösungsansatz.
Integrierte Versorgung: Hier wird der Begriff der integrierten Versorgung umfassend definiert und die verschiedenen Ziele, Formen und Weiterentwicklungen, wie beispielsweise Managed Care, erläutert. Der Fokus liegt auf der Beschreibung des Konzepts und seiner grundlegenden Prinzipien.
Die gesetzlichen Grundlagen der Integrierten Versorgung: Dieses Kapitel analysiert die rechtlichen Rahmenbedingungen und die wichtigsten gesetzlichen Regelungen, die die integrierte Versorgung beeinflussen. Es beleuchtet die Geschichte der Gesetzgebung und erklärt die relevanten Paragraphen des SGB V, einschließlich der Aspekte der Qualitätssicherung und der Vergütung.
Einflussfaktoren auf die Entwicklung von Modellen Integrierter Versorgung: Hier werden verschiedene Faktoren untersucht, die die Entwicklung und Verbreitung von Modellen der integrierten Versorgung beeinflussen. Es werden demografische, ökonomische, und gesundheitspolitische Aspekte wie die Einführung der DRGs, Disease-Management-Programme und der Grundsatz „Ambulant vor stationär“ berücksichtigt.
Auswertung von Fachliteratur zum Stand und den Perspektiven der Integrierten Versorgung in Deutschland: Dieses Kapitel präsentiert eine umfassende Literaturanalyse, die den aktuellen Stand der integrierten Versorgung in Deutschland beleuchtet. Es werden die Beteiligung von Krankenhäusern, Auswirkungen auf Patienten und Kosten sowie die Rolle der Pflege detailliert untersucht. Es werden Chancen und Herausforderungen für alle Beteiligten diskutiert.
Ausgewählte Beispiele für Modelle Integrierter Versorgung: In diesem Kapitel werden verschiedene konkrete Modelle der integrierten Versorgung vorgestellt und analysiert. Für jedes Modell werden die Ziele, das Konzept, die Auswirkungen auf Patientenversorgung und Kosten sowie die Rolle der Pflege im Detail erläutert. Die Analyse beinhaltet die Modelle „Prosper proGesund“, das „Dahner-Modell“, „Integra“ Halle und das „Ludwigsburger Netzwerk“.
Schlüsselwörter
Integrierte Versorgung, Gesundheitswesen, Krankenhaus, Pflege, SGB V, Qualitätssicherung, Kosten, Patientenzufriedenheit, Managed Care, DRGs, Disease-Management-Programme, Modellanalyse.
Häufig gestellte Fragen zur Diplomarbeit: Integrierte Versorgung im deutschen Gesundheitswesen
Was ist der Gegenstand dieser Diplomarbeit?
Die Diplomarbeit analysiert ausgewählte Modelle der integrierten Versorgung im deutschen Gesundheitswesen. Ein besonderer Fokus liegt dabei auf den Perspektiven von Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen. Ziel ist es, die Herausforderungen und Chancen der integrierten Versorgung aufzuzeigen und die Rolle der Pflege in diesem Kontext zu beleuchten.
Welche Themen werden in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit behandelt die sektorale Trennung des deutschen Gesundheitswesens und die daraus resultierenden Probleme. Sie definiert und erläutert die Ziele der integrierten Versorgung, analysiert die gesetzlichen Grundlagen und Einflussfaktoren auf deren Entwicklung. Auswirkungen auf die Patientenversorgung, die Kosten und die Rolle der Pflege werden untersucht. Schließlich werden ausgewählte Modelle der integrierten Versorgung analysiert und kritisch bewertet.
Welche Modelle der integrierten Versorgung werden untersucht?
Die Arbeit analysiert die folgenden Modelle: „Prosper proGesund“-Netze der Bundesknappschaft, das „Dahner-Modell“ (hausarztzentrierte Versorgung), „Integra“ Halle und das „Ludwigsburger Netzwerk“. Für jedes Modell werden Ziele, Konzept, Auswirkungen auf Patientenversorgung und Kosten sowie die Rolle der Pflege detailliert untersucht.
Welche gesetzlichen Grundlagen werden betrachtet?
Die Arbeit analysiert die rechtlichen Rahmenbedingungen und die wichtigsten gesetzlichen Regelungen, die die integrierte Versorgung beeinflussen. Sie beleuchtet die Geschichte der Gesetzgebung und erklärt relevante Paragraphen des SGB V, einschließlich der Aspekte der Qualitätssicherung und der Vergütung (§ 140 a-d SGB V, § 137 SGB V, § 6 der Bundespflegesatzverordnung).
Welche Einflussfaktoren auf die Entwicklung der integrierten Versorgung werden berücksichtigt?
Die Arbeit berücksichtigt demografische, ökonomische und gesundheitspolitische Einflussfaktoren. Dazu gehören die demografische Entwicklung in Deutschland, die ökonomische Situation der gesetzlichen Krankenversicherung, die Einführung des morbiditätsorientierten Risikostrukturausgleichs und des Wettbewerbs zwischen den Krankenkassen, die Einführung der DRGs, Disease-Management-Programme, der Grundsatz „Ambulant vor stationär“, die zunehmende Patientensouveränität und der medizinisch-technische Fortschritt.
Wie wird die Rolle der Pflege in der integrierten Versorgung betrachtet?
Die Arbeit untersucht die Rolle der Pflege in Modellen der integrierten Versorgung umfassend. Es werden die integrierenden Kompetenzen der Pflege, Faktoren, die die Einbindung der Pflege erschweren, und die Perspektiven für die Pflege in der integrierten Versorgung beleuchtet. Beispiele für die Rolle der Pflege werden in den Analysen der ausgewählten Modelle detailliert dargestellt (z.B. „IV-Fachkraft“ als Case-Manager).
Welche Aspekte der Patientenversorgung werden untersucht?
Die Arbeit analysiert die Auswirkungen der integrierten Versorgung auf die Qualität der Leistungen, den Datenfluss und den Datenschutz, sowie die Patientenzufriedenheit. Diese Aspekte werden sowohl allgemein als auch im Kontext der einzelnen untersuchten Modelle beleuchtet.
Wie werden die Kosten der integrierten Versorgung betrachtet?
Die Arbeit analysiert die Auswirkungen der integrierten Versorgung auf die Kostensituation bei den Krankenkassen und die finanziellen Konsequenzen für die Krankenhäuser. Die Kosten werden sowohl allgemein als auch im Kontext der einzelnen untersuchten Modelle untersucht.
Welche Hypothesen werden in der Arbeit geprüft?
Die Arbeit formuliert Hypothesen zu den Auswirkungen der integrierten Versorgung auf die Qualität der Patientenversorgung, die Patientenzufriedenheit, die Kostensituation und die Perspektiven für die Pflege. Diese Hypothesen werden im Laufe der Arbeit anhand der Analysen der ausgewählten Modelle überprüft.
Welche Schlussfolgerungen zieht die Arbeit?
Die Arbeit zieht Schlussfolgerungen zur Effektivität und Effizienz der integrierten Versorgung, zu den Herausforderungen und Chancen für Krankenhäuser und Pflegeeinrichtungen und zu den Perspektiven für die Pflege im Kontext der integrierten Versorgung. Eine kritische Bewertung der analysierten Modelle und des Gesamtsystems bildet den Abschluss der Arbeit.
Details
- Titel
- Integrierte Versorgung. Analyse ausgewählter Modelle unter besonderer Berücksichtigung der Perspektive des Krankenhauses und der Pflege
- Hochschule
- Hochschule Ludwigshafen am Rhein
- Note
- sehr gut (1,3)
- Autor
- Silja Tenzer (Autor:in)
- Erscheinungsjahr
- 2004
- Seiten
- 70
- Katalognummer
- V40201
- ISBN (eBook)
- 9783638387743
- Dateigröße
- 728 KB
- Sprache
- Deutsch
- Schlagworte
- Integrierte Versorgung Analyse Modelle Berücksichtigung Perspektive Krankenhauses Pflege
- Produktsicherheit
- GRIN Publishing GmbH
- Preis (Ebook)
- US$ 31,99
- Arbeit zitieren
- Silja Tenzer (Autor:in), 2004, Integrierte Versorgung. Analyse ausgewählter Modelle unter besonderer Berücksichtigung der Perspektive des Krankenhauses und der Pflege, München, Page::Imprint:: GRINVerlagOHG, https://www.diplomarbeiten24.de/document/40201
- Autor werden
- Ihre Optionen
- Vertriebskanäle
- Premium Services
- Autorenprofil
- Textarten und Formate
- Services für Verlage, Hochschulen, Unternehmen

- © GRIN Publishing GmbH.
- Alle Inhalte urheberrechtlich geschützt. Kopieren und verbreiten untersagt.
- info@grin.com
- AGB
- Open Publishing
Der GRIN Verlag hat sich seit 1998 auf die Veröffentlichung akademischer eBooks und Bücher spezialisiert. Der GRIN Verlag steht damit als erstes Unternehmen für User Generated Quality Content. Die Verlagsseiten GRIN.com, Hausarbeiten.de und Diplomarbeiten24 bieten für Hochschullehrer, Absolventen und Studenten die ideale Plattform, wissenschaftliche Texte wie Hausarbeiten, Referate, Bachelorarbeiten, Masterarbeiten, Diplomarbeiten, Dissertationen und wissenschaftliche Aufsätze einem breiten Publikum zu präsentieren.
Kostenfreie Veröffentlichung: Hausarbeit, Bachelorarbeit, Diplomarbeit, Dissertation, Masterarbeit, Interpretation oder Referat jetzt veröffentlichen!
- GRIN Verlag GmbH
-
- Nymphenburger Str. 86
- 80636
- Munich, Deutschland
- +49 89-550559-0
- +49 89-550559-10
- info@grin.com
-