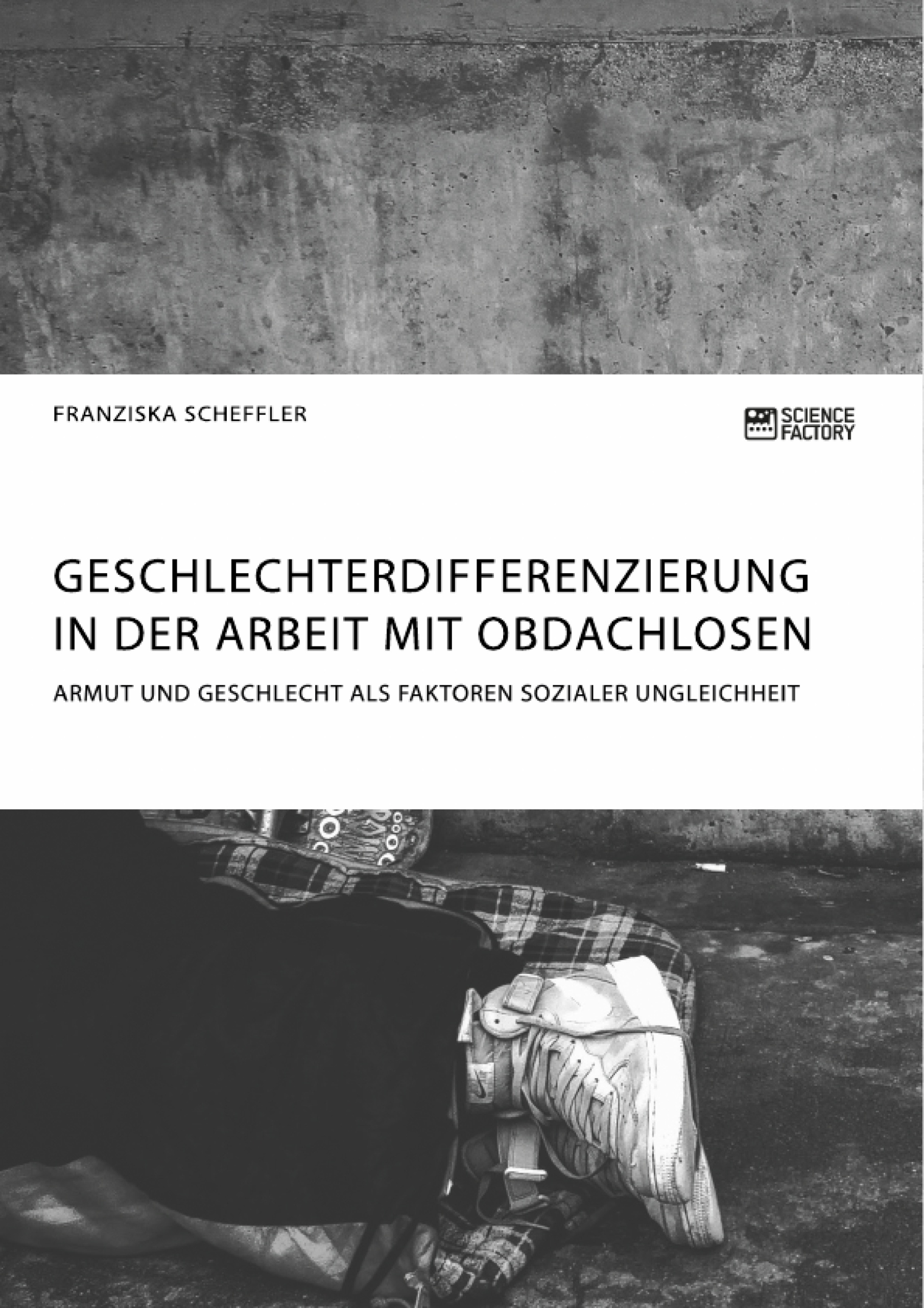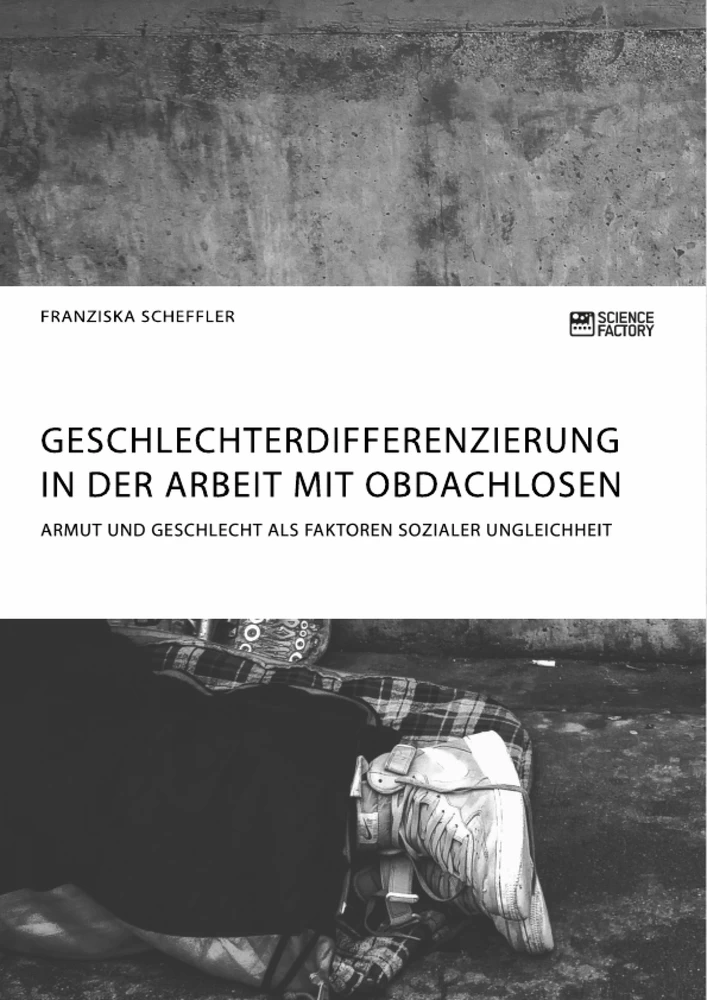
Geschlechterdifferenzierung in der Arbeit mit Obdachlosen. Armut und Geschlecht als Faktoren sozialer Ungleichheit
Bachelorarbeit, 2017
45 Seiten, Note: 1,3
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Einführung in die Gender-Debatte
- Gender, Geschlecht - Begrifflichkeiten und aktuelle Diskussion
- Geschlechterdifferenzierung in der Sozialen Arbeit
- Obdachlosigkeit im Kontext Sozialer Arbeit
- Armut, Wohnungslosigkeit, Obdachlosigkeit? – Eine Einführung
- Die Entwicklung von Armut und Obdachlosigkeit in Deutschland ab 1970
- Ursachen und Folgen von Armut und Obdachlosigkeit im deutschen Sozialstaat
- Obdachlosigkeit heute und die Aufgaben der Sozialen Arbeit
- Geschlechterdifferenzierung in der Sozialen Arbeit mit Obdachlosen
- Ist Geschlechterdifferenzierung zum Thema Obdachlosigkeit notwendig? – eine statistische Analyse
- Weibliche Obdachlosigkeit
- Männliche Obdachlosigkeit nach Fichtner
- Differenzierte Einrichtungen in Deutschland
- Auswirkung auf Personal und Sozialpolitik
- Ausblick auf zukünftige Soziale Arbeit mit Obdachlosigkeit
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit der Frage, wie soziales Geschlecht in der marginalisierten Situation von Obdachlosigkeit im heutigen Sozialstaat gelebt wird und ob eine differenzierende Sozialpolitik in Form von geschlechtersensiblen Einrichtungen und einer entsprechenden Personalaufstellung auf diese Dimension sozialer Ungleichheit reagieren muss.
- Analyse des Einflusses von Gender und Geschlecht auf die Lebensrealität von Obdachlosen
- Untersuchung der Stereotypen von sozialem Geschlecht in der Praxis
- Beschreibung verschiedener Formen und Ursachen von Armut und Obdachlosigkeit in Deutschland
- Spezifische Problemlagen von Frauen in der Obdachlosigkeit
- Umgang von Männern mit der Darstellung ihrer Männlichkeit in der Situation der Obdachlosigkeit
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik der Geschlechterdifferenzierung in der Arbeit mit Obdachlosen ein und zeigt die Relevanz des Themas im Kontext des heutigen Sozialstaates auf. Dabei werden gängige Stereotypen und Vorurteile gegenüber Obdachlosen, insbesondere im Hinblick auf das Geschlecht, beleuchtet.
- Einführung in die Gender-Debatte: Dieses Kapitel liefert grundlegende Informationen zu den Begriffen Gender und Geschlecht und beleuchtet die aktuelle Diskussion um Geschlechterrollen und -bilder in der Gesellschaft. Es wird auf die Bedeutung der Geschlechterdifferenzierung in der Sozialen Arbeit eingegangen.
- Obdachlosigkeit im Kontext Sozialer Arbeit: Dieses Kapitel analysiert die Entwicklung von Armut und Obdachlosigkeit in Deutschland ab 1970. Ursachen und Folgen von Armut und Obdachlosigkeit im deutschen Sozialstaat werden diskutiert, sowie die Aufgaben der Sozialen Arbeit in Bezug auf Obdachlosigkeit beleuchtet.
- Geschlechterdifferenzierung in der Sozialen Arbeit mit Obdachlosen: Dieses Kapitel untersucht die spezifischen Herausforderungen der Geschlechterdifferenzierung im Kontext der Obdachlosigkeit. Es werden statistische Daten zur Analyse der Notwendigkeit einer geschlechterspezifischen Ansprache in der Arbeit mit Obdachlosen herangezogen. Der Fokus liegt auf den besonderen Bedürfnissen von Frauen und dem Umgang von Männern mit ihrer Männlichkeit in der Situation der Obdachlosigkeit.
Schlüsselwörter
Obdachlosigkeit, Geschlechterdifferenzierung, Armut, Soziales Geschlecht, Gender, Gender-Debatte, Soziale Arbeit, Sozialpolitik, Stereotypen, Einrichtungen für Obdachlose, Frauenhäuser, Notunterkünfte, Männerbilder, Frauenbilder, statistische Analyse, Sozialstaat.
Details
- Titel
- Geschlechterdifferenzierung in der Arbeit mit Obdachlosen. Armut und Geschlecht als Faktoren sozialer Ungleichheit
- Hochschule
- Universität Vechta; früher Hochschule Vechta (Soziale Dienstleistungen)
- Note
- 1,3
- Autor
- Franziska Scheffler (Autor:in)
- Erscheinungsjahr
- 2017
- Seiten
- 45
- Katalognummer
- V412374
- ISBN (eBook)
- 9783956873591
- ISBN (Buch)
- 9783956873614
- Dateigröße
- 8212 KB
- Sprache
- Deutsch
- Schlagworte
- Obdachlosigkeit Soziale Arbeit Soziale Ungleichheit Geschlechterrollen Stereotypen Armut
- Produktsicherheit
- GRIN Publishing GmbH
- Preis (Ebook)
- US$ 20,99
- Preis (Book)
- US$ 29,99
- Arbeit zitieren
- Franziska Scheffler (Autor:in), 2017, Geschlechterdifferenzierung in der Arbeit mit Obdachlosen. Armut und Geschlecht als Faktoren sozialer Ungleichheit, München, Page::Imprint:: GRINVerlagOHG, https://www.diplomarbeiten24.de/document/412374
- Autor werden
- Ihre Optionen
- Vertriebskanäle
- Premium Services
- Autorenprofil
- Textarten und Formate
- Services für Verlage, Hochschulen, Unternehmen

- © GRIN Publishing GmbH.
- Alle Inhalte urheberrechtlich geschützt. Kopieren und verbreiten untersagt.
- info@grin.com
- AGB
- Open Publishing
Der GRIN Verlag hat sich seit 1998 auf die Veröffentlichung akademischer eBooks und Bücher spezialisiert. Der GRIN Verlag steht damit als erstes Unternehmen für User Generated Quality Content. Die Verlagsseiten GRIN.com, Hausarbeiten.de und Diplomarbeiten24 bieten für Hochschullehrer, Absolventen und Studenten die ideale Plattform, wissenschaftliche Texte wie Hausarbeiten, Referate, Bachelorarbeiten, Masterarbeiten, Diplomarbeiten, Dissertationen und wissenschaftliche Aufsätze einem breiten Publikum zu präsentieren.
Kostenfreie Veröffentlichung: Hausarbeit, Bachelorarbeit, Diplomarbeit, Dissertation, Masterarbeit, Interpretation oder Referat jetzt veröffentlichen!
- GRIN Verlag GmbH
-
- Nymphenburger Str. 86
- 80636
- Munich, Deutschland
- +49 89-550559-0
- +49 89-550559-10
- info@grin.com
-