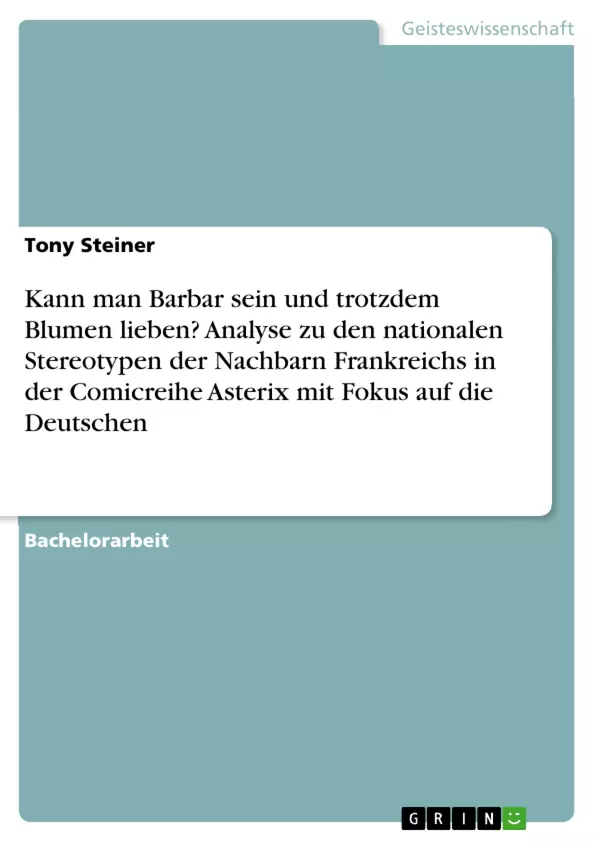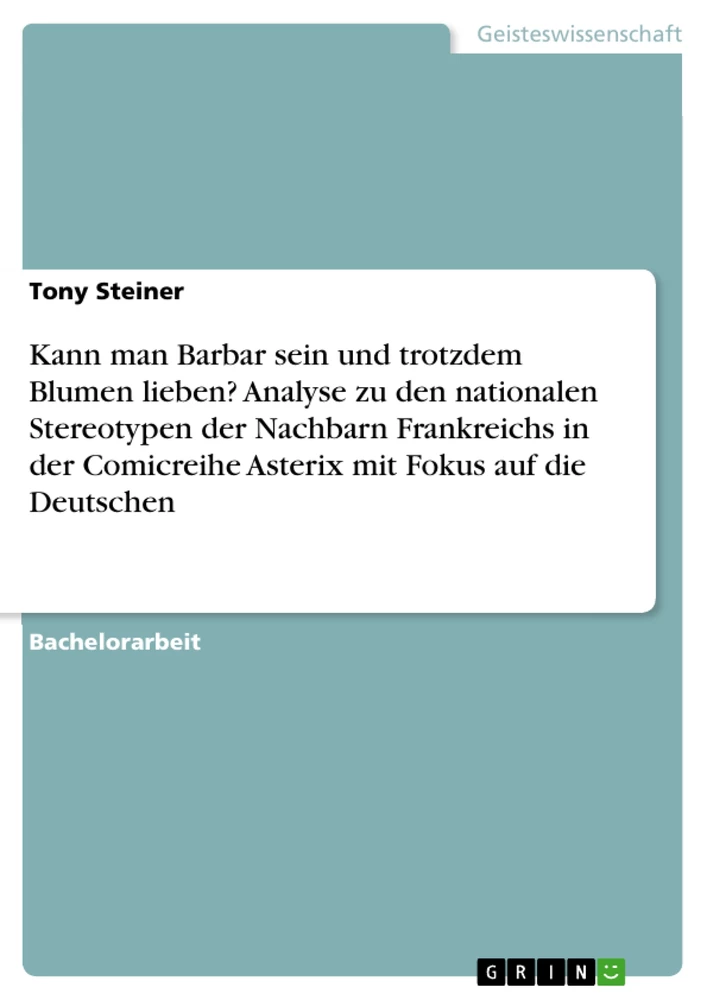
Kann man Barbar sein und trotzdem Blumen lieben? Analyse zu den nationalen Stereotypen der Nachbarn Frankreichs in der Comicreihe Asterix mit Fokus auf die Deutschen
Bachelorarbeit, 2017
36 Seiten, Note: 1
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
- EINLEITUNG
- FORSCHUNGSÜBERBLICK
- 1.1) Stereotyp und Vorurteil
- 1.2) Zur Verbreitung und Aufarbeitung von Stereotypen
- 1.3) Das Stereotyp in Literatur und Wissenschaft
- 1.4) Asterix und die Stereotype
- FORSCHUNGSINTERESSE UND METHODEN
- 2.1) Fragestellung, Hypothese
- 2.2) Beschreibung des Datenkorpus
- 2.3) Methodisches Vorgehen
- ANALYSE
- 3.1) Textebene
- Kategorie I: Sprachliche Eigenheiten
- Kategorie II: Typografie und Zeichensprache
- 3.2) Bildebene
- Kategorie III: Figuren und Charaktere
- Kategorie IV: Gemeinschaftliche Sitten und Bräuche
- RESÜMEE
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Bachelorarbeit untersucht die Darstellung von nationalen Stereotypen in der Comicreihe Asterix, insbesondere in Bezug auf die Deutschen. Dabei wird analysiert, welche Bilder der Deutschen in den Asterix-Geschichten gezeichnet werden und wie diese Bilder im Kontext der französischen Kultur und Geschichte zu interpretieren sind.
- Die Rolle von Stereotypen in der Kultur und Literatur
- Analyse der Darstellung nationaler Stereotype in den Asterix-Geschichten
- Interpretation der Stereotype im Kontext der französischen Geschichte und Kultur
- Die Funktion von Stereotypen in der Konstruktion von Identitäten
- Der Einfluss von Comic-Darstellungen auf die Wahrnehmung anderer Kulturen
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Die Einleitung gibt einen Überblick über die Geschichte des Comics in Deutschland und stellt die Relevanz des Themas dar. Sie erläutert die mangelnde Akzeptanz des Comics in Deutschland und den Erfolg von Asterix. Außerdem wird die Imagologie als Forschungsansatz vorgestellt.
- Forschungsüberblick: In diesem Kapitel wird der Begriff "Stereotyp" definiert und seine Bedeutung in der Kultur und Sozialwissenschaft erläutert. Es werden verschiedene Arten von Stereotypen sowie ihre Auswirkungen auf die Wahrnehmung von Gruppen beschrieben.
- Forschungsinteresse und Methoden: Dieses Kapitel stellt die Fragestellung der Bachelorarbeit vor und erläutert die gewählte Forschungsmethodik. Des Weiteren werden die Daten des Korpus, das heißt die relevanten Asterix-Geschichten, beschrieben.
- Analyse: Das Kapitel "Analyse" untersucht die Darstellung der Deutschen in den Asterix-Geschichten, sowohl auf der Ebene der Sprache als auch der Bilder. Es werden verschiedene Kategorien von Stereotypen identifiziert und deren Funktion und Wirkung analysiert.
Schlüsselwörter
Diese Bachelorarbeit beschäftigt sich mit den Themen Stereotype, Vorurteile, Comic, Asterix, Frankreich, Deutschland, Imagologie, nationale Identität, kulturelle Wahrnehmung und interkulturelle Kommunikation.
Häufig gestellte Fragen
Welche Rolle spielen nationale Stereotype in der Comicreihe Asterix?
In Asterix werden Stereotype genutzt, um mit den Identitäten der Nachbarn der Gallier (wie Briten, Goten oder Spanier) zu spielen. Die Analyse untersucht, wie diese Bilder auf Text- und Bildebene konstruiert werden.
Wie werden die Deutschen (Goten) in Asterix dargestellt?
Die Arbeit fokussiert sich auf die Darstellung der Goten, die besonders im Band „Asterix und die Goten“ (1963) als damaliges Feindbild Frankreichs thematisiert wurden, und untersucht den Wandel dieses Bildes.
Welche Methoden werden zur Analyse der Comics verwendet?
Die Arbeit nutzt den Forschungsansatz der Imagologie, um die Darstellung des „Fremden“ und die Konstruktion nationaler Identitäten wissenschaftlich zu untersuchen.
Was sind typische Merkmale der Nationalitäten in den Asterix-Bänden?
Es werden typische Namen, sprachliche Eigenheiten (Kategorie I), Typografie (Kategorie II) sowie gemeinschaftliche Sitten und Bräuche wie Essen und Sportarten analysiert.
Hat sich das Bild der Deutschen im Laufe der Asterix-Reihe verändert?
Die Untersuchung geht der Frage nach, ob sich das ursprünglich negative Fremdbild der Deutschen über die Jahre hinweg in ein positiveres Bild gewandelt hat.
Details
- Titel
- Kann man Barbar sein und trotzdem Blumen lieben? Analyse zu den nationalen Stereotypen der Nachbarn Frankreichs in der Comicreihe Asterix mit Fokus auf die Deutschen
- Hochschule
- Leopold-Franzens-Universität Innsbruck (Germanistik)
- Veranstaltung
- Interkulturelle Kommunikation
- Note
- 1
- Autor
- Tony Steiner (Autor:in)
- Erscheinungsjahr
- 2017
- Seiten
- 36
- Katalognummer
- V414484
- ISBN (eBook)
- 9783668657038
- ISBN (Buch)
- 9783668657045
- Dateigröße
- 1311 KB
- Sprache
- Deutsch
- Schlagworte
- Asterix Nationale Stereotype Klischees Deutschland Großbritannien Spanien Belgien Schweiz Comicanalyse Goscinny Uderzo Kulturwissenschaft
- Produktsicherheit
- GRIN Publishing GmbH
- Preis (Ebook)
- US$ 16,99
- Preis (Book)
- US$ 18,99
- Arbeit zitieren
- Tony Steiner (Autor:in), 2017, Kann man Barbar sein und trotzdem Blumen lieben? Analyse zu den nationalen Stereotypen der Nachbarn Frankreichs in der Comicreihe Asterix mit Fokus auf die Deutschen, München, Page::Imprint:: GRINVerlagOHG, https://www.diplomarbeiten24.de/document/414484
- Autor werden
- Ihre Optionen
- Vertriebskanäle
- Premium Services
- Autorenprofil
- Textarten und Formate
- Services für Verlage, Hochschulen, Unternehmen

- © GRIN Publishing GmbH.
- Alle Inhalte urheberrechtlich geschützt. Kopieren und verbreiten untersagt.
- info@grin.com
- AGB
- Open Publishing
Der GRIN Verlag hat sich seit 1998 auf die Veröffentlichung akademischer eBooks und Bücher spezialisiert. Der GRIN Verlag steht damit als erstes Unternehmen für User Generated Quality Content. Die Verlagsseiten GRIN.com, Hausarbeiten.de und Diplomarbeiten24 bieten für Hochschullehrer, Absolventen und Studenten die ideale Plattform, wissenschaftliche Texte wie Hausarbeiten, Referate, Bachelorarbeiten, Masterarbeiten, Diplomarbeiten, Dissertationen und wissenschaftliche Aufsätze einem breiten Publikum zu präsentieren.
Kostenfreie Veröffentlichung: Hausarbeit, Bachelorarbeit, Diplomarbeit, Dissertation, Masterarbeit, Interpretation oder Referat jetzt veröffentlichen!
- GRIN Verlag GmbH
-
- Nymphenburger Str. 86
- 80636
- Munich, Deutschland
- +49 89-550559-0
- +49 89-550559-10
- info@grin.com
-