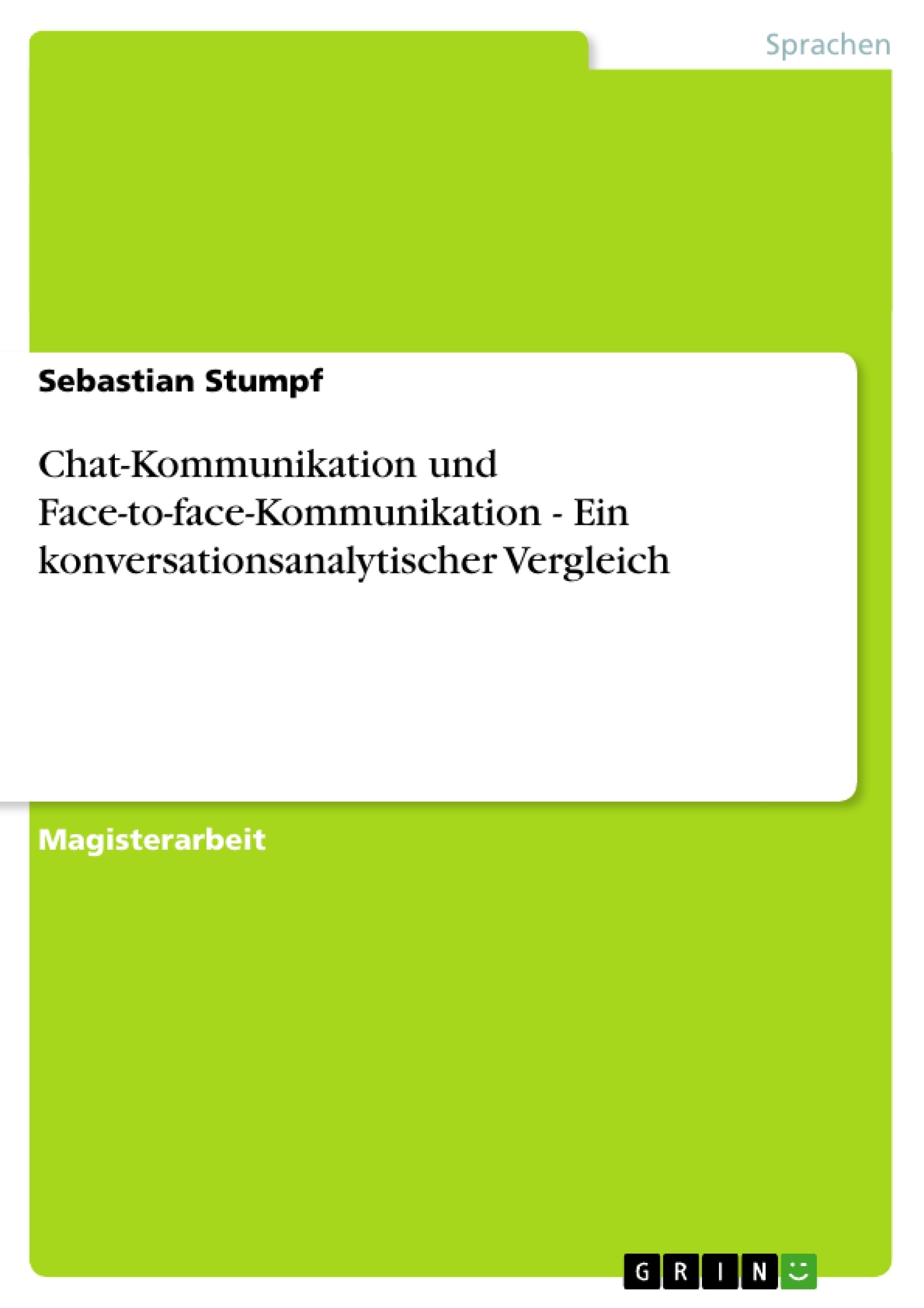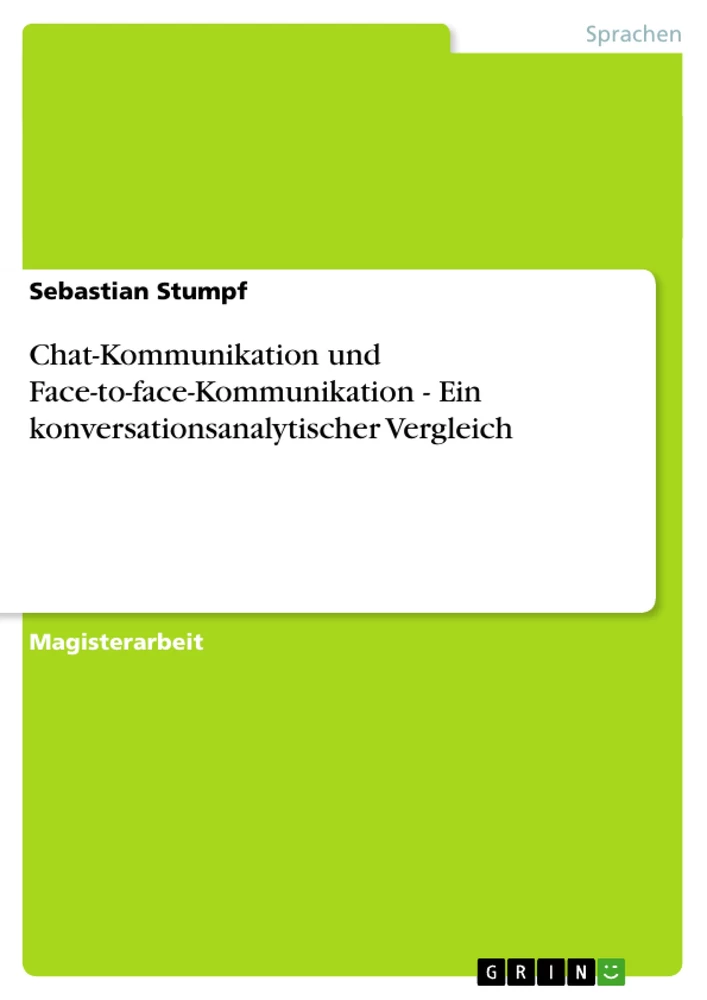
Chat-Kommunikation und Face-to-face-Kommunikation - Ein konversationsanalytischer Vergleich
Magisterarbeit, 2005
58 Seiten, Note: 2,0
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Grundsätzliches zur Chat-Kommunikation
- 2.1 Das Neue an der Chat-Kommunikation
- 2.2 Technische und kommunikative Rahmenbedingungen
- 2.3 Besonderheiten der Chat-Kommunikation
- 2.4 Nicknames
- 3. Zwischen Schriftlichkeit und Mündlichkeit
- 3.1 Elemente konzeptioneller Mündlichkeit in der Chat-Kommunikation
- 3.2 Mediale und konzeptionelle Mündlichkeit bzw. Schriftlichkeit
- 3.3 Einordnung der Chat-Kommunikation
- 4. Unterschiede des Chats zur Face-to-face-Konversation
- 4.1 Gesprächsorganisation
- 4.1.1 Allgemeine Prinzipien der Gesprächsorganisation
- 4.1.2 Sprecherwechsel in Face-to-face-Gesprächen
- 4.1.3 Reparaturprozeduren in Face-to-face-Gesprächen
- 4.1.4 Zur interaktiven Konstruktion von Beiträgen
- 4.1.5 Wichtige Aspekte für die Gesprächsorganisation in der Chat-Kommunikation
- 4.1.6 Sprecherwechsel in der Chat-Kommunikation
- 4.1.6.1 Paarsequenzen in der Chat-Kommunikation
- 4.1.6.2 Turn-taking-Modell oder reines Adressierungsmodell
- 4.1.6.3 Reparaturprozeduren
- 4.1.6.4 Einzelgespräch/ Mehrpersonengespräch
- 4.1.7 Fazit
- 4.2 Darstellung von paralinguistischen und nonverbalen Elementen im Chat
- 4.2.1 Substitutionsmöglichkeiten
- 4.2.1.1 Emoticons
- 4.2.1.2 Zuschreibungs-Turns und infinite Verb-Letzt-Konstruktionen
- 4.2.1.3 Großschreibung
- 4.2.1.4 Buchstaben- und Satzzeichen-Reduplikation
- 4.2.1.5 Abkürzungen und Akronyme
- 4.2.2 Fazit
- 4.2.1 Substitutionsmöglichkeiten
- 4.1 Gesprächsorganisation
- 5. Zusammenfassung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit verfolgt das Ziel, Chat-Kommunikation gesprächsanalytisch zu untersuchen und sie mit Face-to-face-Konversationen zu vergleichen. Die Analyse konzentriert sich auf die Besonderheiten der Chat-Kommunikation im Kontext von Schriftlichkeit und Mündlichkeit, sowie auf die Unterschiede in der Gesprächsorganisation und der Darstellung nonverbaler Elemente.
- Vergleich von Chat- und Face-to-face-Kommunikation
- Analyse der Gesprächsorganisation in Chat-Kommunikation
- Untersuchung der medialen und konzeptionellen Einordnung von Chat-Kommunikation
- Darstellung nonverbaler und paralinguistischer Elemente im Chat
- Bedeutung von Nicknames in der Chat-Kommunikation
Zusammenfassung der Kapitel
2. Grundsätzliches zur Chat-Kommunikation: Dieses Kapitel liefert einen Einblick in die Besonderheiten der Chat-Kommunikation. Es beleuchtet die technischen und kommunikativen Rahmenbedingungen, welche die Interaktion im Chat maßgeblich beeinflussen, und hebt die Neuheit des Chats als genuin schriftliche, simultane Kommunikationsform hervor. Die Bedeutung von Nicknames und die zunehmende Anwendung des Chats in verschiedenen Bereichen, von beruflichen Beratungsgesprächen bis hin zur Freizeitgestaltung, werden ebenfalls diskutiert. Die Anonymität des Mediums und seine Möglichkeiten zur Überwindung von Isolation werden hervorgehoben.
3. Zwischen Schriftlichkeit und Mündlichkeit: Das Kapitel befasst sich mit der Einordnung der Chat-Kommunikation zwischen Schriftlichkeit und Mündlichkeit. Anhand der Forschungsergebnisse von Koch/Oesterreicher (1994) wird die Frage untersucht, ob der Chat als Gespräch oder Text zu klassifizieren ist. Die Analyse konzentriert sich auf die Elemente konzeptioneller Mündlichkeit im Chat und die Beziehung zwischen medialer und konzeptioneller Schriftlichkeit und Mündlichkeit. Die Klärung dieser Fragen bildet die Grundlage für den Vergleich mit Face-to-face-Kommunikation in den nachfolgenden Kapiteln.
4. Unterschiede des Chats zur Face-to-face-Konversation: Der Hauptteil der Arbeit vergleicht die Chat-Kommunikation mit Face-to-face-Gesprächen. Zuerst wird die Gesprächsorganisation in Face-to-face-Konversationen erläutert, wobei das Turn-taking-Modell von Sacks/Schegloff/Jefferson (1974) im Mittelpunkt steht. Anschließend wird die Organisation von Chat-Gesprächen analysiert und die Frage untersucht, inwieweit das Turn-taking-Modell im Chat anwendbar ist. Die Positionen von Lenke und Schmitz (1995) sowie Murray (1989) werden vorgestellt und anhand von Chat-Beispielen evaluiert. Der zweite Teil des Kapitels untersucht die Simulation nonverbalen Verhaltens und paralinguistischer Elemente im Chat mithilfe von Emoticons, Großschreibung, Abkürzungen und anderen Strategien. Die Analyse beleuchtet die Auswirkungen dieser Substitutionsmöglichkeiten auf die Kommunikation.
Schlüsselwörter
Chat-Kommunikation, Face-to-face-Kommunikation, Gesprächsanalyse, Konversationsanalyse, Schriftlichkeit, Mündlichkeit, Gesprächsorganisation, Turn-taking, Nonverbale Kommunikation, Paralinguistik, Emoticons, Nicknames, Internetkommunikation, Medienwandel.
Häufig gestellte Fragen zur Arbeit: Gesprächsanalytische Untersuchung der Chat-Kommunikation
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht die Chat-Kommunikation gesprächsanalytisch und vergleicht sie mit Face-to-face-Konversationen. Der Fokus liegt auf den Besonderheiten der Chat-Kommunikation hinsichtlich Schriftlichkeit und Mündlichkeit sowie auf den Unterschieden in der Gesprächsorganisation und der Darstellung nonverbaler Elemente.
Welche Ziele verfolgt die Arbeit?
Die Arbeit zielt darauf ab, die Chat-Kommunikation zu analysieren und ihre Unterschiede zur Face-to-face-Kommunikation herauszuarbeiten. Konkret werden die Gesprächsorganisation im Chat, die mediale und konzeptionelle Einordnung des Chats, die Darstellung nonverbaler Elemente und die Bedeutung von Nicknames untersucht.
Welche Themen werden im Einzelnen behandelt?
Die Arbeit behandelt folgende Themen: Vergleich von Chat- und Face-to-face-Kommunikation, Analyse der Gesprächsorganisation im Chat, Untersuchung der medialen und konzeptionellen Einordnung von Chat-Kommunikation, Darstellung nonverbaler und paralinguistischer Elemente im Chat, Bedeutung von Nicknames in der Chat-Kommunikation. Die Arbeit geht dabei auch auf die technischen und kommunikativen Rahmenbedingungen des Chats ein.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in fünf Kapitel: Einleitung, Grundsätzliches zur Chat-Kommunikation, Zwischen Schriftlichkeit und Mündlichkeit, Unterschiede des Chats zur Face-to-face-Konversation und Zusammenfassung. Kapitel 4, "Unterschiede des Chats zur Face-to-face-Konversation", ist der umfangreichste Teil und vergleicht detailliert die Gesprächsorganisation und die Darstellung nonverbaler Elemente in beiden Kommunikationsformen.
Welche theoretischen Ansätze werden verwendet?
Die Arbeit bezieht sich auf das Turn-taking-Modell von Sacks/Schegloff/Jefferson (1974) zur Beschreibung der Gesprächsorganisation und auf die Forschungsergebnisse von Koch/Oesterreicher (1994) zur Einordnung von Kommunikation zwischen Schriftlichkeit und Mündlichkeit. Weiterhin werden die Positionen von Lenke und Schmitz (1995) sowie Murray (1989) zur Chat-Kommunikation diskutiert.
Welche konkreten Aspekte der Chat-Kommunikation werden analysiert?
Die Analyse konzentriert sich auf die Gesprächsorganisation (Sprecherwechsel, Reparaturprozeduren), die Darstellung nonverbaler Elemente (Emoticons, Großschreibung, Abkürzungen etc.) und die Einordnung des Chats zwischen Schriftlichkeit und Mündlichkeit. Die Bedeutung von Nicknames wird ebenfalls thematisiert.
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Inhalt der Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Chat-Kommunikation, Face-to-face-Kommunikation, Gesprächsanalyse, Konversationsanalyse, Schriftlichkeit, Mündlichkeit, Gesprächsorganisation, Turn-taking, Nonverbale Kommunikation, Paralinguistik, Emoticons, Nicknames, Internetkommunikation, Medienwandel.
Details
- Titel
- Chat-Kommunikation und Face-to-face-Kommunikation - Ein konversationsanalytischer Vergleich
- Hochschule
- Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf (Geisteswissenschaften)
- Note
- 2,0
- Autor
- Sebastian Stumpf (Autor:in)
- Erscheinungsjahr
- 2005
- Seiten
- 58
- Katalognummer
- V41802
- ISBN (eBook)
- 9783638399937
- Dateigröße
- 653 KB
- Sprache
- Deutsch
- Schlagworte
- Chat-Kommunikation Face-to-face-Kommunikation Vergleich
- Produktsicherheit
- GRIN Publishing GmbH
- Preis (Ebook)
- US$ 19,99
- Arbeit zitieren
- Sebastian Stumpf (Autor:in), 2005, Chat-Kommunikation und Face-to-face-Kommunikation - Ein konversationsanalytischer Vergleich, München, Page::Imprint:: GRINVerlagOHG, https://www.diplomarbeiten24.de/document/41802
- Autor werden
- Ihre Optionen
- Vertriebskanäle
- Premium Services
- Autorenprofil
- Textarten und Formate
- Services für Verlage, Hochschulen, Unternehmen

- © GRIN Publishing GmbH.
- Alle Inhalte urheberrechtlich geschützt. Kopieren und verbreiten untersagt.
- info@grin.com
- AGB
- Open Publishing
Der GRIN Verlag hat sich seit 1998 auf die Veröffentlichung akademischer eBooks und Bücher spezialisiert. Der GRIN Verlag steht damit als erstes Unternehmen für User Generated Quality Content. Die Verlagsseiten GRIN.com, Hausarbeiten.de und Diplomarbeiten24 bieten für Hochschullehrer, Absolventen und Studenten die ideale Plattform, wissenschaftliche Texte wie Hausarbeiten, Referate, Bachelorarbeiten, Masterarbeiten, Diplomarbeiten, Dissertationen und wissenschaftliche Aufsätze einem breiten Publikum zu präsentieren.
Kostenfreie Veröffentlichung: Hausarbeit, Bachelorarbeit, Diplomarbeit, Dissertation, Masterarbeit, Interpretation oder Referat jetzt veröffentlichen!
- GRIN Verlag GmbH
-
- Nymphenburger Str. 86
- 80636
- Munich, Deutschland
- +49 89-550559-0
- +49 89-550559-10
- info@grin.com
-