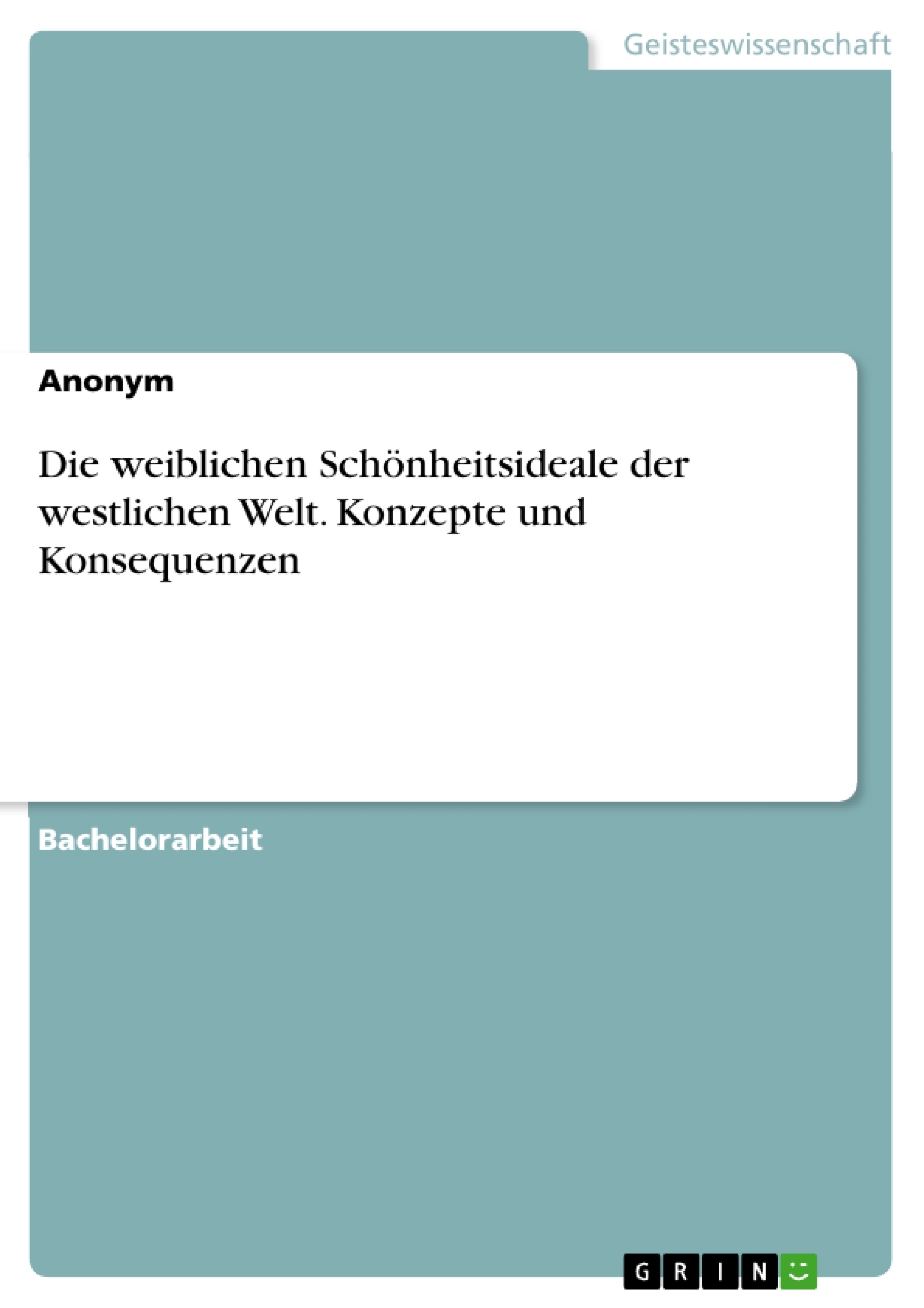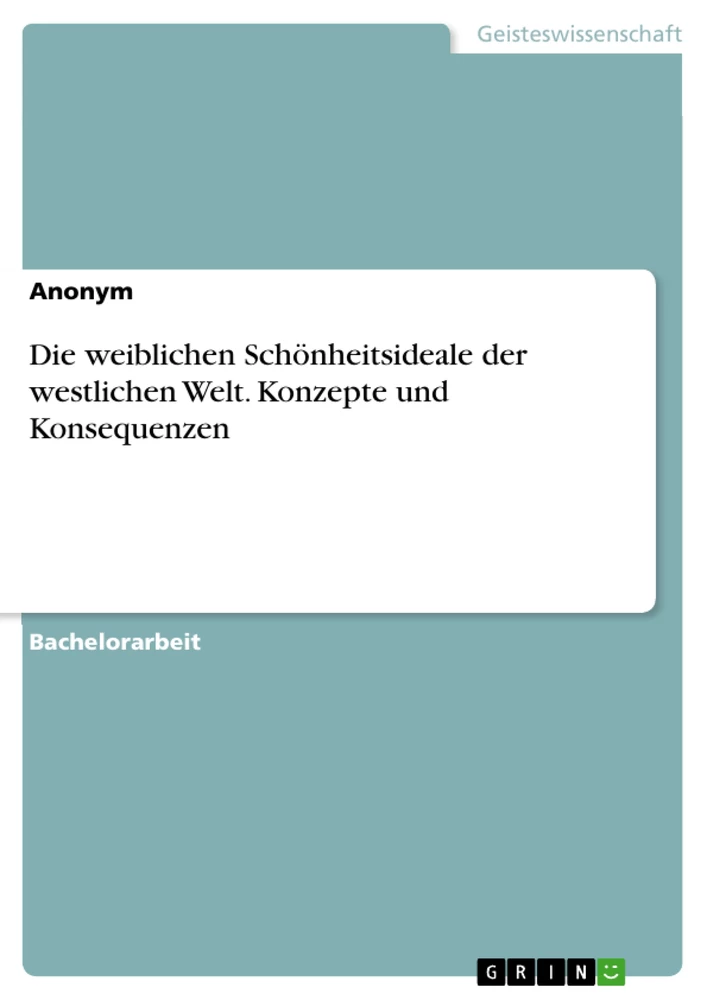
Die weiblichen Schönheitsideale der westlichen Welt. Konzepte und Konsequenzen
Bachelorarbeit, 2014
47 Seiten, Note: 14 (1,0)
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- 1. Forschungsstand und Einordnung der Leitfrage
- 2. Begriffsbestimmungen
- 2.1 Schönheit und Ideal
- 2.2 Schönheitsideal
- 2.3 Zur Formulierung, unterliegen‘
- 3. Westliche Körperkonzepte
- 3.1 Schlank und schlauchförmig
- 3.2 Fit und fettfrei
- 3.3 Jugendlichkeit
- 3.4 Zwischenfazit- Ein Ideal wider die Natur
- 4. Die gesellschaftliche Relevanz von Körperschönheit
- 4.1 Die Bedeutung der weiblichen Schönheit
- 5. Konsequenzen
- 5.1 Körpermodellierung
- 5.2 Der perfekte Körper für alle?
- 5.3 Der Körpermythos der Machbarkeit
- 5.4 Körperunzufriedenheit und Körperunsicherheit
- 5.5 Essstörungen - Anorexie und Bulimie
- 5.6 Globale Homogenisierung von Frauenkörpern
- 6. Fazit
- 6.1 Zusammenfassung und Ausblick
- 6.2 Eigene Stellungnahme
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Bachelorarbeit befasst sich mit dem Phänomen der weiblichen Schönheitsideale in der westlichen Welt und analysiert deren Folgen für Frauen. Die Arbeit untersucht, wie das Schönheitsideal den Frauenkörper prägt und welche Rolle es in der gesellschaftlichen Konstruktion von Weiblichkeit spielt. Darüber hinaus werden die Folgen des Schönheitsdrucks, wie z. B. Körperunzufriedenheit, Essstörungen und die Streben nach einem „perfekten“ Körper, beleuchtet.
- Die gesellschaftliche Konstruktion von Schönheitsidealen
- Der Einfluss von Medien und Kultur auf die Wahrnehmung von Schönheit
- Die Folgen des Schönheitsdrucks für Frauen
- Körperbildstörungen und Essstörungen im Kontext von Schönheitsidealen
- Die Bedeutung des weiblichen Körpers als Kapital im Sinne Bourdieus
Zusammenfassung der Kapitel
Die Arbeit beginnt mit einer Einleitung, die die Relevanz des Themas und die Forschungsfrage einführt. Das erste Kapitel behandelt den aktuellen Forschungsstand und ordnet die Leitfrage in diesen ein. Im zweiten Kapitel werden die Begriffe Schönheit, Ideal und Schönheitsideal sowie die Formulierung „unterliegen“ erläutert. Das dritte Kapitel befasst sich mit den westlichen Körperkonzepten und analysiert, wie das Schönheitsideal insbesondere den Frauenkörper prägt. Das vierte Kapitel untersucht die gesellschaftliche Relevanz von Körperschönheit, insbesondere für Frauen und die Bedeutung des Körpers als Kapital. Das fünfte Kapitel widmet sich den Konsequenzen des Schönheitsdrucks, wie z. B. Körpermodellierung, Essstörungen und Körperunzufriedenheit.
Schlüsselwörter
Die wichtigsten Schlüsselwörter dieser Arbeit sind: Schönheit, Körper, Schönheitsideal, Frauenkörper, Körperbild, Körperkultur, Medien, Gesellschaft, Essstörungen, Körperunzufriedenheit, Bourdieu, Kapital.
Details
- Titel
- Die weiblichen Schönheitsideale der westlichen Welt. Konzepte und Konsequenzen
- Hochschule
- Philipps-Universität Marburg (Institut für Soziologie)
- Note
- 14 (1,0)
- Autor
- Anonym (Autor:in)
- Erscheinungsjahr
- 2014
- Seiten
- 47
- Katalognummer
- V420462
- ISBN (eBook)
- 9783668694088
- ISBN (Buch)
- 9783668694095
- Dateigröße
- 794 KB
- Sprache
- Deutsch
- Schlagworte
- Körpersoziologie Globalisierung von Schönheit westliche Schönheitsideale Feminismus Körper als Sozialkapital (Bourdieu) Frau weibliche Schönheit Normierung der Körper gesellschaftlicher Schönheitsdruck Pierre Bourdieu Gender
- Produktsicherheit
- GRIN Publishing GmbH
- Preis (Ebook)
- US$ 20,99
- Preis (Book)
- US$ 29,99
- Arbeit zitieren
- Anonym (Autor:in), 2014, Die weiblichen Schönheitsideale der westlichen Welt. Konzepte und Konsequenzen, München, Page::Imprint:: GRINVerlagOHG, https://www.diplomarbeiten24.de/document/420462
- Autor werden
- Ihre Optionen
- Vertriebskanäle
- Premium Services
- Autorenprofil
- Textarten und Formate
- Services für Verlage, Hochschulen, Unternehmen

- © GRIN Publishing GmbH.
- Alle Inhalte urheberrechtlich geschützt. Kopieren und verbreiten untersagt.
- info@grin.com
- AGB
- Open Publishing
Der GRIN Verlag hat sich seit 1998 auf die Veröffentlichung akademischer eBooks und Bücher spezialisiert. Der GRIN Verlag steht damit als erstes Unternehmen für User Generated Quality Content. Die Verlagsseiten GRIN.com, Hausarbeiten.de und Diplomarbeiten24 bieten für Hochschullehrer, Absolventen und Studenten die ideale Plattform, wissenschaftliche Texte wie Hausarbeiten, Referate, Bachelorarbeiten, Masterarbeiten, Diplomarbeiten, Dissertationen und wissenschaftliche Aufsätze einem breiten Publikum zu präsentieren.
Kostenfreie Veröffentlichung: Hausarbeit, Bachelorarbeit, Diplomarbeit, Dissertation, Masterarbeit, Interpretation oder Referat jetzt veröffentlichen!
- GRIN Verlag GmbH
-
- Nymphenburger Str. 86
- 80636
- Munich, Deutschland
- +49 89-550559-0
- +49 89-550559-10
- info@grin.com
-