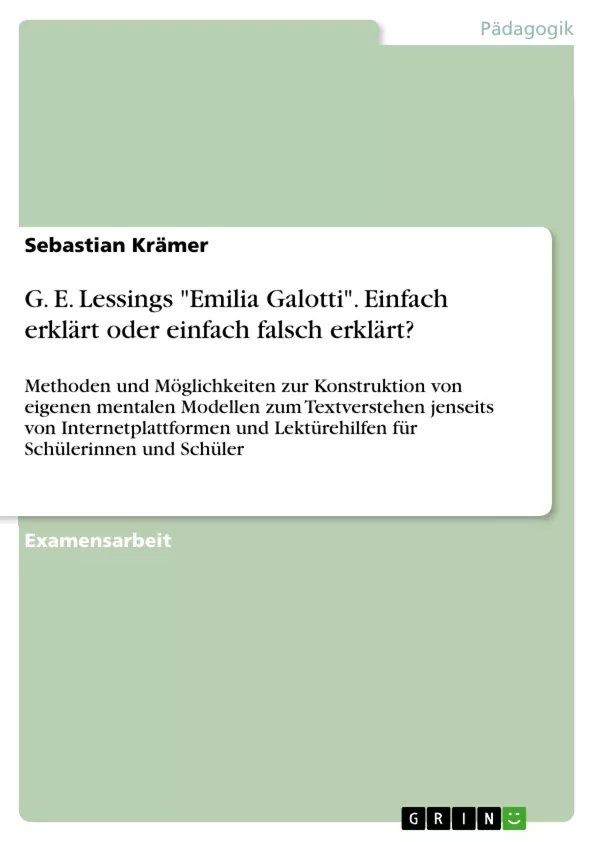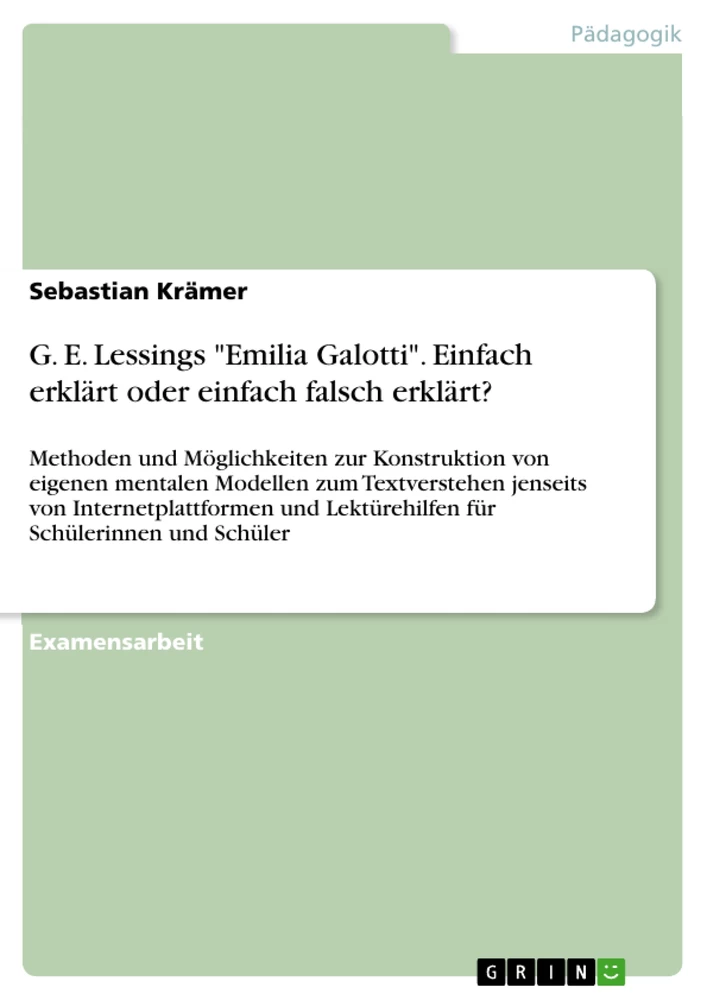
G. E. Lessings "Emilia Galotti". Einfach erklärt oder einfach falsch erklärt?
Examensarbeit, 2011
42 Seiten, Note: 1,1
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Das Lesekompetenzmodell und Überlegungen zur Dramendidaktik
- 2.1 Das Lesekompetenzmodell und die Lesestufen nach DESI
- 2.2 Überlegungen zur Dramendidaktik
- 3. Problemaufriss
- 3.1 Problembezogene Lerngruppenbeschreibung
- 3.2. Dokumentation der Ausgangslage anhand des Fragebogens
- 3.3 Dokumentation der Ausgangslage anhand einer Klausuraufgabe
- 3.4 Auswirkungen und Probleme von Lektürehilfen
- 3.5 Lehrplanangaben für die Jahrgangsstufe 11
- 4. Dokumentation der Durchführung
- 4.1 Einbettung der Kurzeinheit
- 4.2 Exemplarische Dokumentation einer Einzelstunde
- 4.3 Vorüberlegungen und Durchführung des Inszenierungsvergleichs
- 4.3.1 Michael Thalheimers Inszenierung
- 4.3.2 Martin Hellbergs Inszenierung
- 4.3.3 „Emilia Galotti verständlich“
- 4.4 Weiterarbeit nach dem Filmvergleich
- 5. Reflexion und Evaluation der Kurzeinheit
- 5.1 Evaluation der Unterrichtsstunden
- 5.2 Evaluation anhand der Schülerpräsentationen
- 5.3 Evaluation anhand des Abschlussfragebogens
- 5.4 Von den SuS im Rahmen dieser Einheit erworbene Kompetenzen
- 5.5 Aspekte zur Weiterarbeit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit setzt sich mit den Herausforderungen auseinander, die der Umgang mit Dramen im Deutschunterricht für Schülerinnen und Schüler (SuS) mit Defiziten in der Lesekompetenz darstellt. Ziel ist es, anhand einer konkret durchgeführten Unterrichtseinheit zu einem Ansatz zu gelangen, der produktions- und handlungsorientierte sowie rezeptionsorientierte Aspekte miteinander vereint. Dabei wird die Bedeutung von „mentalen Modellen“ im Textverstehen sowie die Notwendigkeit der kritischen Auseinandersetzung mit Online-Angeboten im Kontext des Deutschunterrichts beleuchtet.
- Entwicklung von „mentalen Modellen“ zum Textverstehen
- Defizite in der Lesekompetenz von SuS
- Kritische Analyse von Lektürehilfen und Online-Angeboten
- Entwicklung eines Unterrichtsansatzes für die Arbeit mit Dramen
- Integration von produktions-, handlungs- und rezeptionsorientierten Methoden
Zusammenfassung der Kapitel
Kapitel 1 beleuchtet die Problematik der Lesekompetenz von SuS und führt anhand von Studienbeispielen die Notwendigkeit eines veränderten Unterrichtsansatzes im Umgang mit Dramen vor Augen. Kapitel 2 setzt sich mit dem Lesekompetenzmodell nach DESI und dessen Anwendung im schulischen Kontext auseinander. Es werden die verschiedenen Lesestufen des Modells sowie die Bedeutung von „mentalen Modellen“ für das Textverstehen erläutert.
Kapitel 3 analysiert die Herausforderungen, die sich im Kontext der Arbeit mit Dramen in einer konkreten Lerngruppe stellen. Es werden die Defizite in der Lesekompetenz der SuS am Beispiel von „Emilia Galotti“ von Lessing diagnostiziert, wobei die Auswirkungen von Lektürehilfen und Online-Angeboten untersucht werden.
Kapitel 4 stellt Lösungsansätze und Fördermaßnahmen für die in Kapitel 3 identifizierten Probleme vor. Es werden exemplarisch Methoden für die Integration von produktions- und handlungsorientierten sowie rezeptionsorientierten Aspekten im Unterricht vorgestellt.
Schlüsselwörter
Lesekompetenz, Dramenanalyse, „mentales Modell“, Dramendidaktik, Lektürehilfen, Online-Angebote, Schüleraktivierung, produktionsorientiertes Lernen, handlungsorientiertes Lernen, rezeptionsorientiertes Lernen.
Details
- Titel
- G. E. Lessings "Emilia Galotti". Einfach erklärt oder einfach falsch erklärt?
- Untertitel
- Methoden und Möglichkeiten zur Konstruktion von eigenen mentalen Modellen zum Textverstehen jenseits von Internetplattformen und Lektürehilfen für Schülerinnen und Schüler
- Hochschule
- Studienseminar für Gymnasien in Kassel
- Veranstaltung
- Methoden und Medien
- Note
- 1,1
- Autor
- Sebastian Krämer (Autor:in)
- Erscheinungsjahr
- 2011
- Seiten
- 42
- Katalognummer
- V421616
- ISBN (eBook)
- 9783668689879
- ISBN (Buch)
- 9783668689886
- Dateigröße
- 2201 KB
- Sprache
- Deutsch
- Schlagworte
- Emilia Galotti Lessing Methoden Fachdidaktik Lektürehilfen Youtube Thalheimer Mentale Modelle Lesekompetenz DESI Dramendidaktik E-Phase Michael Thalheimer Martin Hellberg Filmvergleich Unterrichtsmodell
- Produktsicherheit
- GRIN Publishing GmbH
- Preis (Ebook)
- US$ 19,99
- Preis (Book)
- US$ 29,99
- Arbeit zitieren
- Sebastian Krämer (Autor:in), 2011, G. E. Lessings "Emilia Galotti". Einfach erklärt oder einfach falsch erklärt?, München, Page::Imprint:: GRINVerlagOHG, https://www.diplomarbeiten24.de/document/421616
- Autor werden
- Ihre Optionen
- Vertriebskanäle
- Premium Services
- Autorenprofil
- Textarten und Formate
- Services für Verlage, Hochschulen, Unternehmen

- © GRIN Publishing GmbH.
- Alle Inhalte urheberrechtlich geschützt. Kopieren und verbreiten untersagt.
- info@grin.com
- AGB
- Open Publishing
Der GRIN Verlag hat sich seit 1998 auf die Veröffentlichung akademischer eBooks und Bücher spezialisiert. Der GRIN Verlag steht damit als erstes Unternehmen für User Generated Quality Content. Die Verlagsseiten GRIN.com, Hausarbeiten.de und Diplomarbeiten24 bieten für Hochschullehrer, Absolventen und Studenten die ideale Plattform, wissenschaftliche Texte wie Hausarbeiten, Referate, Bachelorarbeiten, Masterarbeiten, Diplomarbeiten, Dissertationen und wissenschaftliche Aufsätze einem breiten Publikum zu präsentieren.
Kostenfreie Veröffentlichung: Hausarbeit, Bachelorarbeit, Diplomarbeit, Dissertation, Masterarbeit, Interpretation oder Referat jetzt veröffentlichen!
- GRIN Verlag GmbH
-
- Nymphenburger Str. 86
- 80636
- Munich, Deutschland
- +49 89-550559-0
- +49 89-550559-10
- info@grin.com
-