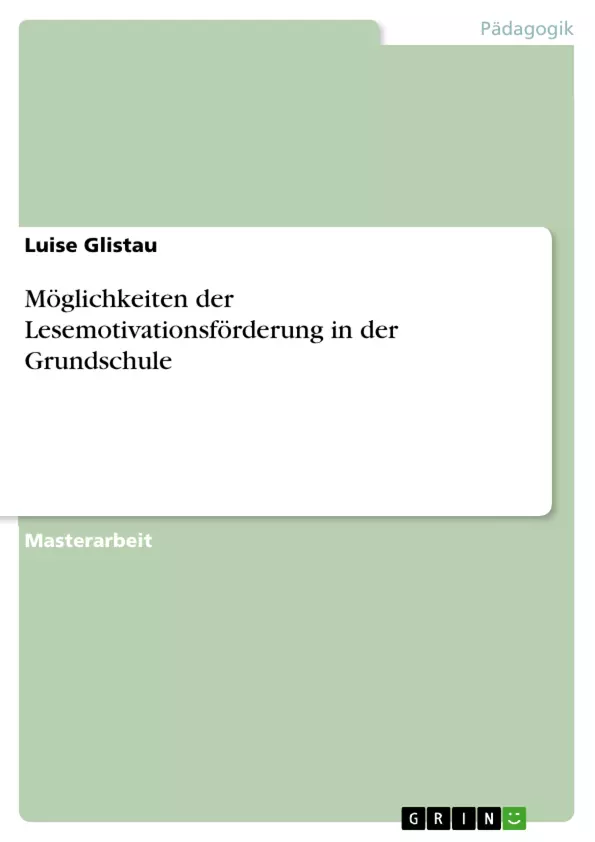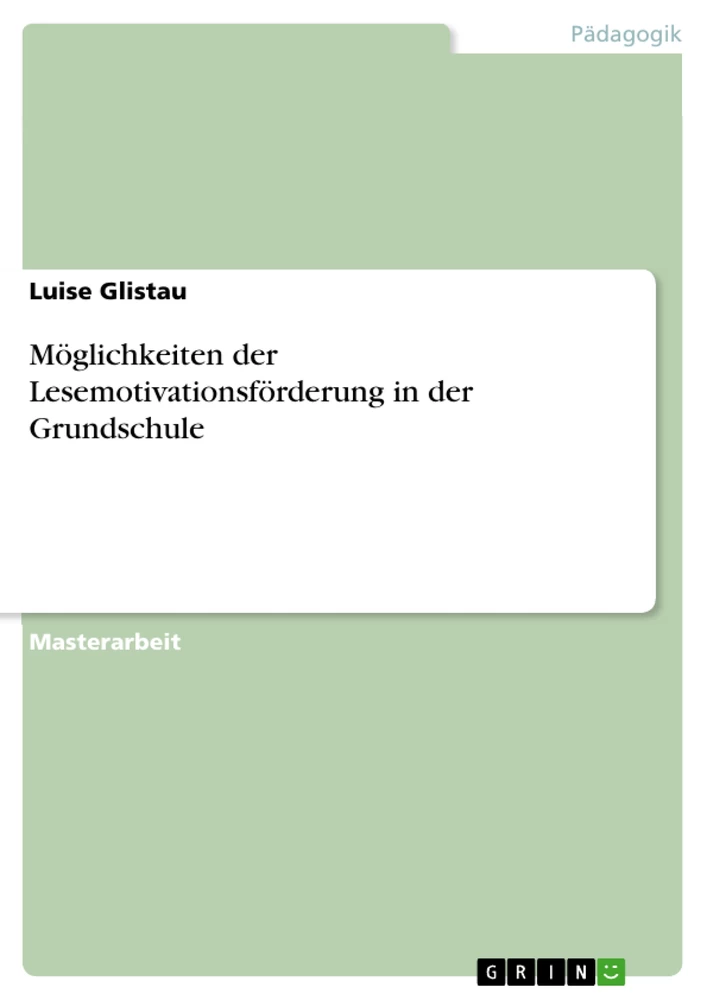
Möglichkeiten der Lesemotivationsförderung in der Grundschule
Masterarbeit, 2015
53 Seiten, Note: 1,3
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Zur Notwendigkeit der Lesemotivationsförderung in der Grundschule
- Terminologische Auseinandersetzung
- Lesefreude, Leseinteresse, Lesemotivation
- Konzepte zur Lesemotivation im Vergleich
- Für die schulische Praxis relevante Erkenntnisse aus Lesemotivationsforschung und Lesedidaktik
- Zur Lesemotivationsstudie von Richter und Plath
- Gestaltung einer gesamtschulischen Lesekultur
- Lesemotivationsförderung im Deutschunterricht
- Aufforderung zum Schmökern
- Offener Leseunterricht
- Auswahl der Unterrichtslektüre
- Praxis des Vorlesens
- Vorlesegespräche und der Einsatz von Bilderbüchern
- Förderung von Anschlusskommunikation
- Entwicklung eines Selbstkonzepts als Leserln
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit der Frage, welche Möglichkeiten sich an Grundschulen zur Realisierung von Leseförderung, speziell Lesemotivationsförderung, anbieten. Im Fokus stehen dabei Erkenntnisse aus der Lesesozialisationsforschung und Lesedidaktik, um die Bedeutung und den Aufbau von Lesemotivation im schulischen Kontext zu verdeutlichen.
- Bedeutung von Lesemotivation in der Grundschule
- Terminologische Abgrenzung und Konzepte zur Lesemotivation
- Schlüsselerkenntnisse aus Lesemotivationsforschung und Lesedidaktik
- Praxisanregungen zur Förderung der Lesemotivation im Deutschunterricht
- Entwicklung eines Selbstkonzepts als Leserln
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Die Einleitung stellt die Bedeutung des Lesens als konstruktiven Akt der Bedeutungszuweisung und seine Relevanz für Bildung und Teilhabe in der Gesellschaft dar. Sie hebt die Rolle der Grundschule in der Leseförderung und Lesesozialisation hervor und kündigt die Auseinandersetzung mit Möglichkeiten der Lesemotivationsförderung an.
- Zur Notwendigkeit der Lesemotivationsförderung in der Grundschule: Dieses Kapitel betont die enge Verknüpfung von Lesenlernen und Lesenwollen. Es erläutert die Bedeutung der Lesesozialisation, die den Prozess der Entwicklung einer stabilen Lesemotivation umfasst.
- Terminologische Auseinandersetzung: Dieses Kapitel beschäftigt sich mit der Begrifflichkeit von Lesefreude, Leseinteresse und Lesemotivation und beleuchtet verschiedene Konzepte zur Lesemotivation im Vergleich.
- Für die schulische Praxis relevante Erkenntnisse aus Lesemotivationsforschung und Lesedidaktik: Dieser Abschnitt widmet sich der Lesemotivationsstudie von Richter und Plath und beleuchtet die Gestaltung einer gesamtschulischen Lesekultur. Anschließend werden konkrete Möglichkeiten zur Lesemotivationsförderung im Deutschunterricht aufgezeigt, wie z.B. die Aufforderung zum Schmökern, der offene Leseunterricht, die Auswahl der Unterrichtslektüre, die Praxis des Vorlesens, Vorlesegespräche, der Einsatz von Bilderbüchern sowie die Förderung von Anschlusskommunikation. Außerdem wird die Bedeutung der Entwicklung eines Selbstkonzepts als Leserln behandelt.
Schlüsselwörter
Die Arbeit beschäftigt sich mit den Themen Lesemotivation, Lesesozialisation, Leseförderung, Grundschule, Deutschunterricht, Lesedidaktik, Schulische Praxis, Selbstkonzept, Kinderliteratur und intrinsische Motivation.
Details
- Titel
- Möglichkeiten der Lesemotivationsförderung in der Grundschule
- Hochschule
- Freie Universität Berlin (Fachbereich Erziehungswissenschaft und Psychologie)
- Note
- 1,3
- Autor
- Luise Glistau (Autor:in)
- Erscheinungsjahr
- 2015
- Seiten
- 53
- Katalognummer
- V421648
- ISBN (eBook)
- 9783668749641
- ISBN (Buch)
- 9783668749658
- Dateigröße
- 760 KB
- Sprache
- Deutsch
- Schlagworte
- Lesemotivation Lesemotivationsförderung Literacy Lesekultur Grundschule Leseunterricht
- Produktsicherheit
- GRIN Publishing GmbH
- Preis (Ebook)
- US$ 19,99
- Preis (Book)
- US$ 29,99
- Arbeit zitieren
- Luise Glistau (Autor:in), 2015, Möglichkeiten der Lesemotivationsförderung in der Grundschule, München, Page::Imprint:: GRINVerlagOHG, https://www.diplomarbeiten24.de/document/421648
- Autor werden
- Ihre Optionen
- Vertriebskanäle
- Premium Services
- Autorenprofil
- Textarten und Formate
- Services für Verlage, Hochschulen, Unternehmen

- © GRIN Publishing GmbH.
- Alle Inhalte urheberrechtlich geschützt. Kopieren und verbreiten untersagt.
- info@grin.com
- AGB
- Open Publishing
Der GRIN Verlag hat sich seit 1998 auf die Veröffentlichung akademischer eBooks und Bücher spezialisiert. Der GRIN Verlag steht damit als erstes Unternehmen für User Generated Quality Content. Die Verlagsseiten GRIN.com, Hausarbeiten.de und Diplomarbeiten24 bieten für Hochschullehrer, Absolventen und Studenten die ideale Plattform, wissenschaftliche Texte wie Hausarbeiten, Referate, Bachelorarbeiten, Masterarbeiten, Diplomarbeiten, Dissertationen und wissenschaftliche Aufsätze einem breiten Publikum zu präsentieren.
Kostenfreie Veröffentlichung: Hausarbeit, Bachelorarbeit, Diplomarbeit, Dissertation, Masterarbeit, Interpretation oder Referat jetzt veröffentlichen!
- GRIN Verlag GmbH
-
- Nymphenburger Str. 86
- 80636
- Munich, Deutschland
- +49 89-550559-0
- +49 89-550559-10
- info@grin.com
-