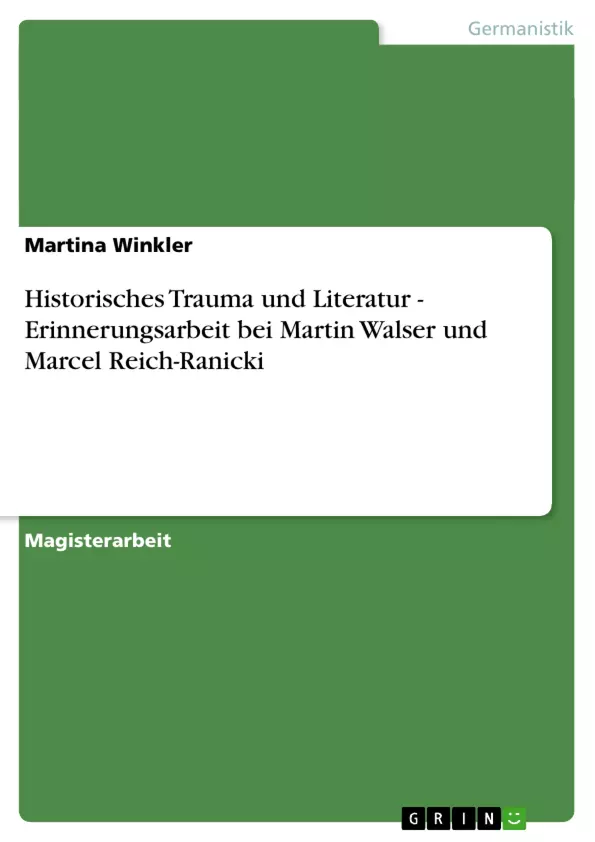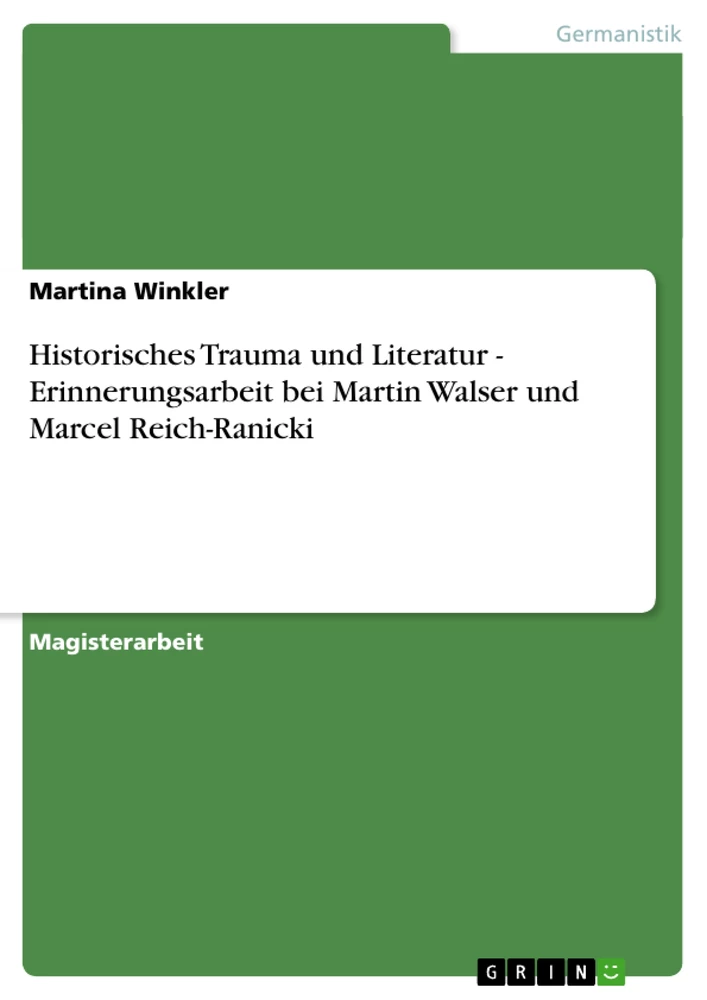
Historisches Trauma und Literatur - Erinnerungsarbeit bei Martin Walser und Marcel Reich-Ranicki
Magisterarbeit, 2005
117 Seiten, Note: 1,3
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Erinnern oder Vergessen – der öffentliche Diskurs um die Erinnerung an die NS-Zeit in Deutschland
- Auswirkungen auf die Bevölkerung - der Holocaust und seine Folgen am Beispiel der Überlebenden des Dritten Reichs
- Die politische Auseinandersetzung
- Auseinandersetzung in der Literatur
- Vor der Wiedervereinigung Deutschlands
- Nach der Wiedervereinigung Deutschlands
- Literarische Werke aus der Zeit zwischen 1990 und 2002
- Bernhard Schlink „Der Vorleser“
- Walter Kempowski „Das Echolot – Barbarossa `41. Ein kollektives Tagebuch.“
- Günter Grass,,Im Krebsgang”
- Martin Walser,,Ein springender Brunnen“ – die (Fehl-)Interpretation und die Debatte um die Dankesrede zum Erhalt des Friedenspreises des Deutschen Buchhandels
- Marcel Reich-Ranicki,,Mein Leben”
- Intention, Aufbau, Sprache
- Die Leitmotive
- Vorgeschichte
- Das Leben als Jude in Deutschland
- Die Liebe zur (deutschen) Literatur
- Der Kritiker und seine Bekenntnisse
- Selbstzweifel, Selbstinszenierungen
- Das,lückenhafte' Gedächtnis
- Martin Walser,,Ein springender Brunnen”
- Aufbau und Perspektive
- Die Macht der Worte
- Lesen und Schreiben
- Johann und der Nationalsozialismus
- Die Leitmotive
- Heimat und Provinz
- Die Sprache als, Mittel zur Selbstfindung'
- Bewusstes Verdrängen ?
- Das Prinzip des Erinnerns
- Verdrängte Erinnerung
- Martin Walser versus Marcel Reich-Ranicki
- Schlussbetrachtung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit beschäftigt sich mit der Auseinandersetzung mit der NS-Zeit im autobiographischen Schreiben. Die Arbeit analysiert die Werke von Martin Walser und Marcel Reich-Ranicki, die beide die NS-Zeit in ihren Werken thematisieren. Die Arbeit untersucht, wie die Autoren mit der Vergangenheit umgehen und welche Rolle die Erinnerung in ihren Werken spielt.
- Der Umgang mit der Vergangenheit im autobiographischen Schreiben
- Die Bedeutung der Erinnerung im Kontext des Holocausts
- Die literarische Auseinandersetzung mit dem Nationalsozialismus
- Der Einfluss des autobiographischen Schreibens auf den öffentlichen Diskurs
- Die Rolle des Kritikers in der Auseinandersetzung mit der Vergangenheit
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel beleuchtet den öffentlichen Diskurs um die Erinnerung an die NS-Zeit in Deutschland. Es werden die Auswirkungen des Holocausts auf die Bevölkerung und die politische Auseinandersetzung mit dem Thema beleuchtet. Das zweite Kapitel beschäftigt sich mit der literarischen Auseinandersetzung mit der NS-Zeit, wobei der Fokus auf der Zeit vor und nach der Wiedervereinigung Deutschlands liegt. In diesem Kapitel werden ausgewählte literarische Werke aus der Zeit zwischen 1990 und 2002 vorgestellt.
Das dritte Kapitel beschäftigt sich mit der Autobiographie „Mein Leben“ von Marcel Reich-Ranicki. Es werden Intention, Aufbau und Sprache des Werkes analysiert, sowie die Leitmotive des Buches, wie Vorgeschichte, das Leben als Jude in Deutschland und die Liebe zur (deutschen) Literatur. Außerdem wird der Kritiker und seine Bekenntnisse, wie Selbstzweifel, Selbstinszenierungen und das ,lückenhafte' Gedächtnis, beleuchtet.
Das vierte Kapitel behandelt den Roman „Ein springender Brunnen“ von Martin Walser. Es werden Aufbau und Perspektive des Werkes analysiert, sowie die Macht der Worte, das Lesen und Schreiben und die Beziehung des Protagonisten Johann zum Nationalsozialismus. Außerdem werden die Leitmotive des Buches, wie Heimat und Provinz und die Sprache als ,Mittel zur Selbstfindung', untersucht.
Das fünfte Kapitel stellt die Werke von Martin Walser und Marcel Reich-Ranicki gegenüber und analysiert die unterschiedlichen Ansätze der Autoren in der Auseinandersetzung mit der NS-Zeit.
Schlüsselwörter
Autobiographie, Erinnerung, Nationalsozialismus, Holocaust, Literatur, Kritiker, Martin Walser, Marcel Reich-Ranicki, „Mein Leben“, „Ein springender Brunnen“
Häufig gestellte Fragen
Wie verarbeiten Martin Walser und Marcel Reich-Ranicki die NS-Zeit?
Beide Autoren nutzen autobiographisches Schreiben zur Erinnerungsarbeit, jedoch mit unterschiedlichen Perspektiven: Reich-Ranicki als jüdischer Überlebender und Walser aus der Sicht der Provinz und Heimat.
Worum geht es in Reich-Ranickis „Mein Leben“?
Das Werk thematisiert seine Kindheit, das Leben als Jude in Deutschland, das Überleben des Holocausts und seine tiefe Liebe zur deutschen Literatur.
Was war die Kontroverse um Martin Walsers Dankesrede?
Seine Rede zum Friedenspreis des Deutschen Buchhandels löste eine Debatte über die Form der Erinnerungskultur und den Vorwurf der Verdrängung aus.
Welche Rolle spielt die Sprache in Walsers „Ein springender Brunnen“?
Sprache dient dem Protagonisten Johann als Mittel zur Selbstfindung und als Werkzeug, um die eigene Vergangenheit poetisch zu fixieren.
Warum ist autobiographisches Schreiben gesellschaftlich wichtig?
Es ermöglicht eine individuelle Auseinandersetzung mit der Geschichte, dient der Bewahrung von Zeugnissen und bietet Lesern Identifikationsmöglichkeiten in unsicheren Zeiten.
Details
- Titel
- Historisches Trauma und Literatur - Erinnerungsarbeit bei Martin Walser und Marcel Reich-Ranicki
- Hochschule
- Universität Duisburg-Essen (Literatur-und Sprachwissenschaft)
- Note
- 1,3
- Autor
- Martina Winkler (Autor:in)
- Erscheinungsjahr
- 2005
- Seiten
- 117
- Katalognummer
- V42696
- ISBN (eBook)
- 9783638406789
- Dateigröße
- 743 KB
- Sprache
- Deutsch
- Anmerkungen
- Die Magisterarbeit befasst sich mit einem Thema, das auch in der heutigen Zeit gerne noch tabuisiert wird - die Erinnerung an den 2. Weltkrieg und die individuellen Schicksale. Die Frage die im Mittelpunkt steht lautet 'Wie gehen die Menschen mit diesem Erlebnissen um?' und wird hier exemplarisch an hand von 2 Literaturgrößen des 20. Jahrhunderts erläutert.
- Schlagworte
- Historisches Trauma Literatur Erinnerungsarbeit Martin Walser Marcel Reich-Ranicki
- Produktsicherheit
- GRIN Publishing GmbH
- Preis (Ebook)
- US$ 39,99
- Arbeit zitieren
- Martina Winkler (Autor:in), 2005, Historisches Trauma und Literatur - Erinnerungsarbeit bei Martin Walser und Marcel Reich-Ranicki, München, Page::Imprint:: GRINVerlagOHG, https://www.diplomarbeiten24.de/document/42696
- Autor werden
- Ihre Optionen
- Vertriebskanäle
- Premium Services
- Autorenprofil
- Textarten und Formate
- Services für Verlage, Hochschulen, Unternehmen

- © GRIN Publishing GmbH.
- Alle Inhalte urheberrechtlich geschützt. Kopieren und verbreiten untersagt.
- info@grin.com
- AGB
- Open Publishing
Der GRIN Verlag hat sich seit 1998 auf die Veröffentlichung akademischer eBooks und Bücher spezialisiert. Der GRIN Verlag steht damit als erstes Unternehmen für User Generated Quality Content. Die Verlagsseiten GRIN.com, Hausarbeiten.de und Diplomarbeiten24 bieten für Hochschullehrer, Absolventen und Studenten die ideale Plattform, wissenschaftliche Texte wie Hausarbeiten, Referate, Bachelorarbeiten, Masterarbeiten, Diplomarbeiten, Dissertationen und wissenschaftliche Aufsätze einem breiten Publikum zu präsentieren.
Kostenfreie Veröffentlichung: Hausarbeit, Bachelorarbeit, Diplomarbeit, Dissertation, Masterarbeit, Interpretation oder Referat jetzt veröffentlichen!
- GRIN Verlag GmbH
-
- Nymphenburger Str. 86
- 80636
- Munich, Deutschland
- +49 89-550559-0
- +49 89-550559-10
- info@grin.com
-