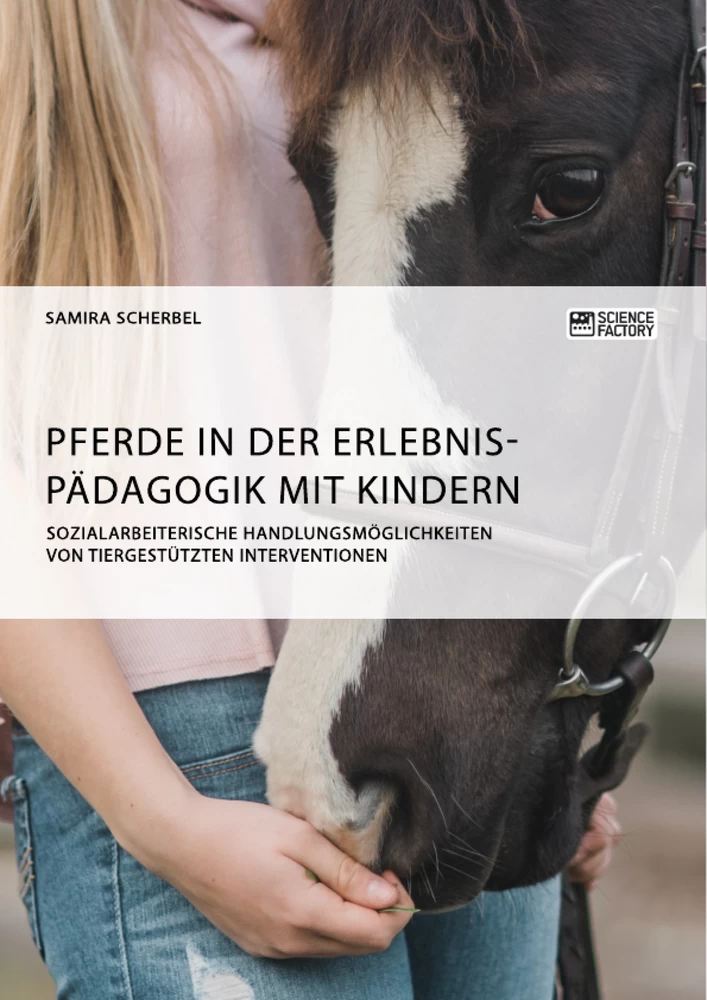
Pferde in der Erlebnispädagogik mit Kindern
Fachbuch, 2018
99 Seiten
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Relevante Theorien, Konzepte, Modelle und Methoden
- Tiergestützte Interventionen
- Theorien zur Begründung der positiven Wirkung der Mensch-Pferd-Beziehungen
- Theoretische Wirkungsmodelle der Erlebnispädagogik
- Fazit
- Die Mensch-Pferd-Beziehung
- Interaktionelle Modelle
- Eignung des Pferdes aufgrund artspezifischer Besonderheiten
- Die „,7 Spiele“ nach Pat Parelli
- Einwirkungsbereich der tiergestützten Interventionen mit dem Pferd
- Fazit
- Sozialarbeiterisch orientierte Erlebnispädagogik mit dem Pferd
- Das Erlebnis
- Praktische Wirkungsmodelle der Erlebnispädagogik
- Empowerment
- Sozialpädagogische Einwirkungsmöglichkeiten des erlebnispädagogischen Einsatzes von Pferden in der Arbeit mit Kindern
- Fazit
- Zusammenfassung
- Erlebnispädagogik als Feld sozialpädagogisch orientierter tiergestützter Interventionen
- Bedeutung für die Soziale Arbeit
- Schlussbetrachtung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Publikation analysiert den Einsatz von Pferden in der Erlebnispädagogik mit Kindern im Kontext der Sozialen Arbeit. Sie beleuchtet die theoretischen Grundlagen von tiergestützten Interventionen, die Besonderheiten der Mensch-Pferd-Beziehung und die spezifischen Wirkungsmechanismen der Erlebnispädagogik mit dem Pferd. Darüber hinaus werden die sozialpädagogischen Einwirkungsmöglichkeiten dieses Ansatzes in der Arbeit mit Kindern und die Bedeutung für die Soziale Arbeit im Allgemeinen untersucht.
- Theoretische Grundlagen tiergestützter Interventionen
- Die Mensch-Pferd-Beziehung und ihre Bedeutung für die pädagogische Arbeit
- Wirkungsmodelle der Erlebnispädagogik mit dem Pferd
- Sozialpädagogische Einwirkungsmöglichkeiten und Anwendungsmöglichkeiten in der Praxis
- Bedeutung für die Soziale Arbeit
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel liefert eine Einleitung in die Thematik der Erlebnispädagogik mit Pferden in der Sozialen Arbeit und skizziert die Relevanz des Themas. Kapitel Zwei beleuchtet die theoretischen Grundlagen von tiergestützten Interventionen, analysiert Theorien zur positiven Wirkung der Mensch-Pferd-Beziehung und stellt relevante Wirkungsmodelle der Erlebnispädagogik vor. Kapitel Drei fokussiert auf die Mensch-Pferd-Beziehung, analysiert interaktionelle Modelle, beleuchtet die Eignung des Pferdes aufgrund artspezifischer Besonderheiten und diskutiert die „,7 Spiele“ nach Pat Parelli. Darüber hinaus wird der Einwirkungsbereich der tiergestützten Interventionen mit dem Pferd untersucht. Kapitel Vier beleuchtet die sozialarbeiterisch orientierte Erlebnispädagogik mit dem Pferd, analysiert das Erlebnis und verschiedene Wirkungsmodelle der Erlebnispädagogik, und befasst sich mit dem Konzept des Empowerments. Schließlich werden die sozialpädagogischen Einwirkungsmöglichkeiten des erlebnispädagogischen Einsatzes von Pferden in der Arbeit mit Kindern dargestellt. Das fünfte und letzte Kapitel fasst die Ergebnisse der Publikation zusammen und reflektiert die Bedeutung der Erlebnispädagogik mit dem Pferd für die Soziale Arbeit.
Schlüsselwörter
Erlebnispädagogik, tiergestützte Interventionen, Mensch-Pferd-Beziehung, soziale Arbeit, Kinder, Empowerment, sozialpädagogische Einwirkungsmöglichkeiten, Praxisbeispiele.
Details
- Titel
- Pferde in der Erlebnispädagogik mit Kindern
- Untertitel
- Sozialarbeiterische Handlungsmöglichkeiten von tiergestützten Interventionen
- Autor
- Samira Scherbel (Autor:in)
- Erscheinungsjahr
- 2018
- Seiten
- 99
- Katalognummer
- V426987
- ISBN (eBook)
- 9783956874116
- ISBN (Buch)
- 9783956874130
- Dateigröße
- 9325 KB
- Sprache
- Deutsch
- Schlagworte
- Interventionen mit dem Pferd Interventionen Pferd Soziale Arbeit Sozialpädagogik Handlungsmöglichkeiten sozialarbeiterische Handlungsmöglichkeiten tiergestützt Erlebnispädagogik Kinder
- Produktsicherheit
- GRIN Publishing GmbH
- Preis (Ebook)
- US$ 39,99
- Preis (Book)
- US$ 50,99
- Arbeit zitieren
- Samira Scherbel (Autor:in), 2018, Pferde in der Erlebnispädagogik mit Kindern, München, Page::Imprint:: GRINVerlagOHG, https://www.diplomarbeiten24.de/document/426987
- Autor werden
- Ihre Optionen
- Vertriebskanäle
- Premium Services
- Autorenprofil
- Textarten und Formate
- Services für Verlage, Hochschulen, Unternehmen

- © GRIN Publishing GmbH.
- Alle Inhalte urheberrechtlich geschützt. Kopieren und verbreiten untersagt.
- info@grin.com
- AGB
- Open Publishing
Der GRIN Verlag hat sich seit 1998 auf die Veröffentlichung akademischer eBooks und Bücher spezialisiert. Der GRIN Verlag steht damit als erstes Unternehmen für User Generated Quality Content. Die Verlagsseiten GRIN.com, Hausarbeiten.de und Diplomarbeiten24 bieten für Hochschullehrer, Absolventen und Studenten die ideale Plattform, wissenschaftliche Texte wie Hausarbeiten, Referate, Bachelorarbeiten, Masterarbeiten, Diplomarbeiten, Dissertationen und wissenschaftliche Aufsätze einem breiten Publikum zu präsentieren.
Kostenfreie Veröffentlichung: Hausarbeit, Bachelorarbeit, Diplomarbeit, Dissertation, Masterarbeit, Interpretation oder Referat jetzt veröffentlichen!
- GRIN Verlag GmbH
-
- Nymphenburger Str. 86
- 80636
- Munich, Deutschland
- +49 89-550559-0
- +49 89-550559-10
- info@grin.com
-









