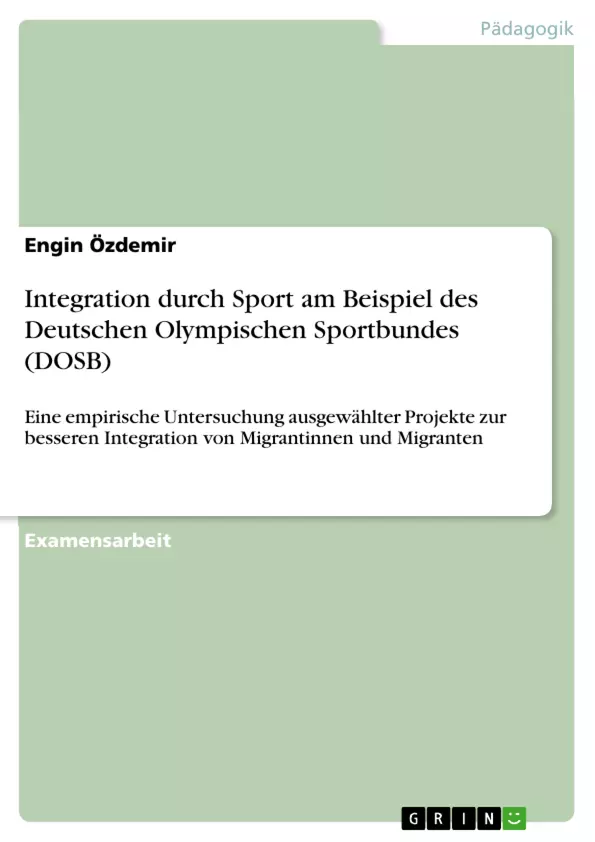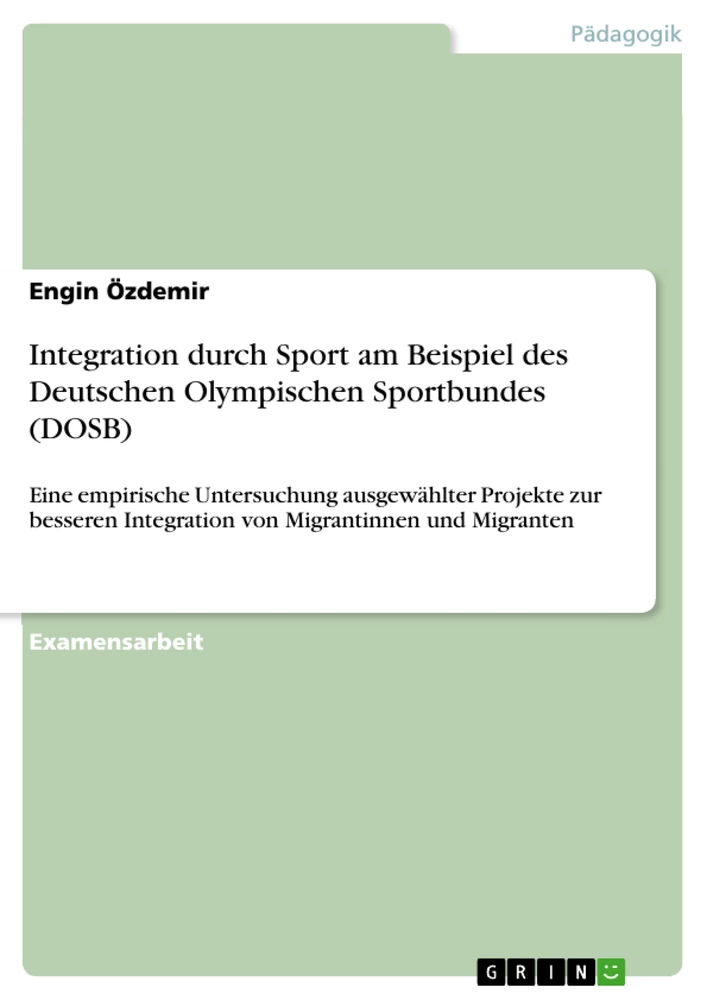
Integration durch Sport am Beispiel des Deutschen Olympischen Sportbundes (DOSB)
Examensarbeit, 2014
69 Seiten, Note: 1,3
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
- 1. EINLEITUNG
- 2. POLITIK, EINWANDERUNG UND INTEGRATION AB DEN 1950.ER-JAHREN
- 2.1. DAS LEBEN IM GASTARBEITERLAND
- 2.2. DIE AUSLÄNDERPÄDAGOGIK: ERSTE REAKTION DER POLITIK
- 2.3. INTERKULTURELLE PÄDAGOGIK – KULTURÜBERGREIFENDES ZUSAMMENLEBEN
- 3. INTEGRATION DURCH SPORT
- 3.1. HINFÜHRUNG ZUM THEMENFELD „INTEGRATION DURCH SPORT“
- 3.2. INTEGRATIONSPOTENZIAL DES ORGANISIERTEN SPORTS
- 3.3. BETEILIGUNG DER MIGRANTEN AM ORGANISIERTEN VEREINSSPORT
- 3.3.1. ANTEIL DER MIGRANTEN AN DEUTSCHEN SPORTVEREINEN
- 3.3.2. DIE ALTERSSTRUKTUR DER VEREINSMITGLIEDER MIT MIGRATIONS-HINTERGRUND
- 3.3.3. ANTEIL DER MIGRANTEN AN DEUTSCHEN SPORTVEREINEN NACH GESCHLECHT
- 3.3.4. DIE AM HÄUFIGSTEN BETRIEBENE SPORTARTEN VON MIGRANTEN
- 3.3.5. EMPIRISCHE BEFUNDE
- 4. DER DEUTSCH OLYMPISCHE SPORTBUND (DOSB)
- 4.1. ZIELGRUPPEN
- 4.2. ZIELE DES PROGRAMMES,,INTEGRATION DURCH SPORT“
- 4.2.1. INTEGRATION ZUM SPORT - GLEICHBErechtigte TeilHABE DER ZIELGRUPPEN AUF ALLEN EBENEN:
- 4.2.2. INTEGRATION DURCH SPORT IN DIE GESELLSCHAFT
- 4.2.3. WEITERE ZIELE DES PROGRAMMS,,INTEGRATION DURCH SPORT“
- 5. ZWISCHENFAZIT
- 6. PROJEKTE IM KINDES- UND JUGENDALTER
- 6.1. PROJEKT,,KOPF UND BALL - DRIBBEL DICH ZU GUTEN NOTEN“
- 6.1.1. PROJEKTBESCHREIBUNG
- 6.1.2. ZIELE DES Projektes „Kopf UND BALL“
- 6.1.3. ZUSAMMENFASSENDE BETRACHTUNG DES PROJEKTS
- 6.2. PROJEKT:,,INTEGRATIONSWOCHE TRIFFT HAGEN“
- 6.2.1. PROJEKTBESCHREIBUNG, INTEGRATIONSWOCHE TRIFFT HAGEN“
- 6.2.2. ZIELE DES PROJEKTES
- 6.2.3. ZUSAMMENFASSENDE BETRACHTUNG DES PROJEKTS
- 7. PROJEKT., AKTIV IM WASSER - MIGRANTINNEN IM SPORT“
- 7.1. PROJEKTBESCHREIBUNG
- 7.2. ZIELE DES PROJEKTES „, AKTIV IM WASSER – MIGRANTINNEN IM SPORT“
- 7.3. THEORETISCHER BEZUGSRAHMEN
- 7.4. GRÜNDE FÜR DIE SCHWACHAUSGEPRÄGTE TEILNAHME VON MIGRANTINNEN AM VEREINSSPORT
- 7.5. ZUSAMMENFASSENDE BETRACHTUNG DES PROJEKTES
- 8. DER VERGLEICH DER PROJEKTE
- 8.1. VEREINSEINRICHTUNG, PROJEKTORT UND -ANBINDUNG
- 8.2. SOZIALE HERKUNFT, RELIGIÖSE UND KULTURELLE ORIENTIERUNG DER TEILNEHMER
- 8.3. PREIS DER PROJEKTTEILNAHME
- 8.4. ANALYSE DER ÜBUNGSLEITER/INNEN
- 8.5. KOMPETENZFÖRDERUNG
- 9. FAZIT UND AUSBLICK
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die wissenschaftliche Hausarbeit analysiert die Integrationsarbeit des Deutschen Olympischen Sportbundes (DOSB) im Kontext von Migrantinnen und Migranten. Die Arbeit untersucht die Chancen des Vereinssports hinsichtlich der Integration von Menschen mit Migrationshintergrund und beleuchtet die Rolle des DOSB bei der Gestaltung und Umsetzung von Integrationsprojekten. Die Arbeit betrachtet die Integrationsarbeit des DOSB im Kontext der erziehungswissenschaftlichen Pädagogik, untersucht die Zielgruppen und die Ziele des DOSB-Programms „Integration durch Sport“ und beleuchtet die praktischen Beispiele von Projekten im Kindes- und Jugendalter.
- Integration durch Sport als pädagogisches Konzept
- Die Rolle des DOSB bei der Integration von Migrantinnen und Migranten
- Projekte des DOSB zur Förderung der Integration durch Sport im Kindes- und Jugendalter
- Herausforderungen und Potenziale der Integration durch Sport
- Zusammenhang von Sport und sozialer Inklusion
Zusammenfassung der Kapitel
Kapitel 1 stellt die Thematik der Integration von Migrantinnen und Migranten in den Fokus und beschreibt die Bedeutung des Sportes als Integrationsfaktor. Kapitel 2 beleuchtet den historischen Kontext der Einwanderung und Integration in Deutschland, beginnend mit der Gastarbeiterbewegung in den 1950er-Jahren. Kapitel 3 diskutiert das integrative Potenzial des organisierten Sports und analysiert die Beteiligungsraten von Migranten am Vereinssport. Kapitel 4 stellt den Deutschen Olympischen Sportbund (DOSB) und sein Programm „Integration durch Sport“ vor, einschließlich der Zielgruppen und Ziele des Programms. Kapitel 5 fasst die Erkenntnisse der vorherigen Kapitel zusammen und bereitet den Weg für die detaillierte Analyse von drei Projekten des DOSB im Kapitel 6. Kapitel 6 analysiert drei konkrete Projekte des DOSB im Kindes- und Jugendalter, die sich mit der Integration von Migrantinnen und Migranten durch Sport beschäftigen. Kapitel 7 widmet sich dem Projekt „Aktiv im Wasser – Migrantinnen im Sport“ und beleuchtet die Gründe für die geringe Teilnahme von Migrantinnen am Vereinssport. Kapitel 8 analysiert und vergleicht die drei vorgestellten Projekte im Hinblick auf verschiedene Aspekte wie die Projektorte, die Zielgruppen und die Kompetenzerweiterung durch Sport. Kapitel 9 fasst die Ergebnisse der Arbeit zusammen und zieht ein Fazit über die Integration durch Sport als Instrument für die Inklusion von Migrantinnen und Migranten in die deutsche Gesellschaft.
Schlüsselwörter
Die Arbeit beschäftigt sich mit den Schlüsselbegriffen Integration, Sport, Migration, Migrantinnen und Migranten, Vereinssport, Deutsche Olympischer Sportbund (DOSB), Integration durch Sport, Inklusion, interkulturelle Bildung, gesellschaftliche Teilhabe, Kindes- und Jugendalter, Projektarbeit und empirische Befunde. Die Arbeit analysiert die Integrationsarbeit des DOSB in diesem Kontext und untersucht die Wirksamkeit von verschiedenen Projekten zur Integration von Migrantinnen und Migranten durch Sport.
Details
- Titel
- Integration durch Sport am Beispiel des Deutschen Olympischen Sportbundes (DOSB)
- Untertitel
- Eine empirische Untersuchung ausgewählter Projekte zur besseren Integration von Migrantinnen und Migranten
- Hochschule
- Justus-Liebig-Universität Gießen
- Note
- 1,3
- Autor
- Engin Özdemir (Autor:in)
- Erscheinungsjahr
- 2014
- Seiten
- 69
- Katalognummer
- V427282
- ISBN (eBook)
- 9783668716551
- ISBN (Buch)
- 9783668716568
- Dateigröße
- 1094 KB
- Sprache
- Deutsch
- Schlagworte
- Integration durch Sport Islam Migration Einwanderer Gastarbeiter Muslime
- Produktsicherheit
- GRIN Publishing GmbH
- Preis (Ebook)
- US$ 31,99
- Preis (Book)
- US$ 45,99
- Arbeit zitieren
- Engin Özdemir (Autor:in), 2014, Integration durch Sport am Beispiel des Deutschen Olympischen Sportbundes (DOSB), München, Page::Imprint:: GRINVerlagOHG, https://www.diplomarbeiten24.de/document/427282
- Autor werden
- Ihre Optionen
- Vertriebskanäle
- Premium Services
- Autorenprofil
- Textarten und Formate
- Services für Verlage, Hochschulen, Unternehmen

- © GRIN Publishing GmbH.
- Alle Inhalte urheberrechtlich geschützt. Kopieren und verbreiten untersagt.
- info@grin.com
- AGB
- Open Publishing
Der GRIN Verlag hat sich seit 1998 auf die Veröffentlichung akademischer eBooks und Bücher spezialisiert. Der GRIN Verlag steht damit als erstes Unternehmen für User Generated Quality Content. Die Verlagsseiten GRIN.com, Hausarbeiten.de und Diplomarbeiten24 bieten für Hochschullehrer, Absolventen und Studenten die ideale Plattform, wissenschaftliche Texte wie Hausarbeiten, Referate, Bachelorarbeiten, Masterarbeiten, Diplomarbeiten, Dissertationen und wissenschaftliche Aufsätze einem breiten Publikum zu präsentieren.
Kostenfreie Veröffentlichung: Hausarbeit, Bachelorarbeit, Diplomarbeit, Dissertation, Masterarbeit, Interpretation oder Referat jetzt veröffentlichen!
- GRIN Verlag GmbH
-
- Nymphenburger Str. 86
- 80636
- Munich, Deutschland
- +49 89-550559-0
- +49 89-550559-10
- info@grin.com
-