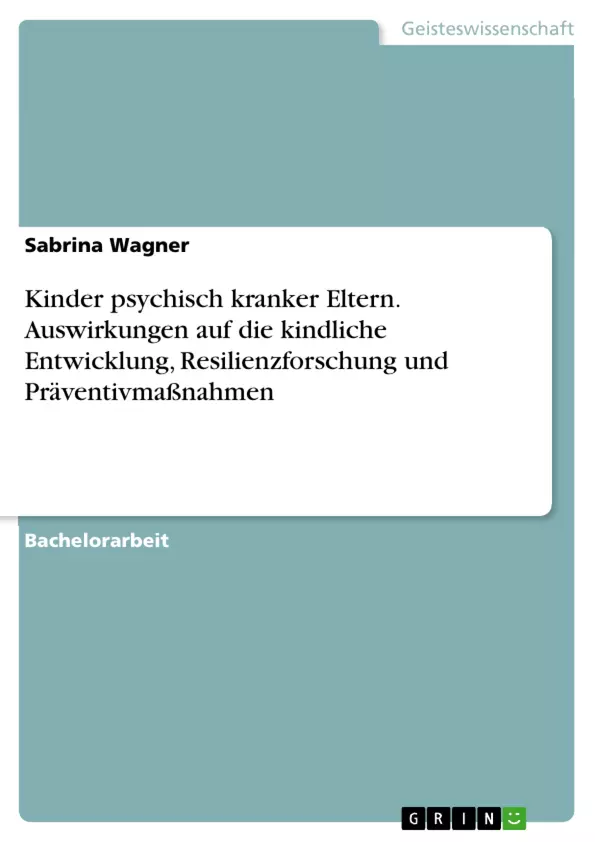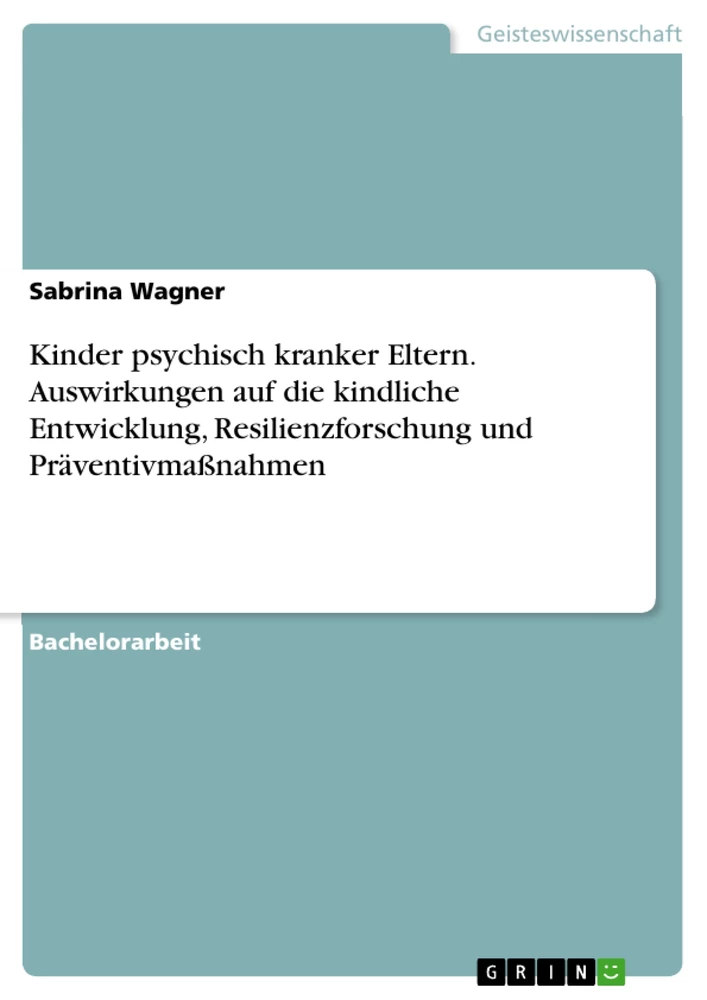
Kinder psychisch kranker Eltern. Auswirkungen auf die kindliche Entwicklung, Resilienzforschung und Präventivmaßnahmen
Bachelorarbeit, 2018
48 Seiten, Note: 1,0
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Forschungsstand
- Die häufigsten psychischen Störungen im Überblick
- Was heißt psychisch krank?
- Angst- und Zwangserkrankungen
- Affektive Störungen
- Borderline – Persönlichkeitsstörung
- Schizophrenie
- Lebenswelt von Kindern psychisch kranker Eltern
- Belastungsanforderungen der Kinder
- Desorientierung
- Auswirkungen auf den familiären Alltag
- Tabuisierung, Isolierung
- Schuldgefühle
- Emotionale Belastungen und Angst
- Der Parentifizierungsprozess
- Allgemeine Risikofaktoren / High-Risk-Forschung
- Genetische Faktoren
- Risikofaktoren der Eltern
- Risikofaktoren der Familie
- Risikofaktoren der Kinder
- Psychosoziale Risikofaktoren
- Spezifische Risikofaktoren
- Risiken von Kindern bei elterlicher Angst-und Zwangsstörung
- Risiken von Kindern affektiv erkrankter Eltern
- Risiken von Kindern bei elterlicher Borderline-Persönlichkeitsstörung
- Risiken von Kindern schizophrener Eltern
- Resilienz der Schutzschirm der Psyche
- Definitionen und Begriffliche Annäherung
- Die „Kauai-Längsschnittstudie“
- Das Schutzfaktorenkonzept
- Persönliche Ressourcen
- Familiäre Ressourcen
- Soziale Ressourcen
- Spezifische Schutzfaktoren für Kinder psychisch kranker Eltern
- Krankheitswissen und Krankheitsverstehen
- Umgang mit der Krankheit in der Familie
- Prävention - Wegweisende Präventivmaßnahmen für Kinder psychisch kranker Eltern und deren Familien
- Prävention: Definitionen und Begriffsbestimmung
- Ebenen der Prävention
- Familienorientierte Prävention – Der CHIMPS (Children of Mentally Ill Parents) Ansatz
- Die Elterngespräche
- Die Kindergespräche
- Die Familiengespräche
- Grenzen des Beratungsangebotes
- AURYN - Gruppen - kindzentrierte Prävention
- Patenschaften
- Resümee
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Bachelorarbeit befasst sich mit den Auswirkungen psychischer Erkrankungen der Eltern auf die kindliche Entwicklung. Im Fokus steht dabei die Resilienzforschung, die untersucht, welche Faktoren Kindern helfen, trotz belastender Erfahrungen psychisch gesund zu bleiben. Die Arbeit soll ein tieferes Verständnis für die Herausforderungen von Kindern psychisch kranker Eltern fördern und mögliche Präventivmaßnahmen aufzeigen.
- Psychische Erkrankungen der Eltern und deren Auswirkungen auf Kinder
- Resilienzfaktoren bei Kindern psychisch kranker Eltern
- Präventive Interventionen für Kinder und Familien
- Die Rolle der Resilienzforschung in der sozialen Arbeit
- Die Bedeutung von Unterstützungssystemen für betroffene Kinder
Zusammenfassung der Kapitel
Die Arbeit beginnt mit einer umfassenden Einführung in das Thema psychische Erkrankungen der Eltern und deren Auswirkungen auf Kinder. Dabei wird ein Überblick über die häufigsten psychischen Störungen gegeben und die Auswirkungen auf die kindliche Entwicklung in verschiedenen Bereichen beleuchtet. Die Kapitel 3 und 4 gehen tiefer auf die Risikofaktoren ein, die Kinder psychisch kranker Eltern in ihrer Entwicklung beeinträchtigen können. Dabei werden sowohl allgemeine als auch spezifische Risikofaktoren, abhängig von der Art der elterlichen Erkrankung, betrachtet. Kapitel 5 widmet sich dem Konzept der Resilienz, welches als Schutzfaktor vor negativen Auswirkungen der belastenden Erfahrungen betrachtet werden kann. Verschiedene Studien und Modelle zur Resilienzforschung werden vorgestellt und wichtige Schutzfaktoren für Kinder psychisch kranker Eltern werden identifiziert. Kapitel 6 beleuchtet verschiedene Präventivmaßnahmen, die Kindern und Familien helfen können, mit den Herausforderungen umzugehen. Es werden verschiedene Ansätze vorgestellt, wie beispielsweise Familienorientierte Prävention, Gruppentherapie und Patenschaften.
Schlüsselwörter
Psychische Erkrankungen, Kinder psychisch kranker Eltern, Entwicklung, Resilienz, Schutzfaktoren, Risikofaktoren, Prävention, Familienorientierte Prävention, Kinderhilfe, Soziale Arbeit, Interventionen
Details
- Titel
- Kinder psychisch kranker Eltern. Auswirkungen auf die kindliche Entwicklung, Resilienzforschung und Präventivmaßnahmen
- Hochschule
- Frankfurt University of Applied Sciences, ehem. Fachhochschule Frankfurt am Main
- Note
- 1,0
- Autor
- Sabrina Wagner (Autor:in)
- Erscheinungsjahr
- 2018
- Seiten
- 48
- Katalognummer
- V434858
- ISBN (eBook)
- 9783668807020
- ISBN (Buch)
- 9783668807037
- Sprache
- Deutsch
- Schlagworte
- kinder eltern auswirkungen entwicklung resilienzforschung präventivmaßnahmen
- Produktsicherheit
- GRIN Publishing GmbH
- Preis (Ebook)
- US$ 20,99
- Preis (Book)
- US$ 29,99
- Arbeit zitieren
- Sabrina Wagner (Autor:in), 2018, Kinder psychisch kranker Eltern. Auswirkungen auf die kindliche Entwicklung, Resilienzforschung und Präventivmaßnahmen, München, Page::Imprint:: GRINVerlagOHG, https://www.diplomarbeiten24.de/document/434858
- Autor werden
- Ihre Optionen
- Vertriebskanäle
- Premium Services
- Autorenprofil
- Textarten und Formate
- Services für Verlage, Hochschulen, Unternehmen

- © GRIN Publishing GmbH.
- Alle Inhalte urheberrechtlich geschützt. Kopieren und verbreiten untersagt.
- info@grin.com
- AGB
- Open Publishing
Der GRIN Verlag hat sich seit 1998 auf die Veröffentlichung akademischer eBooks und Bücher spezialisiert. Der GRIN Verlag steht damit als erstes Unternehmen für User Generated Quality Content. Die Verlagsseiten GRIN.com, Hausarbeiten.de und Diplomarbeiten24 bieten für Hochschullehrer, Absolventen und Studenten die ideale Plattform, wissenschaftliche Texte wie Hausarbeiten, Referate, Bachelorarbeiten, Masterarbeiten, Diplomarbeiten, Dissertationen und wissenschaftliche Aufsätze einem breiten Publikum zu präsentieren.
Kostenfreie Veröffentlichung: Hausarbeit, Bachelorarbeit, Diplomarbeit, Dissertation, Masterarbeit, Interpretation oder Referat jetzt veröffentlichen!
- GRIN Verlag GmbH
-
- Nymphenburger Str. 86
- 80636
- Munich, Deutschland
- +49 89-550559-0
- +49 89-550559-10
- info@grin.com
-