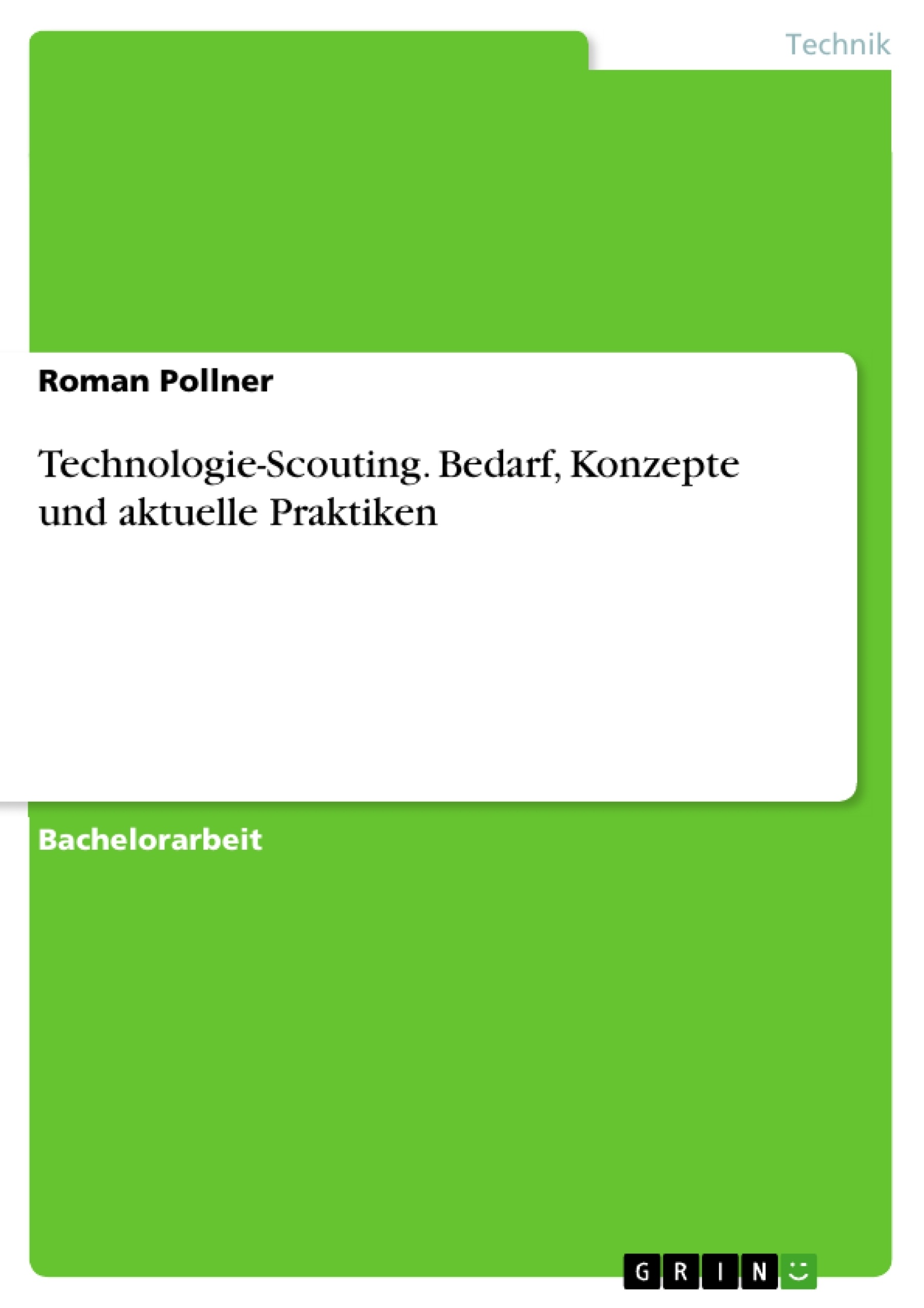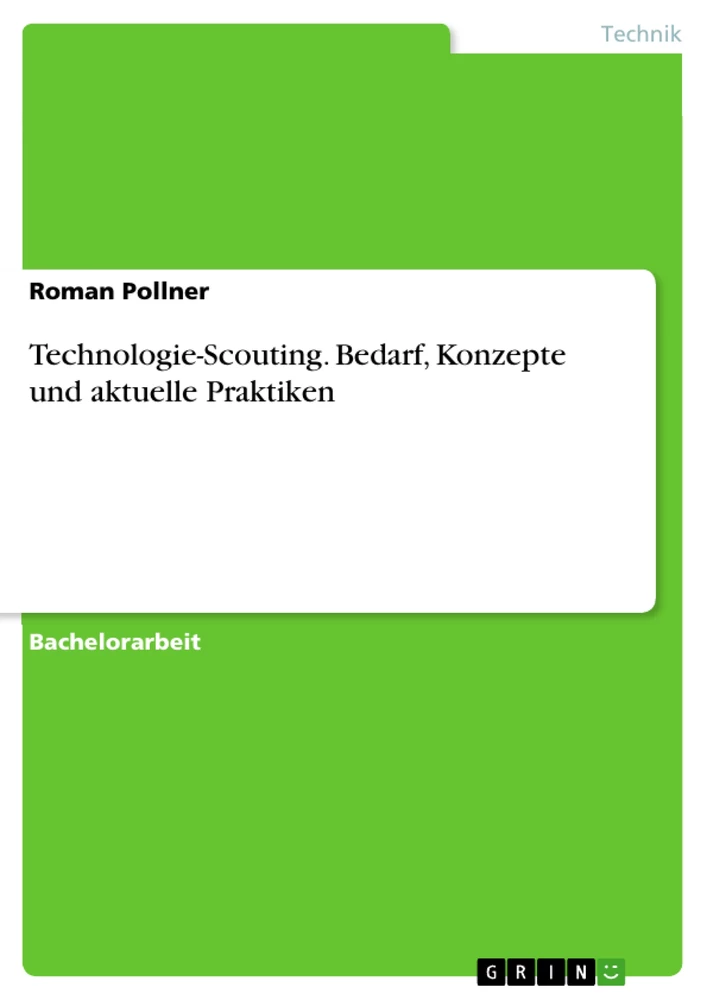
Technologie-Scouting. Bedarf, Konzepte und aktuelle Praktiken
Bachelorarbeit, 2018
46 Seiten, Note: 1,0
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Problemstellung
- Zielsetzung
- Vorgehensweise
- Bedarf von Technologie-Scouting
- Begriffsdefinition Technologie-Scouting
- Grundlegender Bedarf einer hohen Innovationsfähigkeit
- Überblick
- Wettbewerbsvorteile durch Produktinnovationen
- Wettbewerbsvorteile durch Prozessinnovationen
- Beitrag des Technologie-Scoutings zur Verbesserung der Innovationsfähigkeit
- Erhöhung der Innovationskraft durch die Integration von externen Technologien und Ideen
- Entlastung der internen Forschungs- und Entwicklungsabteilungen
- Erkennen und Erschließen von entstehenden Märkten durch das Technologie-Scouting
- Reduktion der Gefahr disruptiver Technologien
- Technologie-Scouting als Bestandteil übergeordneter Konzepte
- Methodik zur Identifizierung relevanter Konzepte und Methoden
- Übergeordnete Konzepte des Technologie-Scoutings
- Technology Intelligence als Bestandteil des Business Intelligence-Konzepts
- Technologie-Scouting als Bestandteil von Open Innovation
- Methoden des Technologie-Scoutings
- Technology Intelligence anhand des Drei-Stufen-Modells
- Technology Landscape Mapping
- Digitales Technologie-Scouting (DTS-Methode)
- Verknüpfung verschiedener Technologie-Scouting-Methoden mit übergeordneten Konzepten
- Abdeckung des Technologie-Scouting-Bedarfs durch die verschiedenen Scouting-Methoden
- Aktuelle Praktiken des Technologie-Scoutings: Das Beispiel der Deutschen Telekom AG
- Überblick
- Ziele des Technologie-Scoutings
- Technologie-Radar-Prozess
- Prozess des Technologie-Radars
- Zentrale Darstellung der Scouting-Ergebnisse
- Beitrag der Technologie-Scouts zur externen Technologiebeschaffung
- Organisation des Scouting-Netzwerkes der Deutschen Telekom AG
- Zusammenfassung und Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Bachelorarbeit untersucht den Bedarf an Technologie-Scouting, beleuchtet verschiedene Konzepte und Methoden des Technologie-Scoutings und analysiert aktuelle Praktiken am Beispiel der Deutschen Telekom AG. Die Arbeit zielt darauf ab, ein tieferes Verständnis für die Rolle des Technologie-Scoutings in der heutigen Innovationslandschaft zu entwickeln.
- Der Bedarf an Technologie-Scouting in Unternehmen
- Verschiedene Konzepte und Methoden des Technologie-Scoutings
- Aktuelle Praktiken des Technologie-Scoutings in der Praxis
- Die Rolle des Technologie-Scoutings bei der Förderung von Innovation
- Die Integration von Technologie-Scouting in die strategische Unternehmensplanung
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt die Problemstellung der Arbeit dar und definiert die Zielsetzung sowie die Vorgehensweise. Das zweite Kapitel beleuchtet den Bedarf an Technologie-Scouting, erläutert die Begriffsdefinition und analysiert den grundlegenden Bedarf einer hohen Innovationsfähigkeit. Dabei werden Wettbewerbsvorteile durch Produkt- und Prozessinnovationen hervorgehoben.
Das dritte Kapitel widmet sich dem Technologie-Scouting als Bestandteil übergeordneter Konzepte. Es werden relevante Konzepte und Methoden identifiziert, darunter Technology Intelligence und Open Innovation. Die Arbeit analysiert verschiedene Methoden des Technologie-Scoutings, wie das Drei-Stufen-Modell, Technology Landscape Mapping und das Digitale Technologie-Scouting. Zudem wird die Verknüpfung von Methoden mit übergeordneten Konzepten sowie die Abdeckung des Bedarfs durch verschiedene Scouting-Methoden beleuchtet.
Im vierten Kapitel werden aktuelle Praktiken des Technologie-Scoutings am Beispiel der Deutschen Telekom AG vorgestellt. Die Arbeit beschreibt die Ziele des Technologie-Scoutings, analysiert den Technologie-Radar-Prozess und zeigt die Organisation des Scouting-Netzwerks auf.
Schlüsselwörter
Technologie-Scouting, Innovation, Technology Intelligence, Business Intelligence, Open Innovation, Drei-Stufen-Modell, Technology Landscape Mapping, Digitales Technologie-Scouting (DTS), Deutsche Telekom AG, Technologie-Radar.
Häufig gestellte Fragen
Was versteht man unter Technologie-Scouting?
Technologie-Scouting ist ein Instrument, mit dem Unternehmen systematisch nach vielversprechenden externen Technologien und Trends suchen, um ihre Innovationskraft zu stärken.
Warum ist Technologie-Scouting heute so wichtig?
Durch Globalisierung, Digitalisierung und verkürzte Produktlebenszyklen müssen Unternehmen externe Wissensquellen nutzen, um nicht von disruptiven Technologien überrascht zu werden.
Welche Methoden des Scoutings werden in der Bachelorarbeit vorgestellt?
Vorgestellt werden unter anderem das Drei-Stufen-Modell, Technology Landscape Mapping und das Digitale Technologie-Scouting (DTS).
Wie setzt die Deutsche Telekom AG Technologie-Scouting um?
Die Telekom nutzt einen speziellen „Technologie-Radar-Prozess“ und ein organisiertes Scouting-Netzwerk, um Trends zentral zu erfassen und zu bewerten.
Was hat Technologie-Scouting mit „Open Innovation“ zu tun?
Es ist ein zentraler Bestandteil des Open-Innovation-Konzepts, bei dem Unternehmensgrenzen für externe Ideen und Technologien geöffnet werden.
Details
- Titel
- Technologie-Scouting. Bedarf, Konzepte und aktuelle Praktiken
- Hochschule
- Hochschule für angewandte Wissenschaften Landshut, ehem. Fachhochschule Landshut
- Note
- 1,0
- Autor
- Roman Pollner (Autor:in)
- Erscheinungsjahr
- 2018
- Seiten
- 46
- Katalognummer
- V435484
- ISBN (eBook)
- 9783668765580
- ISBN (Buch)
- 9783668765597
- Dateigröße
- 1535 KB
- Sprache
- Deutsch
- Schlagworte
- Technologie Scouting Technology Intelligence Open Innovation Technology Scanning Technology Monitoring Business Intelligence Wissensmanagement Technologiemanagement Innovationsmanagement Technology Foresight Technologiefrühaufklärung
- Produktsicherheit
- GRIN Publishing GmbH
- Preis (Ebook)
- US$ 20,99
- Preis (Book)
- US$ 26,99
- Arbeit zitieren
- Roman Pollner (Autor:in), 2018, Technologie-Scouting. Bedarf, Konzepte und aktuelle Praktiken, München, Page::Imprint:: GRINVerlagOHG, https://www.diplomarbeiten24.de/document/435484
- Autor werden
- Ihre Optionen
- Vertriebskanäle
- Premium Services
- Autorenprofil
- Textarten und Formate
- Services für Verlage, Hochschulen, Unternehmen

- © GRIN Publishing GmbH.
- Alle Inhalte urheberrechtlich geschützt. Kopieren und verbreiten untersagt.
- info@grin.com
- AGB
- Open Publishing
Der GRIN Verlag hat sich seit 1998 auf die Veröffentlichung akademischer eBooks und Bücher spezialisiert. Der GRIN Verlag steht damit als erstes Unternehmen für User Generated Quality Content. Die Verlagsseiten GRIN.com, Hausarbeiten.de und Diplomarbeiten24 bieten für Hochschullehrer, Absolventen und Studenten die ideale Plattform, wissenschaftliche Texte wie Hausarbeiten, Referate, Bachelorarbeiten, Masterarbeiten, Diplomarbeiten, Dissertationen und wissenschaftliche Aufsätze einem breiten Publikum zu präsentieren.
Kostenfreie Veröffentlichung: Hausarbeit, Bachelorarbeit, Diplomarbeit, Dissertation, Masterarbeit, Interpretation oder Referat jetzt veröffentlichen!
- GRIN Verlag GmbH
-
- Nymphenburger Str. 86
- 80636
- Munich, Deutschland
- +49 89-550559-0
- +49 89-550559-10
- info@grin.com
-