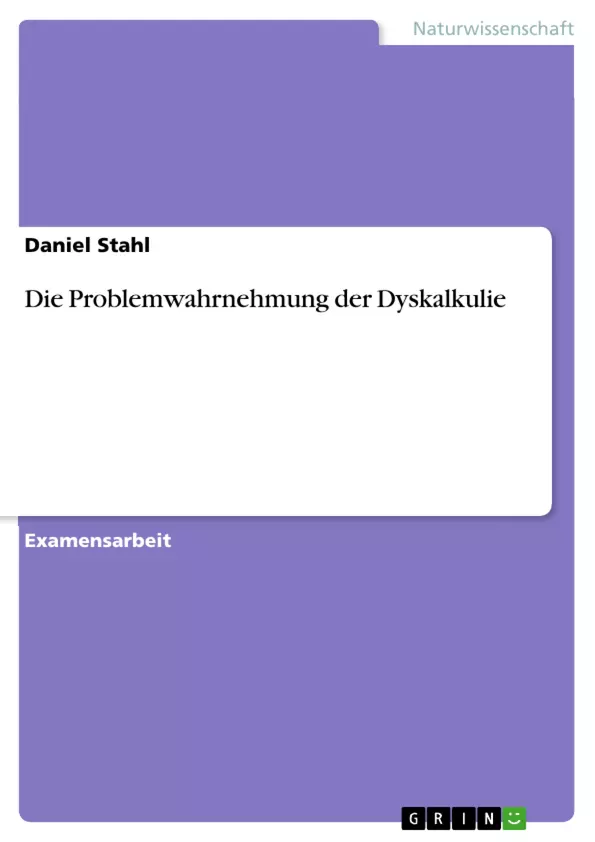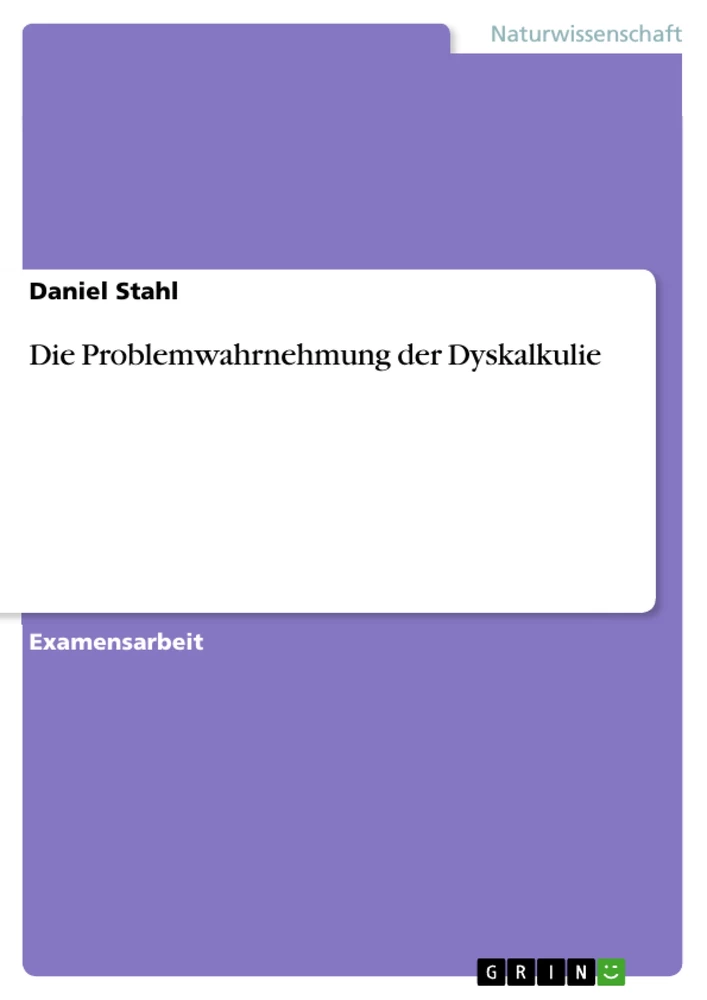
Die Problemwahrnehmung der Dyskalkulie
Examensarbeit, 2016
86 Seiten, Note: 1,0
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
- Teil I: Dyskalkulie aus „objektiver“ Sicht
- Einleitung
- 1. Zum Begriff der „Dyskalkulie“
- 1.1 Definition
- 1.2 Die Kritik an der Diskrepanz-Definition
- 2. Erscheinungsbild
- 2.1 Prävalenz
- 2.2 Symptome
- 3. Zu den Ursachen der Dyskalkulie
- 3.1 Ursachen auf der Ebene des Individuums
- 3.1.1 Neuropsychologischer Ansatz
- 3.1.2 Kognitionspsychologischer Ansatz
- 3.1.3 Entwicklungspsychologischer Ansatz
- 3.1.4 Defizite im Arbeitsgedächtnis
- 3.2 Ursachen auf der Ebene der Lehrperson
- 3.2.1 Fachliche und fachdidaktische Ursachen
- 3.2.2 Lehrer-Schüler-Beziehung
- Teil II: Dyskalkulie aus „subjektiver“ Sicht
- 4. Probleme der Dyskalkulie
- 4.1 Komorbiditäten
- 4.1.1 Lese-Rechtschreibstörung
- 4.1.2 Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung
- 4.2 Psychische Folgeprobleme der Dyskalkulie
- 4.2.1 Emotionale Probleme
- 4.2.2 Prüfungsangst
- 4.2.3 Mathematikangst
- 4.3 Exkurs zur Benachteiligung
- 4.3.1 Schlechte Schulleistungen
- 4.3.2 Auswirkungen auf die Berufschancen
- 5. Fördermöglichkeiten
- 5.1 Innerschulische Förderung
- 5.1.1 Nachteilsausgleich für Dyskalkulie-Schüler
- 5.1.2 Didaktisch-methodische Überlegungen
- 5.1.3 Pädagogische Überlegungen
- 5.2 Außerschulische Förderung
- 5.2.1 Gesetzliche Regelung
- 5.2.2 Außerschulische Diagnose
- 5.2.3 Die Dyskalkulie-Therapie
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Problemwahrnehmung von Dyskalkulie, indem sie sowohl die „objektive“ Sicht (Definition, Ursachen, Erscheinungsbild) als auch die „subjektive“ Sicht (Folgeprobleme, Fördermöglichkeiten) beleuchtet. Das Ziel ist es, ein umfassenderes Verständnis der Herausforderungen für betroffene Schüler und die damit verbundenen pädagogischen Implikationen zu entwickeln.
- Definition und Kritik an der Definition von Dyskalkulie
- Ursachen der Dyskalkulie auf individueller und pädagogischer Ebene
- Psychosoziale Folgeprobleme von Dyskalkulie
- Innerschulische und außerschulische Fördermöglichkeiten
- Benachteiligung durch Dyskalkulie
Zusammenfassung der Kapitel
Teil I: Dyskalkulie aus „objektiver“ Sicht: Dieser Teil legt den Grundstein, indem er den Begriff der Dyskalkulie definiert und verschiedene Definitionsansätze kritisch beleuchtet. Er beschreibt das Erscheinungsbild der Dyskalkulie, einschließlich der Prävalenz und der typischen Symptome. Ein wichtiger Schwerpunkt liegt auf den Ursachen, die sowohl auf der Ebene des Individuums (neuropsychologische, kognitionspsychologische und entwicklungspsychologische Ansätze) als auch auf der Ebene der Lehrperson (fachliche und didaktische Faktoren, Lehrer-Schüler-Beziehung) betrachtet werden. Die Kapitel liefern ein fundiertes Verständnis der „objektiven“ Facetten der Dyskalkulie.
Teil II: Dyskalkulie aus „subjektiver“ Sicht: Im zweiten Teil rückt die subjektive Erfahrung von Dyskalkulie in den Mittelpunkt. Hier werden die vielfältigen Probleme beleuchtet, die mit einer Dyskalkulie einhergehen können, wie z.B. Komorbiditäten (Lese-Rechtschreibstörung, ADHS), psychische Folgeprobleme (emotionale Probleme, Prüfungsangst, Mathematikangst) und die daraus resultierende Benachteiligung in Schule und Beruf. Der Fokus liegt auf den oft übersehenen Folgen der Dyskalkulie und deren Auswirkungen auf das Leben Betroffener. Der Teil schließt mit einem Überblick über die verschiedenen Fördermöglichkeiten, sowohl in der Schule als auch außerhalb.
Schlüsselwörter
Dyskalkulie, Rechenstörung, Mathematiklernen, Komorbiditäten, Fördermöglichkeiten, Lehrer-Schüler-Beziehung, psychosoziale Folgen, Benachteiligung, Diagnose, Intervention.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Dyskalkulie - Eine umfassende Betrachtung
Was ist der Inhalt dieses Textes?
Der Text bietet einen umfassenden Überblick über Dyskalkulie, der sowohl die „objektive“ (Definition, Ursachen, Erscheinungsbild) als auch die „subjektive“ Perspektive (Folgen, Fördermöglichkeiten) beleuchtet. Er beinhaltet ein Inhaltsverzeichnis, die Zielsetzung, Kapitelzusammenfassungen, und Schlüsselwörter. Der Fokus liegt auf dem Verständnis der Herausforderungen für betroffene Schüler und den damit verbundenen pädagogischen Implikationen.
Wie ist der Text strukturiert?
Der Text ist in zwei Teile gegliedert: Teil I behandelt Dyskalkulie aus „objektiver“ Sicht (Definition, Ursachen, Erscheinungsbild), während Teil II die „subjektive“ Sicht (Folgen, Fördermöglichkeiten) darstellt. Jeder Teil umfasst mehrere Kapitel mit detaillierten Unterpunkten.
Was wird unter „objektiver“ Sicht auf Dyskalkulie verstanden?
Die „objektive“ Sicht umfasst die Definition von Dyskalkulie, eine kritische Auseinandersetzung mit verschiedenen Definitionsansätzen, die Beschreibung des Erscheinungsbilds (Prävalenz, Symptome) und die Erörterung der Ursachen. Dabei werden sowohl individuelle Faktoren (neuropsychologisch, kognitionspsychologisch, entwicklungspsychologisch) als auch pädagogische Faktoren (fachliche und didaktische Aspekte, Lehrer-Schüler-Beziehung) berücksichtigt.
Was wird unter „subjektiver“ Sicht auf Dyskalkulie verstanden?
Die „subjektive“ Sicht konzentriert sich auf die Erfahrungen und Folgen von Dyskalkulie für Betroffene. Dies beinhaltet Komorbiditäten (z.B. Lese-Rechtschreibstörung, ADHS), psychosoziale Probleme (emotionale Probleme, Prüfungsangst, Mathematikangst), sowie die Benachteiligung in Schule und Beruf. Dieser Teil beleuchtet auch die verschiedenen Fördermöglichkeiten, sowohl inner- als auch außerschulisch.
Welche Ursachen für Dyskalkulie werden behandelt?
Der Text untersucht Ursachen auf individueller Ebene (neuropsychologische, kognitionspsychologische und entwicklungspsychologische Ansätze, Defizite im Arbeitsgedächtnis) und auf pädagogischer Ebene (fachliche und fachdidaktische Mängel, die Lehrer-Schüler-Beziehung).
Welche Folgen von Dyskalkulie werden beschrieben?
Der Text beschreibt Komorbiditäten wie Lese-Rechtschreibstörung und ADHS, sowie psychosoziale Folgen wie emotionale Probleme, Prüfungsangst, Mathematikangst und Benachteiligung in Schule und Beruf.
Welche Fördermöglichkeiten werden genannt?
Der Text beschreibt sowohl innerschulische Fördermöglichkeiten (Nachteilsausgleich, didaktisch-methodische und pädagogische Überlegungen) als auch außerschulische Fördermöglichkeiten (gesetzliche Regelungen, außerschulische Diagnostik, Dyskalkulie-Therapie).
Welche Schlüsselwörter charakterisieren den Text?
Schlüsselwörter sind: Dyskalkulie, Rechenstörung, Mathematiklernen, Komorbiditäten, Fördermöglichkeiten, Lehrer-Schüler-Beziehung, psychosoziale Folgen, Benachteiligung, Diagnose, Intervention.
Für wen ist dieser Text relevant?
Dieser Text ist relevant für Pädagogen, Lehrer, Eltern, Therapeuten und alle, die sich mit den Herausforderungen von Dyskalkulie auseinandersetzen und ein umfassendes Verständnis entwickeln möchten.
Details
- Titel
- Die Problemwahrnehmung der Dyskalkulie
- Hochschule
- Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt am Main
- Note
- 1,0
- Autor
- Daniel Stahl (Autor:in)
- Erscheinungsjahr
- 2016
- Seiten
- 86
- Katalognummer
- V438184
- ISBN (eBook)
- 9783668783201
- ISBN (Buch)
- 9783668783218
- Sprache
- Deutsch
- Schlagworte
- problemwahrnehmung dyskalkulie
- Produktsicherheit
- GRIN Publishing GmbH
- Preis (Ebook)
- US$ 38,99
- Preis (Book)
- US$ 49,99
- Arbeit zitieren
- Daniel Stahl (Autor:in), 2016, Die Problemwahrnehmung der Dyskalkulie, München, Page::Imprint:: GRINVerlagOHG, https://www.diplomarbeiten24.de/document/438184
- Autor werden
- Ihre Optionen
- Vertriebskanäle
- Premium Services
- Autorenprofil
- Textarten und Formate
- Services für Verlage, Hochschulen, Unternehmen

- © GRIN Publishing GmbH.
- Alle Inhalte urheberrechtlich geschützt. Kopieren und verbreiten untersagt.
- info@grin.com
- AGB
- Open Publishing
Der GRIN Verlag hat sich seit 1998 auf die Veröffentlichung akademischer eBooks und Bücher spezialisiert. Der GRIN Verlag steht damit als erstes Unternehmen für User Generated Quality Content. Die Verlagsseiten GRIN.com, Hausarbeiten.de und Diplomarbeiten24 bieten für Hochschullehrer, Absolventen und Studenten die ideale Plattform, wissenschaftliche Texte wie Hausarbeiten, Referate, Bachelorarbeiten, Masterarbeiten, Diplomarbeiten, Dissertationen und wissenschaftliche Aufsätze einem breiten Publikum zu präsentieren.
Kostenfreie Veröffentlichung: Hausarbeit, Bachelorarbeit, Diplomarbeit, Dissertation, Masterarbeit, Interpretation oder Referat jetzt veröffentlichen!
- GRIN Verlag GmbH
-
- Nymphenburger Str. 86
- 80636
- Munich, Deutschland
- +49 89-550559-0
- +49 89-550559-10
- info@grin.com
-