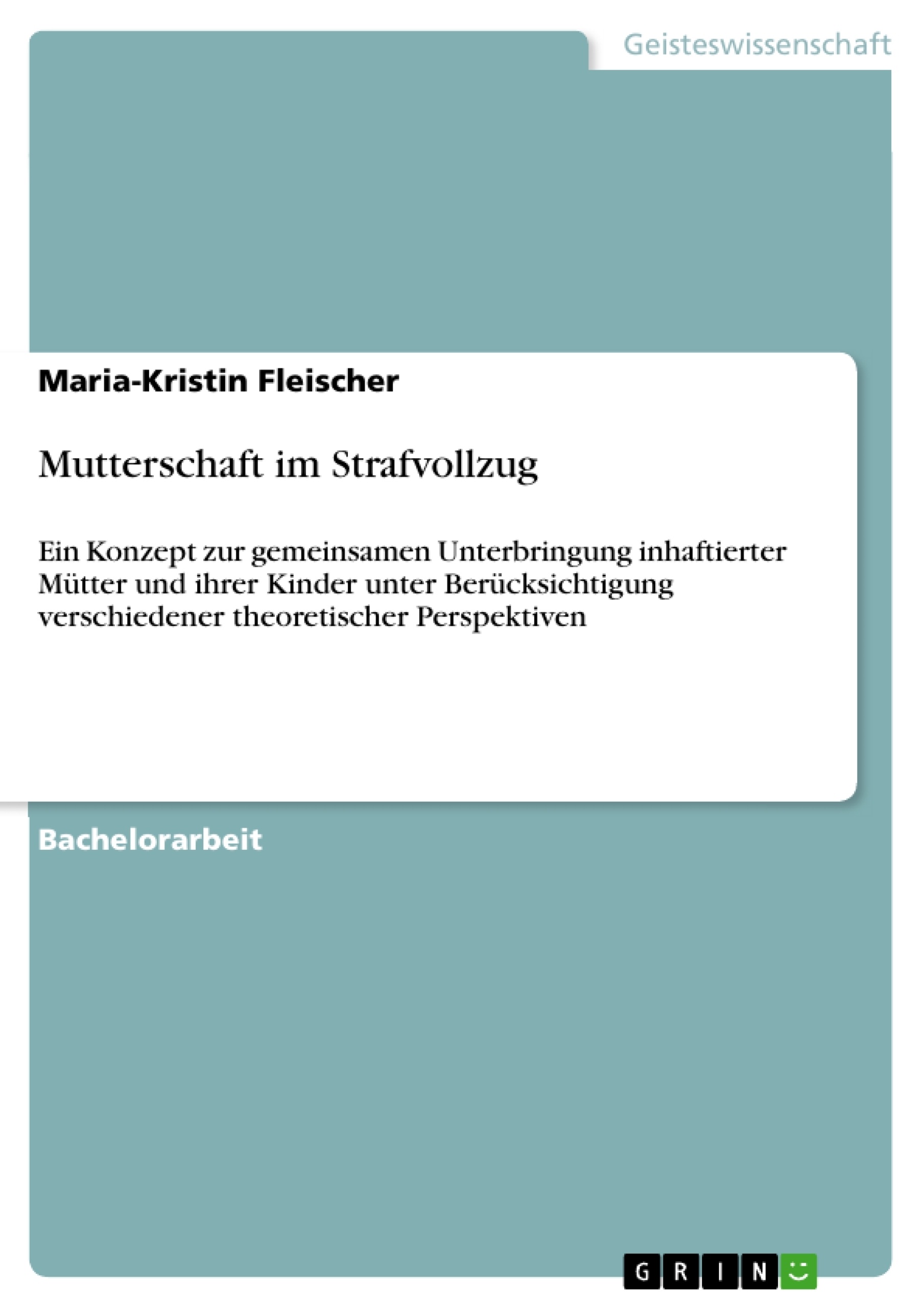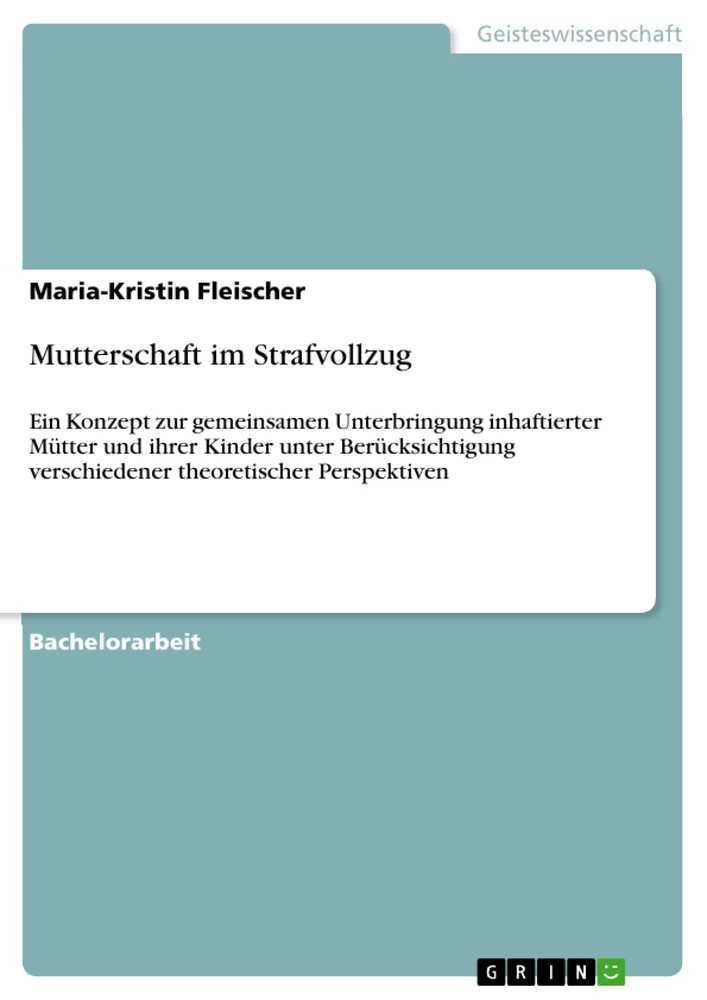
Mutterschaft im Strafvollzug
Bachelorarbeit, 2017
50 Seiten, Note: 1,6
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
- Mütter und Kinder gemeinsam in Haft.
- Strafvollzug in Deutschland..
- Definition Strafvollzug
- Aufbau und Struktur des Erwachsenenvollzuges......
- Besonderheiten des Frauenvollzuges….....
- Statistische Angaben zum Strafvollzug in Deutschland.
- Praktische Umsetzung am Beispiel des Frauenvollzuges Chemnitz
- Bindung von Müttern und Kindern im Strafvollzug ..
- Bindung - eine Auseinandersetzung mit dem Begriff.
- Folgen von Trennung – Frühtraumatisierung.....
- Bindungsstörungen
- Lebensbewältigung und Handlungsfähigkeiten von Müttern im Strafvollzug ....
- Lebensweltorientierung von Müttern und ihrer Kinder im Strafvollzug
- Straffällig gewordene Mütter und ihre Kinder - eine alternative Unterbringung zu Strafvollzug.
- Konzepterstellung..
- Fazit...........
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Bachelor-Thesis untersucht die besondere Situation inhaftierter Mütter und ihrer Kinder im deutschen Strafvollzug. Sie analysiert die Auswirkungen der Inhaftierung auf die Bindungsverhältnisse zwischen Mutter und Kind und beleuchtet die Herausforderungen, die sich für beide Seiten aus der Trennung ergeben. Die Arbeit befasst sich mit der Frage, inwiefern die aktuelle Gesetzgebung und die Praxis des Strafvollzugs den Bedürfnissen von Mutter und Kind gerecht werden und welche Möglichkeiten zur Verbesserung der Situation bestehen.
- Bindungsbeziehungen von Müttern und Kindern im Kontext des Strafvollzugs
- Rechtliche Rahmenbedingungen und Praxis des Strafvollzugs für inhaftierte Mütter
- Entwicklung und Auswirkungen von Frühtraumatisierung bei Kindern inhaftierter Mütter
- Alternative Unterbringungsmöglichkeiten für straffällige Mütter und ihre Kinder
- Entwicklung eines Konzepts zur gemeinsamen Unterbringung von inhaftierten Müttern und ihren Kindern
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel der Arbeit beleuchtet die Problematik der gemeinsamen Inhaftierung von Müttern und Kindern. Es werden die verschiedenen Perspektiven auf das Thema diskutiert und die Herausforderungen für alle Beteiligten beleuchtet. Das zweite Kapitel widmet sich dem deutschen Strafvollzugssystem. Es werden die rechtlichen Grundlagen, der Aufbau und die Struktur des Strafvollzugs sowie die Besonderheiten des Frauenvollzugs dargestellt. Im dritten Kapitel werden die Bindungsverhältnisse zwischen Müttern und Kindern im Strafvollzug untersucht. Es wird der Begriff "Bindung" definiert, die Folgen von Trennung und Frühtraumatisierung beleuchtet sowie das Phänomen der Bindungsstörungen untersucht. Kapitel vier behandelt die Lebensbewältigung und Handlungsfähigkeiten von inhaftierten Müttern. Es werden verschiedene Ansätze zur Unterstützung und zur Bewältigung der schwierigen Lebensumstände vorgestellt. Kapitel fünf befasst sich mit der Lebensweltorientierung von inhaftierten Müttern und ihren Kindern im Strafvollzug. Es werden die spezifischen Bedürfnisse und die besonderen Herausforderungen dieser Gruppe beleuchtet. Kapitel sechs diskutiert alternative Unterbringungsmöglichkeiten für straffällige Mütter und ihre Kinder. Es werden verschiedene Konzepte vorgestellt, die sich von der traditionellen Inhaftierung abgrenzen. Im siebten Kapitel wird ein Konzept zur gemeinsamen Unterbringung von inhaftierten Müttern und ihren Kindern entwickelt. Dieses Konzept berücksichtigt die Bedürfnisse von Mutter und Kind und zielt darauf ab, eine positive Entwicklung für beide Seiten zu ermöglichen. Das letzte Kapitel fasst die Ergebnisse der Arbeit zusammen und gibt einen Ausblick auf zukünftige Entwicklungen.
Schlüsselwörter
Die Arbeit beschäftigt sich mit den Themen Strafvollzug, Frauenvollzug, Mutter-Kind-Beziehung, Bindung, Frühtraumatisierung, Lebensbewältigung, Handlungsfähigkeiten, Alternative Unterbringung, Konzeptentwicklung. Die Untersuchung fokussiert insbesondere auf die Situation von inhaftierten Müttern und ihren Kindern und zielt auf die Verbesserung ihrer Lebensbedingungen und die Förderung ihrer Entwicklung.
Details
- Titel
- Mutterschaft im Strafvollzug
- Untertitel
- Ein Konzept zur gemeinsamen Unterbringung inhaftierter Mütter und ihrer Kinder unter Berücksichtigung verschiedener theoretischer Perspektiven
- Hochschule
- Fachhochschule Dresden
- Note
- 1,6
- Autor
- Maria-Kristin Fleischer (Autor:in)
- Erscheinungsjahr
- 2017
- Seiten
- 50
- Katalognummer
- V441064
- ISBN (eBook)
- 9783668794849
- ISBN (Buch)
- 9783668794856
- Sprache
- Deutsch
- Schlagworte
- mutterschaft strafvollzug konzept unterbringung mütter kinder berücksichtigung perspektiven
- Produktsicherheit
- GRIN Publishing GmbH
- Preis (Ebook)
- US$ 20,99
- Preis (Book)
- US$ 29,99
- Arbeit zitieren
- Maria-Kristin Fleischer (Autor:in), 2017, Mutterschaft im Strafvollzug, München, Page::Imprint:: GRINVerlagOHG, https://www.diplomarbeiten24.de/document/441064
- Autor werden
- Ihre Optionen
- Vertriebskanäle
- Premium Services
- Autorenprofil
- Textarten und Formate
- Services für Verlage, Hochschulen, Unternehmen

- © GRIN Publishing GmbH.
- Alle Inhalte urheberrechtlich geschützt. Kopieren und verbreiten untersagt.
- info@grin.com
- AGB
- Open Publishing
Der GRIN Verlag hat sich seit 1998 auf die Veröffentlichung akademischer eBooks und Bücher spezialisiert. Der GRIN Verlag steht damit als erstes Unternehmen für User Generated Quality Content. Die Verlagsseiten GRIN.com, Hausarbeiten.de und Diplomarbeiten24 bieten für Hochschullehrer, Absolventen und Studenten die ideale Plattform, wissenschaftliche Texte wie Hausarbeiten, Referate, Bachelorarbeiten, Masterarbeiten, Diplomarbeiten, Dissertationen und wissenschaftliche Aufsätze einem breiten Publikum zu präsentieren.
Kostenfreie Veröffentlichung: Hausarbeit, Bachelorarbeit, Diplomarbeit, Dissertation, Masterarbeit, Interpretation oder Referat jetzt veröffentlichen!
- GRIN Verlag GmbH
-
- Nymphenburger Str. 86
- 80636
- Munich, Deutschland
- +49 89-550559-0
- +49 89-550559-10
- info@grin.com
-