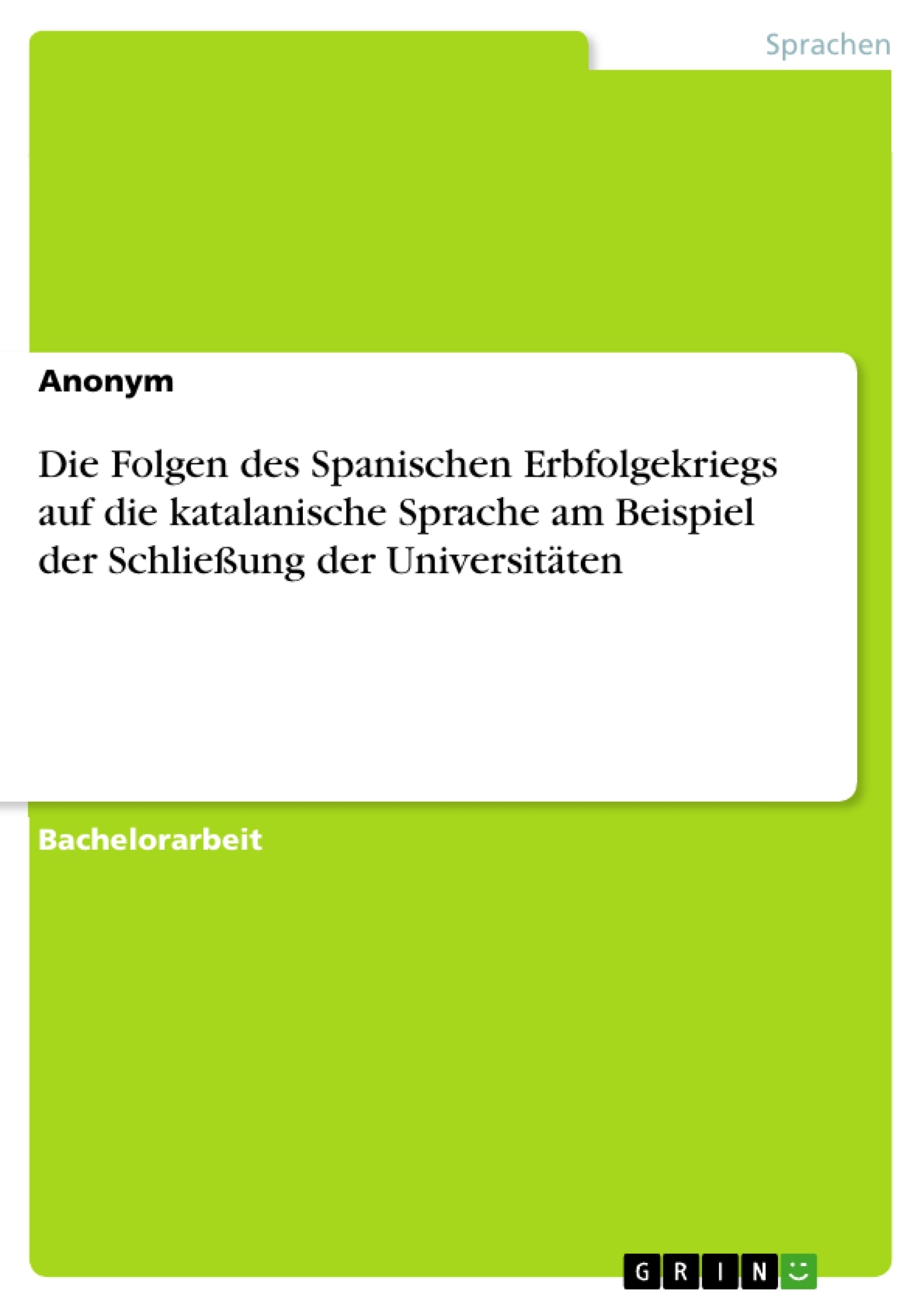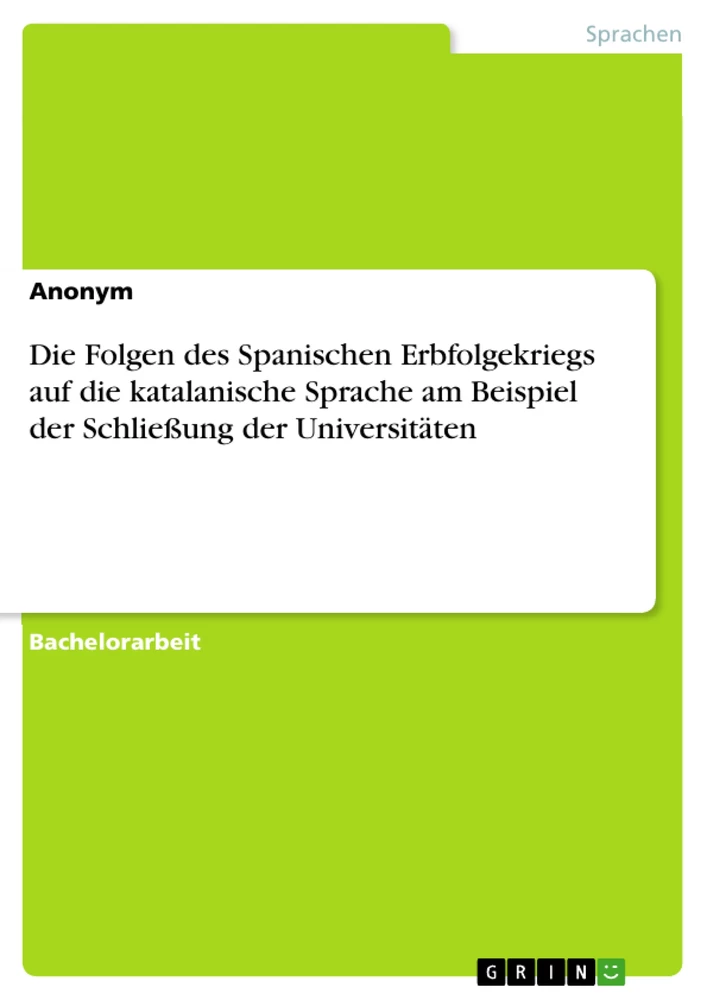
Die Folgen des Spanischen Erbfolgekriegs auf die katalanische Sprache am Beispiel der Schließung der Universitäten
Bachelorarbeit, 2015
37 Seiten, Note: 1,7
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung.
- Vorgeschichte Kataloniens bis zum Spanischen Erbfolgekrieg....
- Katalonien im Laufe des Spanischen Erbfolgekriegs (1701-1714)
- Die Folgen des Spanischen Erbfolgekriegs für das Katalanische.
- Decreto de Nueva Planta de Cataluña und dessen Folgen für das Katalanische in Katalonien
- Die Schließung der katalanischen Universitäten und deren Folgen für das Katalanische
- Katalanische Universitäten bis zur Schließung im Jahre 1717.
- Die Gründe für die Schließung der katalanischen Universitäten und für die Gründung der Universität von Cervera
- Die Universität von Cervera.......
- Kritik an der Universität von Cervera .....
- Wissenschaftliche Akademien und Schulen in Katalonien im 18. Jahrhundert....
- Wiederaufbau der katalanischen Universitäten........
- Renaixença des Katalanischen (1800-1940) ..
- Schlussbetrachtung .………………..\n
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Bachelorarbeit untersucht die Auswirkungen des Spanischen Erbfolgekriegs auf die katalanische Sprache. Durch die Analyse der Schließung der katalanischen Universitäten werden die sprachgeschichtlichen Zusammenhänge im Kontext des Spanischen Erbfolgekriegs und dessen Konsequenzen für katalanische Universitäten beleuchtet.
- Die historische Entwicklung des Katalanischen vor dem Spanischen Erbfolgekrieg
- Die Rolle des Spanischen Erbfolgekriegs im Kontext der katalanischen Sprache
- Die Folgen des Krieges für das Katalanische, insbesondere die Schließung der Universitäten
- Die Bedeutung der Universität von Cervera als Ersatz für die geschlossenen Universitäten
- Die Wiedergeburt des Katalanischen im 19. und 20. Jahrhundert
Zusammenfassung der Kapitel
Die Arbeit beginnt mit einer Darstellung der Vorgeschichte Kataloniens bis zum Spanischen Erbfolgekrieg, um den historischen Kontext der Sprache zu erläutern. Im dritten Kapitel wird der Verlauf des Krieges in Katalonien beschrieben. Das folgende Kapitel befasst sich mit den Folgen des Kriegs für das Katalanische. Hierbei werden Themen wie das Dekret der Nueva Planta, die Schließung der Universitäten, die Gründung der Universität Cervera und weiterer Akademien, die Situation des Katalanischen im 18. Jahrhundert sowie der Wiederaufbau der Universitäten behandelt. Schließlich beleuchtet die Arbeit die Renaixença „Wiedergeburt“ des Katalanischen im 19. und in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts, um die heutige Situation der Sprecher besser zu verstehen.
Schlüsselwörter
Spanischer Erbfolgekrieg, Katalanische Sprache, Sprachgeschichte, Universität, Schließung, Cervera, Renaixença, Katalanische Identität, Dekret der Nueva Planta
Details
- Titel
- Die Folgen des Spanischen Erbfolgekriegs auf die katalanische Sprache am Beispiel der Schließung der Universitäten
- Hochschule
- Christian-Albrechts-Universität Kiel
- Note
- 1,7
- Autor
- Anonym (Autor:in)
- Erscheinungsjahr
- 2015
- Seiten
- 37
- Katalognummer
- V441914
- ISBN (eBook)
- 9783668801431
- ISBN (Buch)
- 9783668801448
- Sprache
- Deutsch
- Schlagworte
- bachelorarbeit katalanisch spanisch Die Folgen des Spanischen Erbfolgekriegs auf die katalanische Sprache am Beispiel der Schließung der Universitäten spanischer erbfolgekrieg katalonien katalanische sprache katalanische geschichte katalanische universitäten felipe v felipe vi el conflicto der konflikt barcelona madrid
- Produktsicherheit
- GRIN Publishing GmbH
- Preis (Ebook)
- US$ 16,99
- Preis (Book)
- US$ 18,99
- Arbeit zitieren
- Anonym (Autor:in), 2015, Die Folgen des Spanischen Erbfolgekriegs auf die katalanische Sprache am Beispiel der Schließung der Universitäten, München, Page::Imprint:: GRINVerlagOHG, https://www.diplomarbeiten24.de/document/441914
- Autor werden
- Ihre Optionen
- Vertriebskanäle
- Premium Services
- Autorenprofil
- Textarten und Formate
- Services für Verlage, Hochschulen, Unternehmen

- © GRIN Publishing GmbH.
- Alle Inhalte urheberrechtlich geschützt. Kopieren und verbreiten untersagt.
- info@grin.com
- AGB
- Open Publishing
Der GRIN Verlag hat sich seit 1998 auf die Veröffentlichung akademischer eBooks und Bücher spezialisiert. Der GRIN Verlag steht damit als erstes Unternehmen für User Generated Quality Content. Die Verlagsseiten GRIN.com, Hausarbeiten.de und Diplomarbeiten24 bieten für Hochschullehrer, Absolventen und Studenten die ideale Plattform, wissenschaftliche Texte wie Hausarbeiten, Referate, Bachelorarbeiten, Masterarbeiten, Diplomarbeiten, Dissertationen und wissenschaftliche Aufsätze einem breiten Publikum zu präsentieren.
Kostenfreie Veröffentlichung: Hausarbeit, Bachelorarbeit, Diplomarbeit, Dissertation, Masterarbeit, Interpretation oder Referat jetzt veröffentlichen!
- GRIN Verlag GmbH
-
- Nymphenburger Str. 86
- 80636
- Munich, Deutschland
- +49 89-550559-0
- +49 89-550559-10
- info@grin.com
-