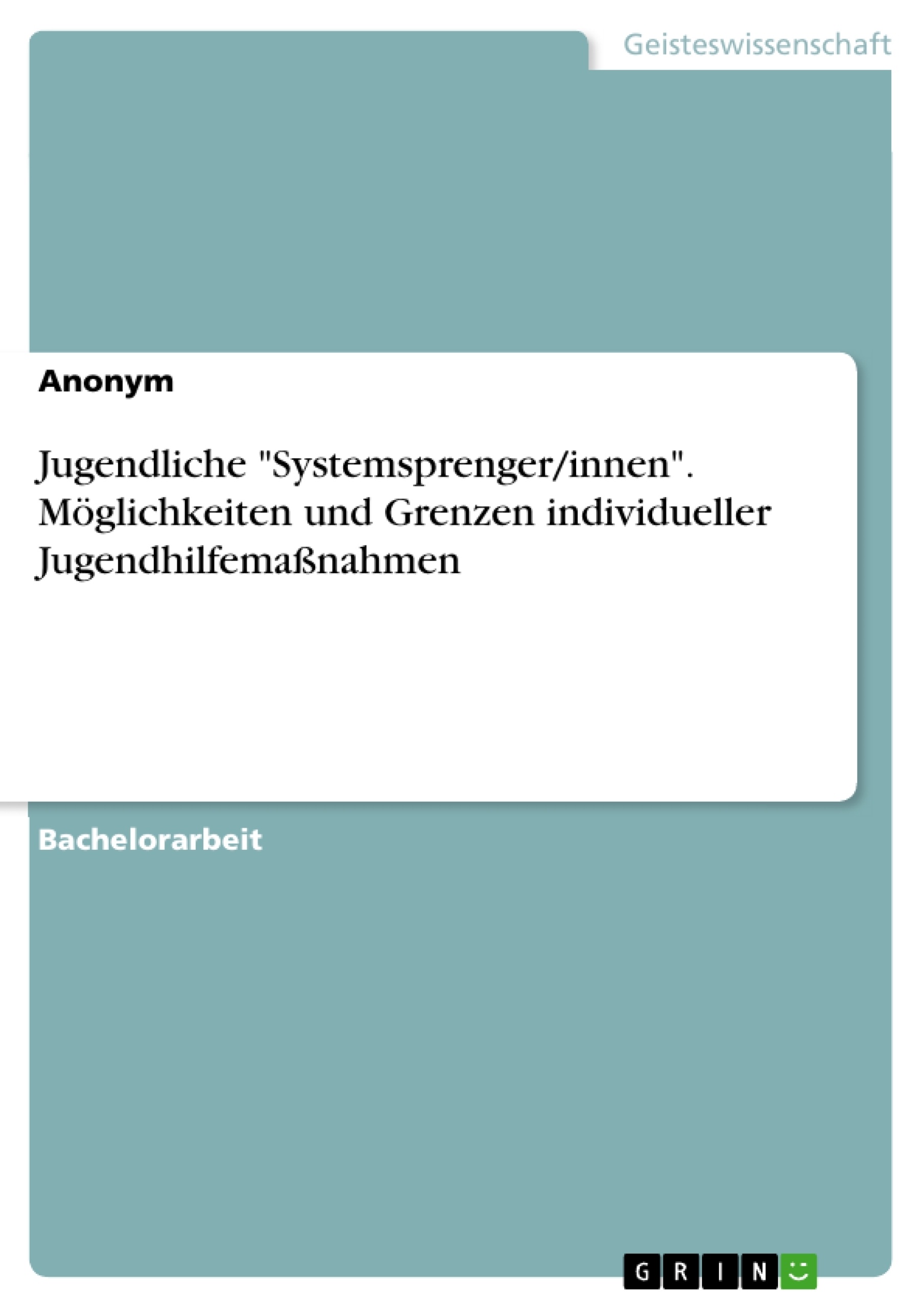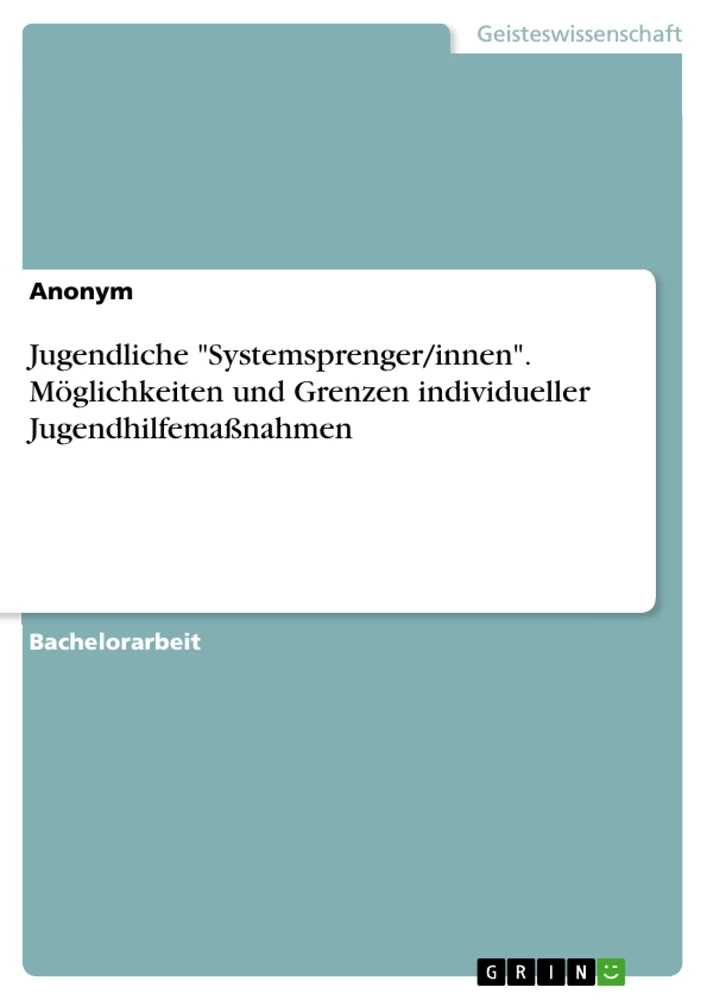
Jugendliche "Systemsprenger/innen". Möglichkeiten und Grenzen individueller Jugendhilfemaßnahmen
Bachelorarbeit, 2018
71 Seiten, Note: 1,3
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. System der Hilfen zur Erziehung (HzE)
- 2.1 „Das Herausfallen“
- 2.2 Etikett „Systemsprenger/innen“
- 3. Empirisches Vorgehen
- 4. Der theoretische „Anspruch“
- 4.1 Lebensweltorientierung nach Hans Thiersch
- 4.2 Soziale Integration
- 5. Die „Wirklichkeit“
- 5.1 Jugendhilfemaßnahmen
- 5.2 Ambulante Jugendhilfemaßnahmen
- 5.3 (Teil-)stationäre Jugendhilfemaßnahmen
- 5.3.1 Tagesgruppe
- 5.3.2 Intensivgruppen
- 5.3.3 Heimerziehung
- 5.3.4 Geschlossene Unterbringung (GU)
- 5.4 Möglichkeiten der Jugendhilfemaßnahmen
- 5.5 Grenzen der Jugendhilfemaßnahmen
- 5.5.1 Bildungssystem
- 5.5.2 Kinder- & Jugendpsychiatrie (KJP)
- 5.5.3 Zusammenarbeit der Bezugssysteme
- 6. Das „Scheitern“
- 6.1 Zielgruppe
- 6.1.1 Lebensverhältnisse
- 6.1.2 Drei Formen von jugendlichen „Systemsprenger/innen“
- 6.1.3 Verhaltensmerkmale
- 6.1.4 Das soziale Netzwerk
- 6.1.4.1 Familie
- 6.1.4.2 Peergroup
- 6.1.4.3 Alternative Lebensräume
- 6.2 Institution
- 6.3 Profession der Sozialen Arbeit
- 6.4 Methoden
- 7. Implikationen für die Zukunft
- 7.1 Hilfreiche Strukturen einer Maßnahme
- 7.1.1 Pädagogische Haltung
- 7.1.2 Institutionelle Ebene
- 7.1.3 Betreuungssetting
- 7.2 Individualpädagogische Maßnahmen
- 7.3 Praxisbeispiel „Systemsprenger - Homebase“
- 8. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Herausforderungen der sozialpädagogischen Arbeit mit Jugendlichen, die als „Systemsprenger/innen“ bezeichnet werden. Ziel ist es, individuelle Jugendhilfemaßnahmen zu analysieren, die die soziale Integration dieser Jugendlichen unterstützen. Die Arbeit beleuchtet die Grenzen und Möglichkeiten bestehender Hilfesysteme.
- Das System der Hilfen zur Erziehung (HzE) und seine Grenzen
- Die Lebenswelt und die Bewältigungsstrategien jugendlicher „Systemsprenger/innen“
- Geeignete individuelle Jugendhilfemaßnahmen zur Förderung der sozialen Integration
- Die Rolle der Profession der Sozialen Arbeit
- Implikationen für zukünftige Handlungsansätze
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik der sozialpädagogischen Arbeit mit jugendlichen „Systemsprenger/innen“ ein. Sie definiert den Begriff, beschreibt die Komplexität der Fälle und benennt das Ziel der Arbeit: die Untersuchung geeigneter Jugendhilfemaßnahmen zur Förderung der sozialen Integration dieser Jugendlichen. Die Einleitung verdeutlicht die Notwendigkeit, die Lebenswelten der Betroffenen zu verstehen und passende Hilfeleistungen zu identifizieren, um ein „Herausfallen“ aus dem Hilfesystem zu verhindern.
2. System der Hilfen zur Erziehung (HzE): Dieses Kapitel beschreibt das System der Hilfen zur Erziehung und seine verschiedenen Maßnahmen. Es analysiert den Begriff des „Herausfallens“ aus dem System und diskutiert die problematische Etikettierung von Jugendlichen als „Systemsprenger/innen“. Der Fokus liegt auf der Analyse der Strukturen und Prozesse innerhalb des HzE-Systems und deren Auswirkungen auf die betroffenen Jugendlichen.
4. Der theoretische „Anspruch“: Dieses Kapitel beleuchtet den theoretischen Anspruch der Hilfen zur Erziehung, insbesondere die Lebensweltorientierung nach Hans Thiersch und das Konzept der sozialen Integration. Es wird untersucht, wie diese theoretischen Konzepte in die Praxis umgesetzt werden und ob sie den komplexen Bedürfnissen jugendlicher „Systemsprenger/innen“ gerecht werden. Der Fokus liegt auf dem Widerspruch zwischen Anspruch und Wirklichkeit im Umgang mit diesen Jugendlichen.
5. Die „Wirklichkeit“: Dieses Kapitel beschreibt die Realität der Jugendhilfemaßnahmen, sowohl im ambulanten als auch im (teil-)stationären Bereich. Es beleuchtet verschiedene Maßnahmen wie Tagesgruppen, Intensivgruppen, Heimerziehung und geschlossene Unterbringung, ihre Möglichkeiten und vor allem ihre Grenzen. Es wird analysiert, wie die Zusammenarbeit zwischen verschiedenen Bezugssystemen (z.B. Bildungssystem, Kinder- und Jugendpsychiatrie) gestaltet ist und welche Herausforderungen sich daraus ergeben.
6. Das „Scheitern“: Dieses Kapitel analysiert die Gründe für das „Scheitern“ von Jugendhilfemaßnahmen bei jugendlichen „Systemsprenger/innen“. Es betrachtet die Zielgruppe, ihre Lebensverhältnisse, Verhaltensmerkmale und ihr soziales Netzwerk (Familie, Peergroup, alternative Lebensräume). Die Institution, die Profession der Sozialen Arbeit und angewandte Methoden werden ebenfalls kritisch beleuchtet. Die Kapitel erläutert unterschiedliche „Systemsprenger“-Profile und beschreibt die damit verbundenen Herausforderungen für die Hilfeplanung.
7. Implikationen für die Zukunft: Dieses Kapitel bietet einen Ausblick auf zukünftige Handlungsansätze im Umgang mit jugendlichen „Systemsprenger/innen“. Es werden hilfreiche Strukturen auf pädagogischer, institutioneller und betreuungsbezogener Ebene diskutiert. Es werden individualpädagogische Maßnahmen vorgestellt und ein Praxisbeispiel präsentiert, das erfolgreiche Strategien zur Unterstützung dieser Jugendlichen veranschaulicht.
Schlüsselwörter
Jugendliche Systemsprenger/innen, Hilfen zur Erziehung (HzE), Soziale Integration, Lebensweltorientierung, Jugendhilfemaßnahmen, Ambulante Hilfen, Stationäre Hilfen, Kinder- und Jugendpsychiatrie (KJP), Professionelle Sozialarbeit, Handlungsansätze, Komplexität, Herausforderungen.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Analyse der sozialpädagogischen Arbeit mit jugendlichen "Systemsprengern/innen"
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit analysiert die Herausforderungen der sozialpädagogischen Arbeit mit Jugendlichen, die als „Systemsprenger/innen“ bezeichnet werden. Der Fokus liegt auf der Untersuchung geeigneter Jugendhilfemaßnahmen zur Förderung der sozialen Integration dieser Jugendlichen und der Analyse der Grenzen und Möglichkeiten bestehender Hilfesysteme.
Welche Themen werden im Einzelnen behandelt?
Die Arbeit behandelt das System der Hilfen zur Erziehung (HzE) und seine Grenzen, die Lebenswelt und Bewältigungsstrategien jugendlicher „Systemsprenger/innen“, geeignete individuelle Jugendhilfemaßnahmen, die Rolle der Sozialen Arbeit und Implikationen für zukünftige Handlungsansätze. Sie untersucht verschiedene Jugendhilfemaßnahmen (ambulante und stationäre), die Zusammenarbeit verschiedener Bezugssysteme (Bildungssystem, Kinder- und Jugendpsychiatrie) und analysiert Gründe für das „Scheitern“ von Maßnahmen.
Welche theoretischen Ansätze werden verwendet?
Die Arbeit stützt sich auf die Lebensweltorientierung nach Hans Thiersch und das Konzept der sozialen Integration. Es wird untersucht, wie diese Konzepte in der Praxis umgesetzt werden und ob sie den Bedürfnissen jugendlicher „Systemsprenger/innen“ gerecht werden.
Welche Arten von Jugendhilfemaßnahmen werden betrachtet?
Die Arbeit betrachtet ambulante und (teil-)stationäre Jugendhilfemaßnahmen, darunter Tagesgruppen, Intensivgruppen, Heimerziehung und geschlossene Unterbringung. Sie analysiert die Möglichkeiten und Grenzen dieser Maßnahmen.
Was sind die Ergebnisse bezüglich des „Scheiterns“ von Jugendhilfemaßnahmen?
Das „Scheitern“ wird im Kontext der Zielgruppe (Lebensverhältnisse, Verhaltensmerkmale, soziales Netzwerk), der Institution, der Profession der Sozialen Arbeit und der angewandten Methoden analysiert. Es werden unterschiedliche Profile von „Systemsprengern/innen“ und die damit verbundenen Herausforderungen für die Hilfeplanung beschrieben.
Welche Implikationen für die Zukunft werden genannt?
Die Arbeit diskutiert hilfreiche Strukturen für zukünftige Maßnahmen auf pädagogischer, institutioneller und betreuungsbezogener Ebene. Sie stellt individualpädagogische Maßnahmen vor und präsentiert ein Praxisbeispiel erfolgreicher Strategien.
Wer ist die Zielgruppe dieser Arbeit?
Diese Arbeit richtet sich an Fachkräfte der Sozialen Arbeit, Wissenschaftler*innen, Studierende und alle, die sich mit der sozialpädagogischen Arbeit mit Jugendlichen und dem Hilfesystem auseinandersetzen.
Welche Schlüsselbegriffe sind zentral?
Zentrale Schlüsselbegriffe sind: Jugendliche Systemsprenger/innen, Hilfen zur Erziehung (HzE), Soziale Integration, Lebensweltorientierung, Jugendhilfemaßnahmen, Ambulante Hilfen, Stationäre Hilfen, Kinder- und Jugendpsychiatrie (KJP), Professionelle Sozialarbeit, Handlungsansätze, Komplexität, Herausforderungen.
Wo finde ich detailliertere Informationen zu den einzelnen Kapiteln?
Eine detaillierte Zusammenfassung der einzelnen Kapitel findet sich im HTML-Dokument, welches die Kapitelüberschriften und jeweilige Zusammenfassungen enthält.
Details
- Titel
- Jugendliche "Systemsprenger/innen". Möglichkeiten und Grenzen individueller Jugendhilfemaßnahmen
- Note
- 1,3
- Autor
- Anonym (Autor:in)
- Erscheinungsjahr
- 2018
- Seiten
- 71
- Katalognummer
- V443823
- ISBN (eBook)
- 9783668810075
- ISBN (Buch)
- 9783668810082
- Sprache
- Deutsch
- Schlagworte
- Grenzgänger Jugendhilfemaßnahmen Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung schwierige Jugendliche Herausforderung für die soziale Arbeit Hilfen zur Erziehung Soziale Integration Lebensweltorientierung nach Thiersch Geschlossene Unterbringung Heimerziehung Kinder-& Jugendpsychiatrie Individualpädagogische Maßnahmen Scheitern in der Jugendhilfe gewalttätiges Verhalten Schulabsentismus Selbstverletztendes Verhalten Selbst- & Fremdgefährdung
- Produktsicherheit
- GRIN Publishing GmbH
- Preis (Ebook)
- US$ 31,99
- Preis (Book)
- US$ 44,99
- Arbeit zitieren
- Anonym (Autor:in), 2018, Jugendliche "Systemsprenger/innen". Möglichkeiten und Grenzen individueller Jugendhilfemaßnahmen, München, Page::Imprint:: GRINVerlagOHG, https://www.diplomarbeiten24.de/document/443823
- Autor werden
- Ihre Optionen
- Vertriebskanäle
- Premium Services
- Autorenprofil
- Textarten und Formate
- Services für Verlage, Hochschulen, Unternehmen

- © GRIN Publishing GmbH.
- Alle Inhalte urheberrechtlich geschützt. Kopieren und verbreiten untersagt.
- info@grin.com
- AGB
- Open Publishing
Der GRIN Verlag hat sich seit 1998 auf die Veröffentlichung akademischer eBooks und Bücher spezialisiert. Der GRIN Verlag steht damit als erstes Unternehmen für User Generated Quality Content. Die Verlagsseiten GRIN.com, Hausarbeiten.de und Diplomarbeiten24 bieten für Hochschullehrer, Absolventen und Studenten die ideale Plattform, wissenschaftliche Texte wie Hausarbeiten, Referate, Bachelorarbeiten, Masterarbeiten, Diplomarbeiten, Dissertationen und wissenschaftliche Aufsätze einem breiten Publikum zu präsentieren.
Kostenfreie Veröffentlichung: Hausarbeit, Bachelorarbeit, Diplomarbeit, Dissertation, Masterarbeit, Interpretation oder Referat jetzt veröffentlichen!
- GRIN Verlag GmbH
-
- Nymphenburger Str. 86
- 80636
- Munich, Deutschland
- +49 89-550559-0
- +49 89-550559-10
- info@grin.com
-