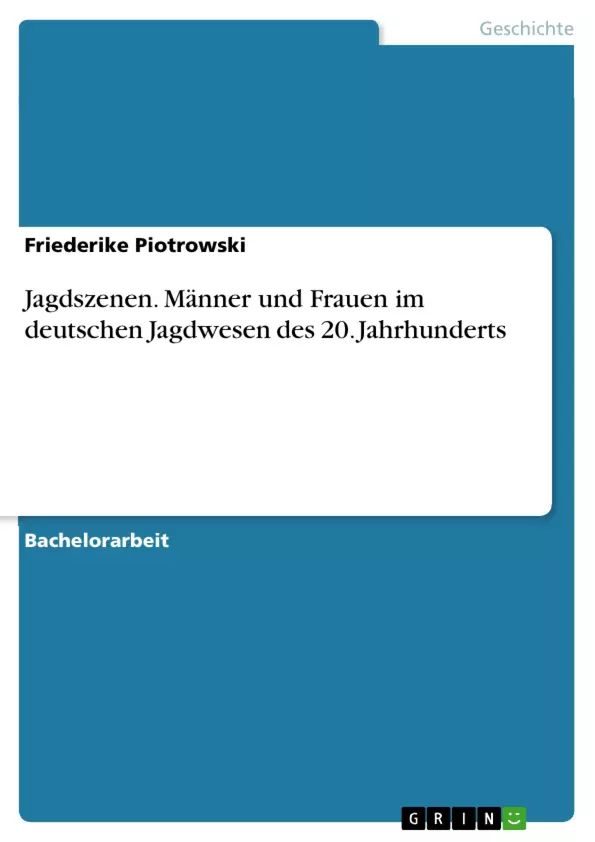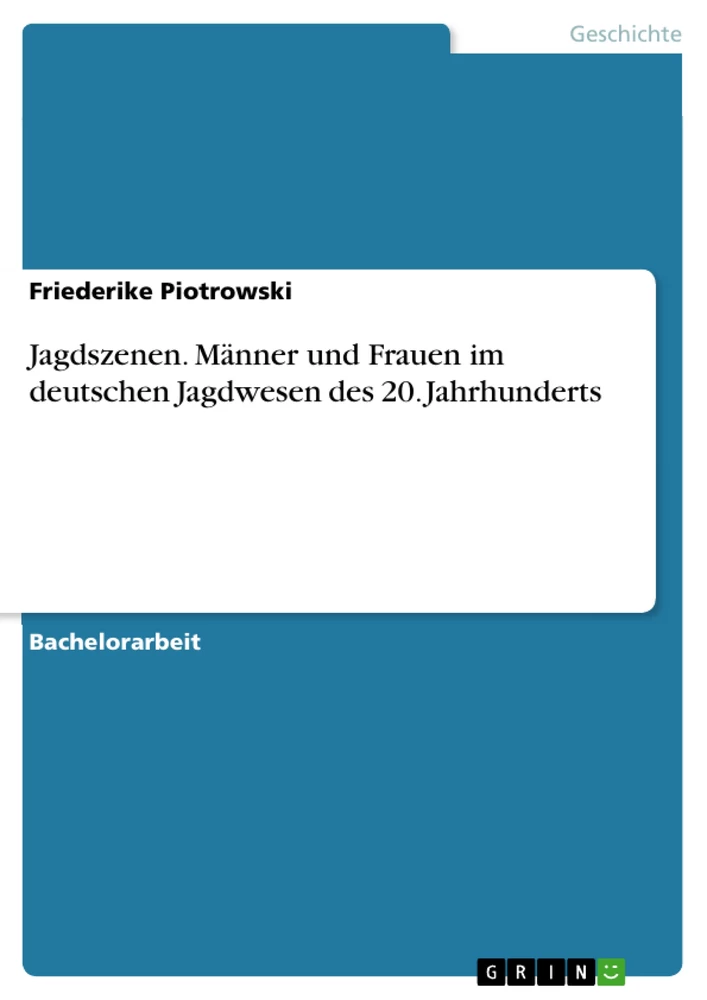
Jagdszenen. Männer und Frauen im deutschen Jagdwesen des 20. Jahrhunderts
Bachelorarbeit, 2015
54 Seiten, Note: 14 Punkte
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Eine kurze Geschichte der jagenden Frau
- Jagd, Jagdrecht und jagende Frauen von den Anfängen bis ins Mittelalter
- Aristokratische Jägerinnen in der Frühen Neuzeit
- Jägerinnen im ausgehenden 19. und frühen 20. Jahrhundert - eine Grauzone
- Männer, Frauen, Waffen und die Jagd - Weiblichkeits- und Männlichkeitsbilder im Jagdwesen der Bundesrepublik nach 1945
- Die Jagdzeitschrift Wild und Hund als Quelle
- Die Diskussion um die „Unweiblichkeit“ jagender Frauen
- Die Ehefrau des Jägers – zwischen Mit-Jägerin und Waidmannsweib
- Die Ehefrau als Jagdgefährtin
- Das Waidmannsweib
- Das neue Selbstbewusstsein der Jägerinnen in den 1980er Jahren
- Schlussbetrachtung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Bachelorarbeit befasst sich mit der Frage, wie Frauen im deutschen Jagdwesen des 20. Jahrhunderts wahrgenommen wurden und welche Rolle das Thema Geschlecht im Kontext von Jagdpraktiken, -ritualen und -kultur spielt. Die Arbeit analysiert die Entwicklung des Verhältnisses von Männern und Frauen in der Jagd und beleuchtet die Entstehung von Geschlechterbildern in Bezug auf Jagd und Waffengebrauch.
- Geschichtliche Entwicklung der Rolle der jagenden Frau
- Weiblichkeits- und Männlichkeitsbilder im Jagdwesen
- Diskussion um die „Unweiblichkeit“ jagender Frauen
- Die Rolle der Ehefrau des Jägers
- Das neue Selbstbewusstsein der Jägerinnen in den 1980er Jahren
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel widmet sich der Einleitung und beleuchtet den steigenden Anteil an Frauen im deutschen Jagdwesen. Kapitel zwei bietet einen geschichtlichen Überblick über die Rolle der jagenden Frau von den Anfängen bis ins 20. Jahrhundert, wobei die Entwicklung der Jagdtätigkeit und das Verhältnis von Frauen zur Jagd in unterschiedlichen Epochen und Gesellschaftsschichten betrachtet werden. Das dritte Kapitel fokussiert auf die Bundesrepublik nach 1945 und analysiert die Diskussion um die „Unweiblichkeit“ jagender Frauen sowie die Rolle der Ehefrau des Jägers. Zudem wird das neue Selbstbewusstsein der Jägerinnen in den 1980er Jahren beleuchtet.
Schlüsselwörter
Jagd, Jagdrecht, jagende Frau, Weiblichkeits- und Männlichkeitsbilder, Geschlechterrollen, Geschlechterkonstellationen, Jagdgesellschaft, Waffengebrauch, Hege, Deutsche Jagdzeitung, Wild und Hund.
Details
- Titel
- Jagdszenen. Männer und Frauen im deutschen Jagdwesen des 20. Jahrhunderts
- Hochschule
- Justus-Liebig-Universität Gießen (Historisches Institut, Fachjournalistik Geschichte)
- Note
- 14 Punkte
- Autor
- Master of Arts Friederike Piotrowski (Autor:in)
- Erscheinungsjahr
- 2015
- Seiten
- 54
- Katalognummer
- V444410
- ISBN (eBook)
- 9783668813991
- ISBN (Buch)
- 9783668814004
- Sprache
- Deutsch
- Schlagworte
- Jagd Deutschland Geschlechter Geschlechtergeschichte Waffen Sexualität Jagen Tiere Wild und Hund Frauen und Waffen Männer Frauen Macht 20. Jahrhundert Neueste Geschichte Jägerinnen Jäger Jagdszenen Schießen Töten Sexualität und Gewalt Männlichkeit Weiblichkeit Waidmannsweib Tradition Geschlechterbilder Jagdwesen Wald Hunde
- Produktsicherheit
- GRIN Publishing GmbH
- Preis (Ebook)
- US$ 20,99
- Preis (Book)
- US$ 29,99
- Arbeit zitieren
- Master of Arts Friederike Piotrowski (Autor:in), 2015, Jagdszenen. Männer und Frauen im deutschen Jagdwesen des 20. Jahrhunderts, München, Page::Imprint:: GRINVerlagOHG, https://www.diplomarbeiten24.de/document/444410
- Autor werden
- Ihre Optionen
- Vertriebskanäle
- Premium Services
- Autorenprofil
- Textarten und Formate
- Services für Verlage, Hochschulen, Unternehmen

- © GRIN Publishing GmbH.
- Alle Inhalte urheberrechtlich geschützt. Kopieren und verbreiten untersagt.
- info@grin.com
- AGB
- Open Publishing
Der GRIN Verlag hat sich seit 1998 auf die Veröffentlichung akademischer eBooks und Bücher spezialisiert. Der GRIN Verlag steht damit als erstes Unternehmen für User Generated Quality Content. Die Verlagsseiten GRIN.com, Hausarbeiten.de und Diplomarbeiten24 bieten für Hochschullehrer, Absolventen und Studenten die ideale Plattform, wissenschaftliche Texte wie Hausarbeiten, Referate, Bachelorarbeiten, Masterarbeiten, Diplomarbeiten, Dissertationen und wissenschaftliche Aufsätze einem breiten Publikum zu präsentieren.
Kostenfreie Veröffentlichung: Hausarbeit, Bachelorarbeit, Diplomarbeit, Dissertation, Masterarbeit, Interpretation oder Referat jetzt veröffentlichen!
- GRIN Verlag GmbH
-
- Nymphenburger Str. 86
- 80636
- Munich, Deutschland
- +49 89-550559-0
- +49 89-550559-10
- info@grin.com
-