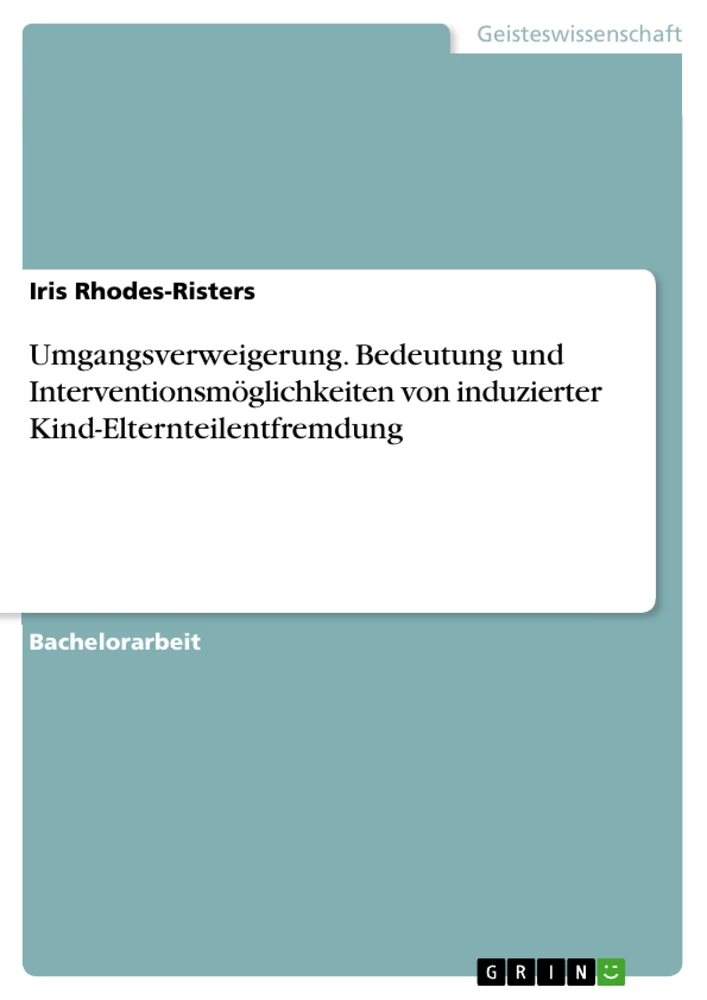
Umgangsverweigerung. Bedeutung und Interventionsmöglichkeiten von induzierter Kind-Elternteilentfremdung
Bachelorarbeit, 2014
59 Seiten, Note: 1,7
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einleitung
- 2 Das Kindschaftsrecht
- 2.1 Reformen des Familienrechts
- 2.2 Das Umgangsrecht und seine Bedeutung
- 2.3 Die Ausgestaltung des Umgangs
- 2.4 Die Anhörung des Kindes
- 2.5 Der Wille des Kindes
- 2.6 Das Hinwirken auf Einvernehmen
- 3 Konflikterleben in hochkonflikthaften Trennungs- und Scheidungsfamilien
- 3.1 Die Psychodynamik des Trennungserlebens
- 3.2 Eingeschränkte Eltern-Kind-Beziehung
- 3.3 Mangelnde Bindungsqualität
- 4 Störungen des Umgangs
- 4.1 Die Umgangsvereitelung bzw. Verweigerung
- 4.2 Die Umgangsverweigerung durch das Kind
- 4.2.1 Die Streitvermeidung
- 4.2.2 Die instrumentalisierte Loyalität
- 4.2.3 Die Kränkung und seelische Verletzung
- 5 Chancen und Grenzen einer Intervention
- 5.1 Streitvermeidung
- 5.2 Instrumentalisierte Loyalität
- 5.3 Kränkung und seelische Verletzung
- 6 Umgangsausschluss
- 7 Interventionen
- 7.1 Die Mediation
- 7.2 Das themenzentrierte Kinder-Interview
- 7.3 Die Kinderberatung
- 8 Zusammenfassung des Theorieteils mit Lösungsansatz
- 9 Forschungsstand und Theorie
- 9.1 Theoretischer und empirischer Forschungsstand
- 9.2 Theoretisches Modell der Studie
- 9.3 Fragestellung und Hypothesen
- 10 Methode
- 10.1 Untersuchungsdesign
- 10.2 Instrumente und Messgeräte
- 10.3 Stichprobenkonstruktion
- 10.4 Untersuchungsdurchführung
- 10.5 Datenanalyse
- 11 Ergebnisse
- 11.1 Stichprobenbeschreibung
- 11.2 Ergebnisse zu den einzelnen Fragestellungen und Hypothesen
- 11.3 Weitere Befunde
- 12 Diskussion
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Bachelorarbeit befasst sich mit dem Phänomen der induzierten Kind-Elternteilentfremdung, auch bekannt als "Umgangsverweigerung". Sie untersucht die Bedeutung und Interventionsmöglichkeiten dieser komplexen Thematik im Kontext von Trennungs- und Scheidungsfamilien. Das Ziel der Arbeit ist es, ein tieferes Verständnis für die Ursachen und Auswirkungen von Umgangsverweigerung zu entwickeln und aufbauend auf dem aktuellen Forschungsstand praktikable Interventionsansätze zu identifizieren.
- Die rechtlichen Rahmenbedingungen des Umgangsrechts und seine Bedeutung für die Kindesentwicklung
- Die psychosozialen Auswirkungen von Konflikten in Trennungs- und Scheidungsfamilien
- Die verschiedenen Formen und Ursachen von Umgangsverweigerung, insbesondere im Kontext der induzierten Kind-Elternteilentfremdung
- Die Chancen und Grenzen von Interventionsmöglichkeiten bei Umgangsverweigerung
- Die Relevanz und Möglichkeiten der empirischen Forschung im Kontext der induzierten Kind-Elternteilentfremdung
Zusammenfassung der Kapitel
- Kapitel 1: Die Einleitung gibt eine kurze Einführung in die Thematik der induzierten Kind-Elternteilentfremdung und erläutert die Relevanz und Zielsetzung der Arbeit.
- Kapitel 2: Dieses Kapitel befasst sich mit dem rechtlichen Rahmen des Umgangsrechts und seiner Bedeutung im Kontext von Trennung und Scheidung. Es beleuchtet die Entwicklung des Familienrechts und die aktuellen rechtlichen Vorgaben zum Umgangsrecht.
- Kapitel 3: Dieses Kapitel analysiert die Herausforderungen und Konflikte, die in hochkonflikthaften Trennungs- und Scheidungsfamilien auftreten. Es befasst sich mit der Psychodynamik des Trennungserlebens, den Auswirkungen auf die Eltern-Kind-Beziehung und den Herausforderungen der Bindungsqualität.
- Kapitel 4: Dieses Kapitel konzentriert sich auf Störungen des Umgangs, insbesondere auf die Umgangsvereitelung und Verweigerung. Es analysiert die verschiedenen Formen der Umgangsverweigerung durch das Kind und die damit verbundenen Ursachen und Folgen.
- Kapitel 5: Dieses Kapitel untersucht die Chancen und Grenzen von Interventionen bei Umgangsverweigerung. Es betrachtet die verschiedenen Ansätze zur Streitvermeidung, die Bewältigung von instrumentalisierter Loyalität und die Unterstützung von Kindern, die durch Kränkung und seelische Verletzung belastet sind.
- Kapitel 6: Dieses Kapitel befasst sich mit dem Umgangsausschluss als extreme Form der Umgangsverweigerung und untersucht die Gründe und Folgen dieser Maßnahme.
- Kapitel 7: Dieses Kapitel beleuchtet verschiedene Interventionsansätze zur Bewältigung von Umgangsverweigerung. Es betrachtet die Rolle der Mediation, des themenzentrierten Kinder-Interviews und der Kinderberatung.
- Kapitel 8: Dieses Kapitel fasst die zentralen Erkenntnisse des Theorieteils zusammen und entwickelt einen Lösungsansatz zur Bewältigung von Umgangsverweigerung.
- Kapitel 9: Dieses Kapitel beleuchtet den aktuellen Forschungsstand zum Thema der induzierten Kind-Elternteilentfremdung und stellt das theoretische Modell der Studie vor. Es formuliert zudem die Fragestellungen und Hypothesen der Arbeit.
- Kapitel 10: Dieses Kapitel beschreibt die methodischen Vorgehensweisen der empirischen Studie. Es erläutert das Untersuchungsdesign, die verwendeten Instrumente, die Stichprobenkonstruktion und die Datenanalyse.
- Kapitel 11: Dieses Kapitel präsentiert die Ergebnisse der empirischen Studie. Es beleuchtet die Stichprobenbeschreibung, die Ergebnisse zu den einzelnen Fragestellungen und Hypothesen sowie weitere Befunde.
- Kapitel 12: Dieses Kapitel diskutiert die Ergebnisse der Studie und setzt diese in Beziehung zu dem bestehenden Forschungsstand. Es beleuchtet die Bedeutung der Ergebnisse für die Praxis und gibt Hinweise für zukünftige Forschungsansätze.
Schlüsselwörter
Die Arbeit fokussiert auf die Themenbereiche Umgangsverweigerung, induzierte Kind-Elternteilentfremdung, Trennungs- und Scheidungsfamilien, Kindeswohl, Umgangsrecht, Interventionsmöglichkeiten, Mediation, themenzentriertes Kinder-Interview, Kinderberatung, empirische Forschung, Forschungsstand.
Details
- Titel
- Umgangsverweigerung. Bedeutung und Interventionsmöglichkeiten von induzierter Kind-Elternteilentfremdung
- Hochschule
- Hochschule Niederrhein in Mönchengladbach
- Note
- 1,7
- Autor
- Iris Rhodes-Risters (Autor:in)
- Erscheinungsjahr
- 2014
- Seiten
- 59
- Katalognummer
- V444506
- ISBN (eBook)
- 9783668818743
- ISBN (Buch)
- 9783668818750
- Sprache
- Deutsch
- Schlagworte
- umgangsverweigerung bedeutung interventionsmöglichkeiten kind-elternteilentfremdung
- Produktsicherheit
- GRIN Publishing GmbH
- Preis (Ebook)
- US$ 20,99
- Preis (Book)
- US$ 29,99
- Arbeit zitieren
- Iris Rhodes-Risters (Autor:in), 2014, Umgangsverweigerung. Bedeutung und Interventionsmöglichkeiten von induzierter Kind-Elternteilentfremdung, München, Page::Imprint:: GRINVerlagOHG, https://www.diplomarbeiten24.de/document/444506
- Autor werden
- Ihre Optionen
- Vertriebskanäle
- Premium Services
- Autorenprofil
- Textarten und Formate
- Services für Verlage, Hochschulen, Unternehmen

- © GRIN Publishing GmbH.
- Alle Inhalte urheberrechtlich geschützt. Kopieren und verbreiten untersagt.
- info@grin.com
- AGB
- Open Publishing
Der GRIN Verlag hat sich seit 1998 auf die Veröffentlichung akademischer eBooks und Bücher spezialisiert. Der GRIN Verlag steht damit als erstes Unternehmen für User Generated Quality Content. Die Verlagsseiten GRIN.com, Hausarbeiten.de und Diplomarbeiten24 bieten für Hochschullehrer, Absolventen und Studenten die ideale Plattform, wissenschaftliche Texte wie Hausarbeiten, Referate, Bachelorarbeiten, Masterarbeiten, Diplomarbeiten, Dissertationen und wissenschaftliche Aufsätze einem breiten Publikum zu präsentieren.
Kostenfreie Veröffentlichung: Hausarbeit, Bachelorarbeit, Diplomarbeit, Dissertation, Masterarbeit, Interpretation oder Referat jetzt veröffentlichen!
- GRIN Verlag GmbH
-
- Nymphenburger Str. 86
- 80636
- Munich, Deutschland
- +49 89-550559-0
- +49 89-550559-10
- info@grin.com
-









