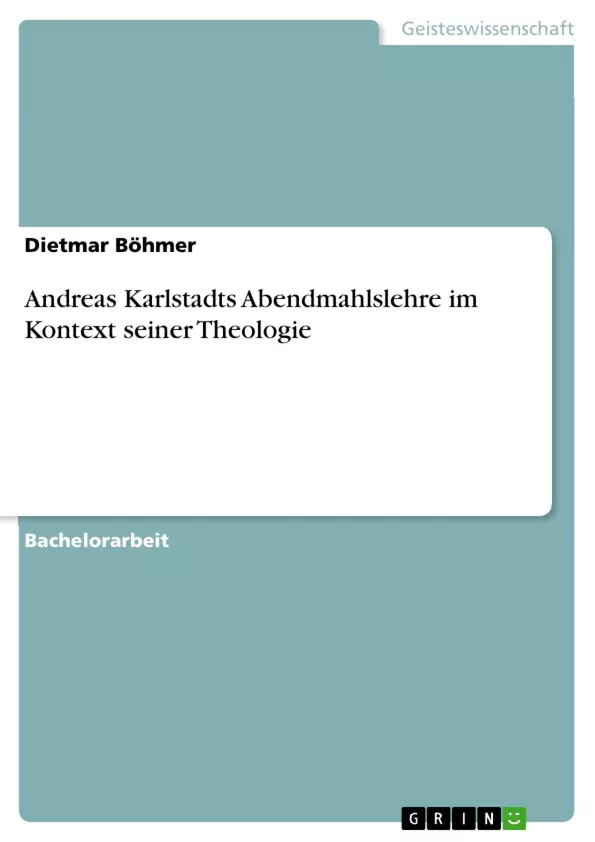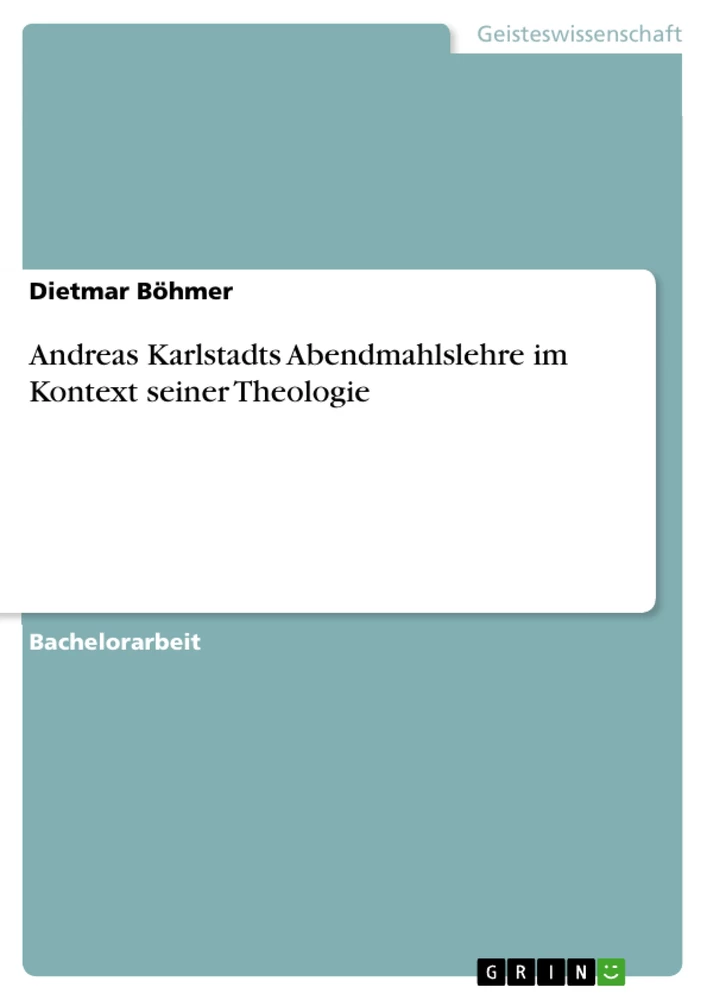
Andreas Karlstadts Abendmahlslehre im Kontext seiner Theologie
Bachelorarbeit, 2015
46 Seiten, Note: 1
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung.
- Bedeutung des Abendmahls
- Die Suche nach Wahrheit und Heilsgewissheit
- Luthers Abendmahlsverständnis
- Die Bedeutung des Worts
- Was ist ein Sakrament?
- Entwicklung des Abendmahlsverständnisses
- Unterschiede zwischen den Reformatoren
- Biographischer Überblick zu Karlstadt
- Karlstadts Verhältnis zu Luther
- Theologische Position und Kirchenverständnis Karlstadts
- Von dem widerchristlichen mißbrauch des hern brodt vnd kelch
- Warum wurde diese Schrift gewählt
- Zeit/Ort und Anlass
- Literarische Gestalt
- Aufbau
- Einleitung
- Ob das Sacrament die sünde vergäbe
- Verkündigung des Todes des Herrn
- Was gedechtnüs sey
- Unwürdigkeit
- Das sacrament ist kein Arrabo / Arra/Pfandt/oder gottispfennig
- Nachwirkungen
- Resümee
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Abendmahlslehre von Andreas Karlstadt im Kontext seiner Theologie und setzt sie in Beziehung zum Abendmahlsverständnis Martin Luthers. Die Arbeit beleuchtet die unterschiedlichen Auffassungen der beiden Reformatoren und analysiert den Hintergrund, die Argumentationslinien und die Auswirkungen des Abendmahlsstreits.
- Die Suche nach Wahrheit und Heilsgewissheit als zentraler Aspekt der reformatorischen Theologie
- Das Verständnis von Wort, Glaube und Rechtfertigung im Kontext der Abendmahlslehre
- Der Stellenwert des Abendmahls als Sakrament und seine Bedeutung für das Christentum
- Die Rolle des Abendmahls in der Entwicklung der Reformation
- Die Auseinandersetzung mit den unterschiedlichen Positionen Luthers und Karlstadts zum Abendmahl
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt das Thema der Arbeit vor und skizziert die zentrale Fragestellung: Wie kommt Gott zum Menschen? Sie beleuchtet den Abendmahlsstreit im Kontext der Reformation und die unterschiedlichen Positionen Luthers und Karlstadts. Der zweite Abschnitt beleuchtet die Bedeutung des Abendmahls als zentrales Thema der christlichen Theologie und die Suche nach Wahrheit und Heilsgewissheit. Es wird auf die Bedeutung des Abendmahls als Sakrament und seine Rolle in der Reformation eingegangen. Das dritte Kapitel gibt einen biographischen Überblick über Andreas Karlstadt und stellt sein Verhältnis zu Martin Luther dar. Die anschließenden Abschnitte setzen sich mit Karlstadts theologischer Position und seinem Kirchenverständnis auseinander. Kapitel 6 befasst sich mit der Schrift "Von dem widerchristlichen mißbrauch des hern brodt vnd kelch" und analysiert ihren Inhalt, Aufbau und Kontext. Die Arbeit endet mit einer Betrachtung der Nachwirkungen von Karlstadts Abendmahlslehre und einem Resümee der wichtigsten Erkenntnisse.
Schlüsselwörter
Abendmahl, Reformation, Luther, Karlstadt, Heilsgewissheit, Sakrament, Wort, Glaube, Rechtfertigung, Streitschrift, Theologie, Kirchenverständnis, Realpräsenz, Gedächtnismahl.
Warum kam es zum Streit zwischen Luther und Karlstadt?
Der Hauptgrund war das unterschiedliche Verständnis des Abendmahls, insbesondere die Frage der Realpräsenz Christi in Brot und Wein.
Was war Karlstadts Position zum Abendmahl?
Karlstadt vertrat eine eher symbolische Auffassung und betonte das Gedenken an den Tod Christi, statt eine physische Gegenwart im Sakrament zu sehen.
Was ist die Kernaussage von Karlstadts Schrift gegen den "Mißbrauch"?
Er kritisierte die traditionelle Messe als "widerchristlich" und forderte eine Rückkehr zur biblischen Einsetzung des Abendmahls ohne priesterliche Opfervorstellung.
Wie unterscheidet sich ihr Kirchenverständnis?
Karlstadt strebte eine radikalere Reformation der gottesdienstlichen Praxis und der Kirchenstruktur an als der eher konservative Luther.
Was bedeutet "Heilsgewissheit" in diesem Kontext?
Es ist die zentrale reformatorische Frage, wie der Mensch sicher sein kann, dass Gott ihm gnädig ist – ein Punkt, an dem das Abendmahl eine Schlüsselrolle spielt.
Details
- Titel
- Andreas Karlstadts Abendmahlslehre im Kontext seiner Theologie
- Hochschule
- Universität Wien (Institut für Kirchengeschichte)
- Veranstaltung
- Kirchengeschichtliche Bachelorarbeit
- Note
- 1
- Autor
- Mag.rer.soc.oec., MTh Dietmar Böhmer (Autor:in)
- Erscheinungsjahr
- 2015
- Seiten
- 46
- Katalognummer
- V450270
- ISBN (eBook)
- 9783668847743
- ISBN (Buch)
- 9783668847750
- Sprache
- Deutsch
- Schlagworte
- Luther Karlstadt Bodenstein Abendmahl Abendmahlsstreit Reformation radikale Reformation linker Flügel der Reformation links Sakrament Kommunion Sünde Tod damnatio memoriae Abendmahlsverständnis Sündenvergebung Messopfer Eucharistie Realpräsenz Christus Jesus Evangelium Rechtfertigung Täufer Confessio Augustana Augsburger Bekenntnis Heilsmittelverständnis Heilsmittel Wittenberg
- Produktsicherheit
- GRIN Publishing GmbH
- Preis (Ebook)
- US$ 20,99
- Preis (Book)
- US$ 29,99
- Arbeit zitieren
- Mag.rer.soc.oec., MTh Dietmar Böhmer (Autor:in), 2015, Andreas Karlstadts Abendmahlslehre im Kontext seiner Theologie, München, Page::Imprint:: GRINVerlagOHG, https://www.diplomarbeiten24.de/document/450270