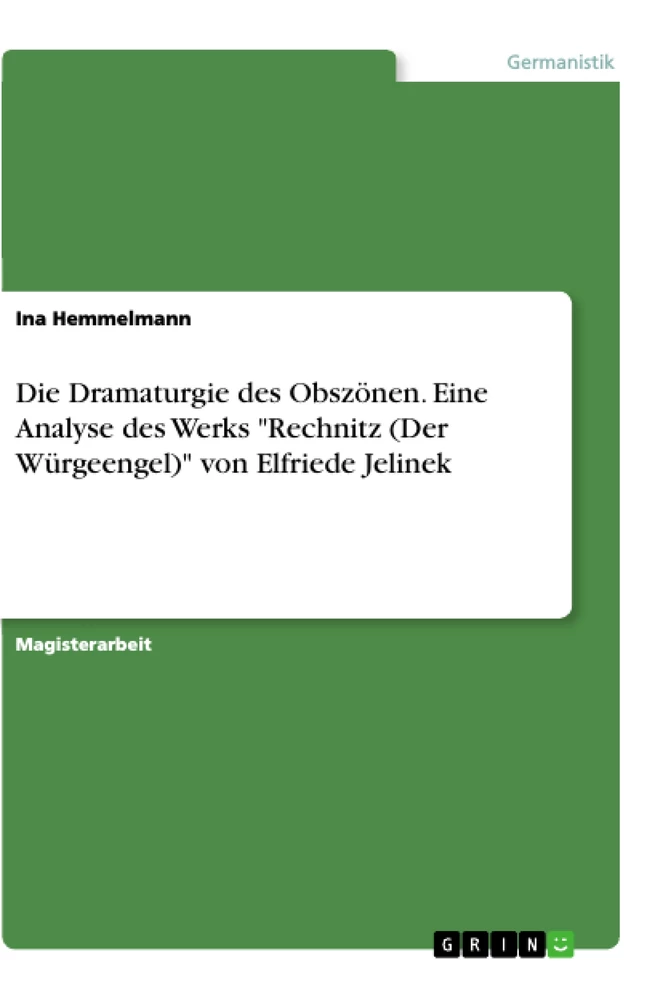
Die Dramaturgie des Obszönen. Eine Analyse des Werks "Rechnitz (Der Würgeengel)" von Elfriede Jelinek
Magisterarbeit, 2013
90 Seiten, Note: 1,3
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
- I. Vorbemerkung
- II. Zur Dramaturgie des Obszönen in Elfriede Jelineks Rechnitz (Der Würgeengel)
- 1. Die Unsagbarkeit des Obszönen
- 1.1. „Über die etymologische Herkunft besteht keine Einigkeit.“
- 1.2. Exkurs: Zur Begriffsgeschichte des Obszönen
- 1.3. Die Problematik der Begriffsdefinition
- 1.4. ob-scaena: Das Obszöne und das Theater
- 1.4.1. Jean Baudrillard: ,,Die Szene und das Obszöne”
- 1.4.2. Hans-Thies Lehmann: „,(Sich) darstellen. Sechs Hinweise auf das Obszöne”
- 2. Rechnitz (Der Würgeengel) obszön lesen
- 2.1. Entstehung und Rezeption von Rechnitz (Der Würgeengel)
- 2.2. Viel Bote, wenig Handlung: Der Botenbericht in Rechnitz (Der Würgeengel)
- 2.3. Intertextuelle Rede in Rechnitz (Der Würgeengel) als Kommentar zum Bühnengeschehen
- 2.4. ,,Ich sehe was, was du nicht siehst ...“: Die Blicke der Boten
- 3. Postdramatisches Theater als obszönes Theater
- 1. Die Unsagbarkeit des Obszönen
- III. Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit untersucht die Dramaturgie des Obszönen in Elfriede Jelineks Stück „Rechnitz (Der Würgeengel)“. Ziel ist es, eine Kategorie des Obszönen zu entwickeln, die spezifische Eigenheiten von Theatertexten beschreibt. Hierfür wird der Begriff „Obszön“ analysiert und auf seine Anwendbarkeit im Kontext des Stücks geprüft.
- Etymologische und begriffliche Analyse des Obszönen
- Dramaturgische Funktion des Obszönen in „Rechnitz (Der Würgeengel)”
- Die Rolle des Botenberichts und der Intertextualität
- Beziehung zwischen Obszönität und postdramatischem Theater
- Die Unsagbarkeit des Holocaust und deren Darstellung
Zusammenfassung der Kapitel
I. Vorbemerkung: Die Vorbemerkung führt in die Thematik ein und stellt die zentrale Fragestellung vor: die Untersuchung der Dramaturgie des Obszönen in Jelineks „Rechnitz (Der Würgeengel)“. Sie verweist auf Jelineks Schreibweise, die das Paradox des Ausdrücken-Wollens, aber Nicht-Sagen-Könnens thematisiert. Die Beschreibung des Stücks als „obszön“ in der Rezeption wird als Ausgangspunkt für die Analyse genommen. Der Begriff „Obszön“ wird eingegrenzt, um ihn für die dramaturgische Lektüre nutzbar zu machen.
II. Zur Dramaturgie des Obszönen in Elfriede Jelineks Rechnitz (Der Würgeengel): Dieser Hauptteil gliedert sich in die Analyse des Begriffs „Obszön“ und dessen Anwendung auf Jelineks Werk. Es wird die Unsagbarkeit des Obszönen untersucht, sowohl in Bezug auf seine etymologische Herleitung als auch in seiner historischen und kulturellen Konnotation. Die Arbeit analysiert verschiedene Perspektiven auf den Begriff, die von Varro bis zu modernen Theatertheorien reichen. Der Fokus liegt dabei auf einer theatralen Lesart, die sich aus der volksetymologischen Wurzel „scaena“ (Bühne) erschließt. Das Kapitel untersucht, wie Jelinek das Grauen des Rechnitzer Massakers auf der Bühne darstellt. Besondere Aufmerksamkeit wird der Struktur des Stücks, dem Botenbericht und der Intertextualität gewidmet.
Schlüsselwörter
Obszön, Dramaturgie, Elfriede Jelinek, Rechnitz (Der Würgeengel), Theater, Postdramatisches Theater, Botenbericht, Intertextualität, Holocaust, Unsagbarkeit, Darstellung des Bösen.
Häufig gestellte Fragen zu Elfriede Jelineks "Rechnitz (Der Würgeengel)"
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht die Dramaturgie des Obszönen in Elfriede Jelineks Theaterstück "Rechnitz (Der Würgeengel)". Sie zielt darauf ab, eine Kategorie des Obszönen zu entwickeln, die spezifische Eigenheiten von Theatertexten beschreibt und die Anwendbarkeit des Begriffs "Obszön" im Kontext des Stücks prüft.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt folgende Themen: die etymologische und begriffliche Analyse des Obszönen, die dramaturgische Funktion des Obszönen in "Rechnitz (Der Würgeengel)", die Rolle des Botenberichts und der Intertextualität, die Beziehung zwischen Obszönität und postdramatischem Theater sowie die Unsagbarkeit des Holocaust und deren Darstellung im Stück.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in eine Vorbemerkung, einen Hauptteil ("Zur Dramaturgie des Obszönen in Elfriede Jelineks Rechnitz (Der Würgeengel)") und einen Ausblick. Der Hauptteil analysiert den Begriff "Obszön" und dessen Anwendung auf Jelineks Werk, untersucht die Unsagbarkeit des Obszönen, betrachtet verschiedene Perspektiven auf den Begriff (von Varro bis zu modernen Theatertheorien) und konzentriert sich auf eine theatralische Lesart des Begriffs. Die Analyse von Jelineks Stück umfasst die Struktur, den Botenbericht und die Intertextualität.
Welche Schlüsselbegriffe sind relevant?
Schlüsselbegriffe sind: Obszön, Dramaturgie, Elfriede Jelinek, Rechnitz (Der Würgeengel), Theater, Postdramatisches Theater, Botenbericht, Intertextualität, Holocaust, Unsagbarkeit, Darstellung des Bösen.
Was ist die zentrale Fragestellung?
Die zentrale Fragestellung ist die Untersuchung der Dramaturgie des Obszönen in Jelineks "Rechnitz (Der Würgeengel)". Dabei wird Jelineks Schreibweise betrachtet, die das Paradox des Ausdrücken-Wollens, aber Nicht-Sagen-Könnens thematisiert. Die Beschreibung des Stücks als „obszön“ in der Rezeption dient als Ausgangspunkt.
Wie wird der Begriff "Obszön" definiert und angewendet?
Der Begriff "Obszön" wird eingegrenzt und analysiert, um ihn für die dramaturgische Lektüre nutzbar zu machen. Die Analyse umfasst die etymologische Herleitung und die historische und kulturelle Konnotation. Der Fokus liegt auf einer theatralen Lesart, die sich aus der volksetymologischen Wurzel „scaena“ (Bühne) erschließt.
Welche Rolle spielen Botenbericht und Intertextualität?
Der Botenbericht und die Intertextualität werden als wichtige Elemente der dramaturgischen Struktur von "Rechnitz (Der Würgeengel)" analysiert und im Hinblick auf ihre Funktion in der Darstellung des Grauens und der Unsagbarkeit des Holocaust untersucht.
Wie wird der Holocaust im Stück dargestellt?
Die Arbeit untersucht, wie Jelinek das Grauen des Rechnitzer Massakers auf der Bühne darstellt, und konzentriert sich dabei auf die Problematik der Unsagbarkeit des Holocaust und dessen Darstellung im Kontext des postdramatischen Theaters.
Details
- Titel
- Die Dramaturgie des Obszönen. Eine Analyse des Werks "Rechnitz (Der Würgeengel)" von Elfriede Jelinek
- Hochschule
- Ludwig-Maximilians-Universität München (Deutsche Philologie)
- Note
- 1,3
- Autor
- Ina Hemmelmann (Autor:in)
- Erscheinungsjahr
- 2013
- Seiten
- 90
- Katalognummer
- V452346
- ISBN (eBook)
- 9783668859517
- ISBN (Buch)
- 9783668859524
- Sprache
- Deutsch
- Schlagworte
- elfriede jelinek rechnitz dramaturgie obszön poststrukturalismus dekonstruktion macht postdramatik
- Produktsicherheit
- GRIN Publishing GmbH
- Preis (Ebook)
- US$ 38,99
- Preis (Book)
- US$ 49,99
- Arbeit zitieren
- Ina Hemmelmann (Autor:in), 2013, Die Dramaturgie des Obszönen. Eine Analyse des Werks "Rechnitz (Der Würgeengel)" von Elfriede Jelinek, München, Page::Imprint:: GRINVerlagOHG, https://www.diplomarbeiten24.de/document/452346
- Autor werden
- Ihre Optionen
- Vertriebskanäle
- Premium Services
- Autorenprofil
- Textarten und Formate
- Services für Verlage, Hochschulen, Unternehmen

- © GRIN Publishing GmbH.
- Alle Inhalte urheberrechtlich geschützt. Kopieren und verbreiten untersagt.
- info@grin.com
- AGB
- Open Publishing
Der GRIN Verlag hat sich seit 1998 auf die Veröffentlichung akademischer eBooks und Bücher spezialisiert. Der GRIN Verlag steht damit als erstes Unternehmen für User Generated Quality Content. Die Verlagsseiten GRIN.com, Hausarbeiten.de und Diplomarbeiten24 bieten für Hochschullehrer, Absolventen und Studenten die ideale Plattform, wissenschaftliche Texte wie Hausarbeiten, Referate, Bachelorarbeiten, Masterarbeiten, Diplomarbeiten, Dissertationen und wissenschaftliche Aufsätze einem breiten Publikum zu präsentieren.
Kostenfreie Veröffentlichung: Hausarbeit, Bachelorarbeit, Diplomarbeit, Dissertation, Masterarbeit, Interpretation oder Referat jetzt veröffentlichen!
- GRIN Verlag GmbH
-
- Nymphenburger Str. 86
- 80636
- Munich, Deutschland
- +49 89-550559-0
- +49 89-550559-10
- info@grin.com
-



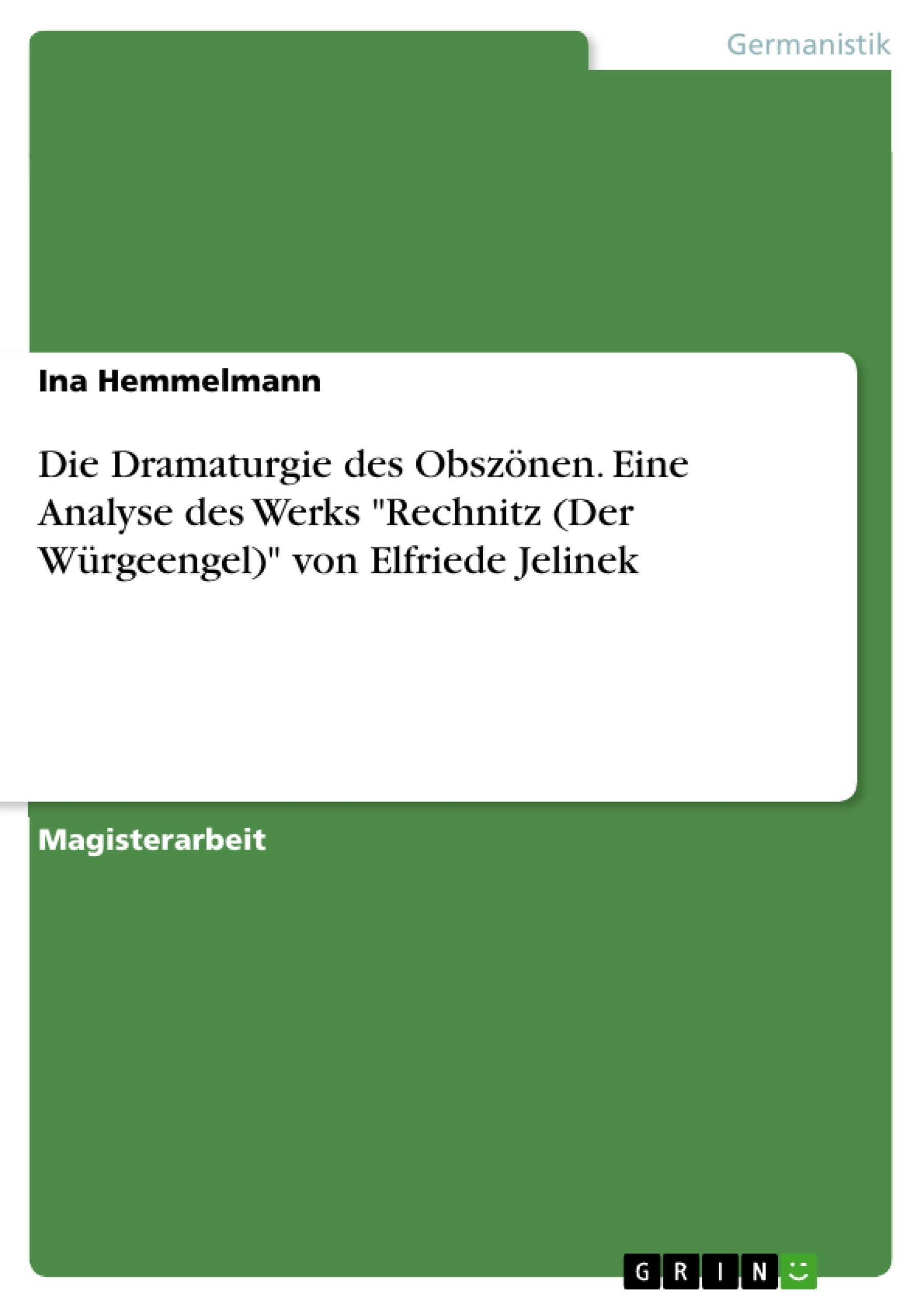






Kommentare