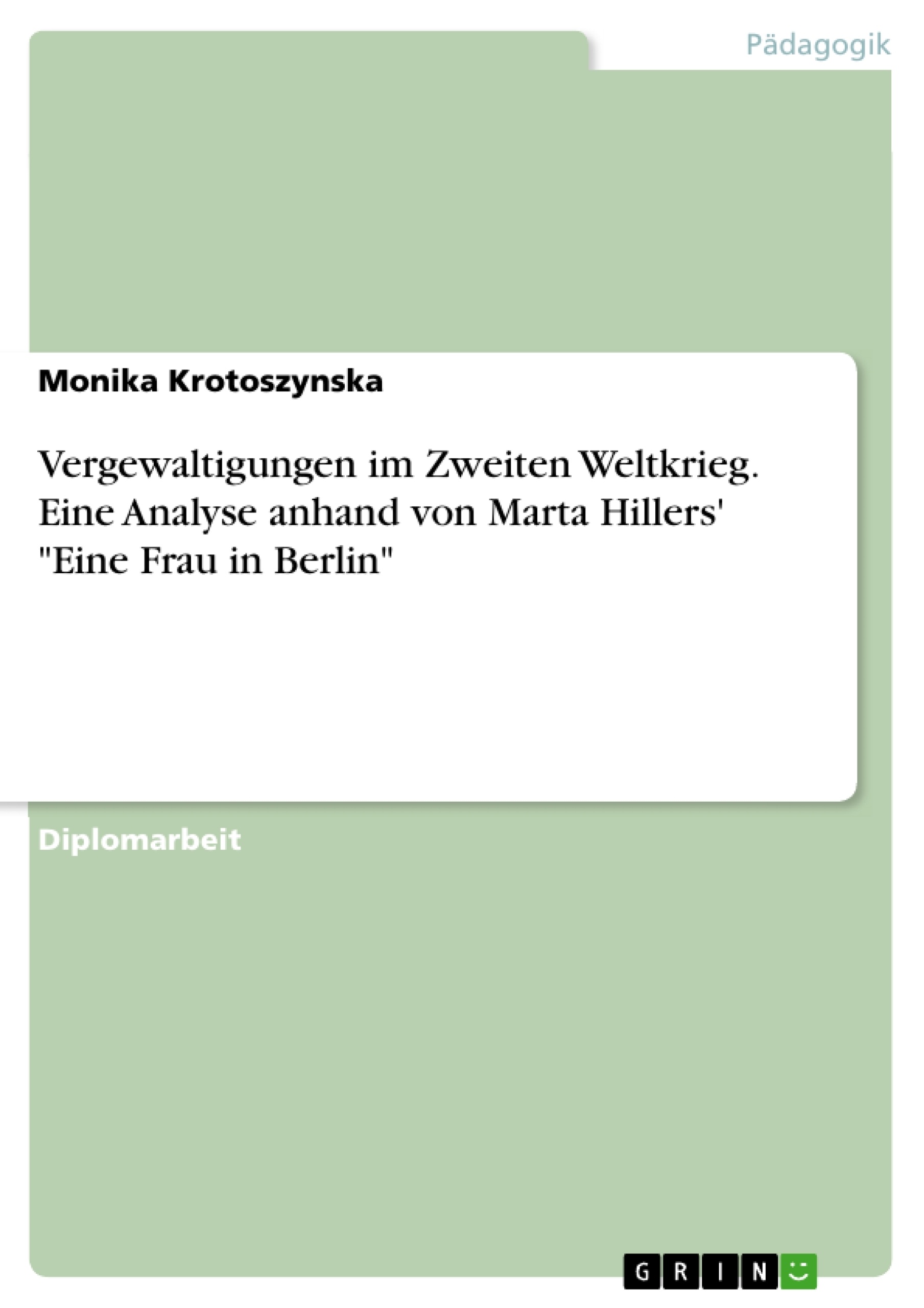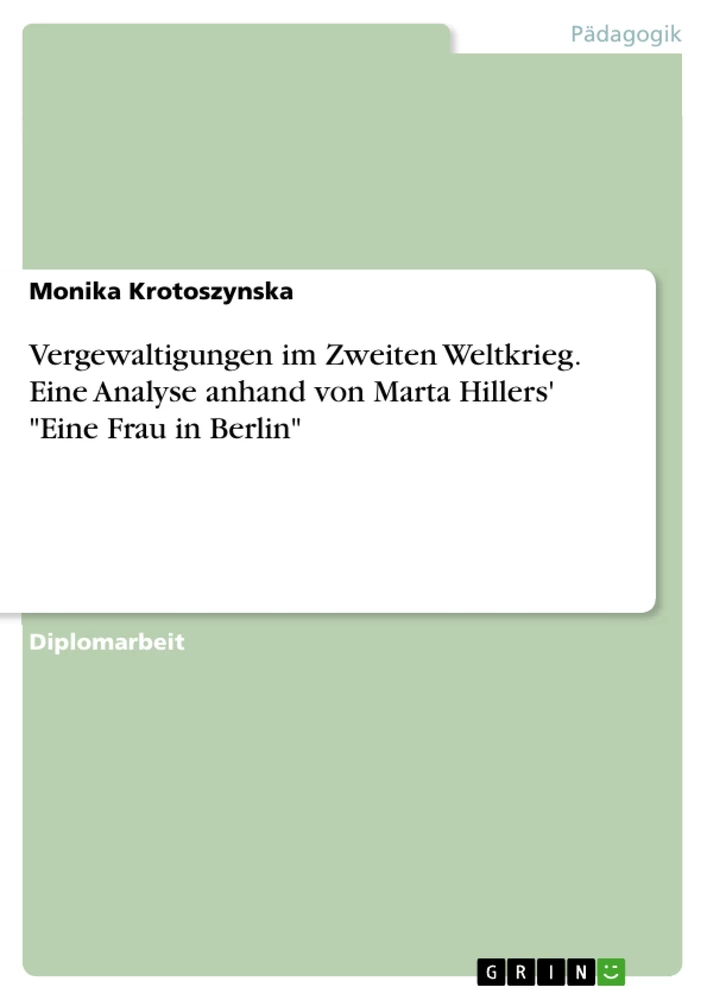
Vergewaltigungen im Zweiten Weltkrieg. Eine Analyse anhand von Marta Hillers' "Eine Frau in Berlin"
Diplomarbeit, 2015
50 Seiten, Note: 1
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
- Vorwort
- Einleitung
- Der Fall Marta Hillers'
- Wer war Marta Hillers?
- Das Tabuthema Vergewaltigung nach 1945
- Marta Hillers' „Eine Frau in Berlin“
- Entstehungsgeschichte des Buches
- Die Tagebuchaufzeichnungen vom 20. April bis 22. Juni 1945 – Marta Hillers' Rolle als Vergewaltigungsopfer plündernder Rotarmisten
- Der Tagebuchcharakter des Buches – hat er literarischen Anspruch?
- Sachbuch, zeitgeschichtliches Dokument oder Pamphlet?
- Die Veröffentlichungs- und Rezeptionsgeschichte des Buches
- Die englische Erstausgabe 1954 und die deutsche Erstauflage 1959
- Wiederauflage des Buches 2003
- Bekanntwerden der Identität der Autorin und Zweifel an der Authentizität der Schilderungen
- Vergewaltigung als Kriegsverbrechen seit dem Jahr 2008
- Verfilmung des Buches 2008 unter der Regie von Max Färberböck und mit Nina Hoss in der Hauptrolle
- Schlussfolgerungen
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit befasst sich mit den Erinnerungen von Marta Hillers und dem Thema Kriegsvergewaltigungen. Ziel ist es, die Schrecken der Vergewaltigungen während des Zweiten Weltkriegs und in der Nachkriegszeit zu beleuchten und die Persönlichkeit von Marta Hillers vorzustellen. Der Zusammenhang zwischen Hillers Tagebuch und den politischen Bestimmungen, betreffend der Vergewaltigungen als Kriegsverbrechen, soll ebenfalls beleuchtet werden.
- Die Erlebnisse von Marta Hillers als Kriegsopfer
- Das Tabuthema Vergewaltigung im Kontext des Zweiten Weltkriegs
- Die Rezeption des Buches "Eine Frau in Berlin"
- Der Kampf um die Aufarbeitung der NS-Zeit
- Die Bedeutung des Tagebuchs von Marta Hillers für die heutige Zeit
Zusammenfassung der Kapitel
- Vorwort: Die Autorin erläutert ihre Motivation, sich mit dem Thema Kriegsverbrechen und insbesondere mit den Erinnerungen von Marta Hillers zu beschäftigen.
- Einleitung: Es werden die Folgen des Zweiten Weltkriegs auf die Gesellschaft und die Aufarbeitung der NS-Zeit beleuchtet. Insbesondere wird die Bedeutung von Kriegsliteratur wie "Eine Frau in Berlin" hervorgehoben.
- Der Fall Marta Hillers': Dieses Kapitel stellt Marta Hillers vor und beleuchtet das Tabuthema der Vergewaltigung in der Nachkriegszeit.
- Marta Hillers' „Eine Frau in Berlin“: Hier werden die Entstehungsgeschichte des Buches, die Rolle von Marta Hillers als Vergewaltigungsopfer und die literarische Qualität des Tagebuches besprochen.
- Die Veröffentlichungs- und Rezeptionsgeschichte des Buches: Dieses Kapitel beleuchtet die Veröffentlichung des Buches in englischer und deutscher Sprache, die Wiederauflage im Jahr 2003, die Bekanntgabe der Identität der Autorin und die Kontroversen um die Authentizität der Schilderungen. Zudem wird die Einstufung der Vergewaltigung als Kriegsverbrechen seit dem Jahr 2008 und die Verfilmung des Buches im Jahr 2008 behandelt.
Schlüsselwörter
Kriegsverbrechen, Vergewaltigung, Zweiter Weltkrieg, Nachkriegszeit, Marta Hillers, "Eine Frau in Berlin", Tagebuch, Authentizität, Rezeption, Verfilmung, Aufarbeitung der NS-Zeit, Erinnerungskultur.
Häufig gestellte Fragen
Wer war Marta Hillers?
Marta Hillers war eine deutsche Journalistin, die durch ihre posthum veröffentlichten Tagebuchaufzeichnungen „Eine Frau in Berlin“ über das Kriegsende 1945 bekannt wurde.
Worum geht es in dem Buch „Eine Frau in Berlin“?
Es beschreibt die Erlebnisse während der sowjetischen Besatzung in Berlin, insbesondere die massenhaften Vergewaltigungen deutscher Frauen durch Rotarmisten und deren Überlebensstrategien.
Warum war das Thema Vergewaltigung nach 1945 ein Tabu?
In der Nachkriegsgesellschaft herrschte Scham und Schweigen über die Verbrechen; Opfer erfuhren oft wenig Empathie oder wurden für ihr Schicksal stigmatisiert.
Ist das Tagebuch von Marta Hillers authentisch?
Die Arbeit beleuchtet die Kontroversen um die Authentizität und die Identität der Autorin, die erst nach der Wiederauflage 2003 verstärkt diskutiert wurden.
Welche politische Bedeutung hat das Werk heute?
Es besteht ein enger Zusammenhang zwischen der Rezeption des Buches und der Anerkennung von Vergewaltigung als Kriegsverbrechen durch die internationale Gemeinschaft seit 2008.
Details
- Titel
- Vergewaltigungen im Zweiten Weltkrieg. Eine Analyse anhand von Marta Hillers' "Eine Frau in Berlin"
- Hochschule
- Uniwersytet Warszawski (Universität Warschau)
- Note
- 1
- Autor
- Monika Krotoszynska (Autor:in)
- Erscheinungsjahr
- 2015
- Seiten
- 50
- Katalognummer
- V455472
- ISBN (eBook)
- 9783668877856
- ISBN (Buch)
- 9783668877863
- Sprache
- Deutsch
- Schlagworte
- vergewaltigungen zweiten weltkrieg eine analyse marta hillers frau berlin
- Produktsicherheit
- GRIN Publishing GmbH
- Preis (Ebook)
- US$ 20,99
- Preis (Book)
- US$ 29,99
- Arbeit zitieren
- Monika Krotoszynska (Autor:in), 2015, Vergewaltigungen im Zweiten Weltkrieg. Eine Analyse anhand von Marta Hillers' "Eine Frau in Berlin", München, Page::Imprint:: GRINVerlagOHG, https://www.diplomarbeiten24.de/document/455472
- Autor werden
- Ihre Optionen
- Vertriebskanäle
- Premium Services
- Autorenprofil
- Textarten und Formate
- Services für Verlage, Hochschulen, Unternehmen

- © GRIN Publishing GmbH.
- Alle Inhalte urheberrechtlich geschützt. Kopieren und verbreiten untersagt.
- info@grin.com
- AGB
- Open Publishing
Der GRIN Verlag hat sich seit 1998 auf die Veröffentlichung akademischer eBooks und Bücher spezialisiert. Der GRIN Verlag steht damit als erstes Unternehmen für User Generated Quality Content. Die Verlagsseiten GRIN.com, Hausarbeiten.de und Diplomarbeiten24 bieten für Hochschullehrer, Absolventen und Studenten die ideale Plattform, wissenschaftliche Texte wie Hausarbeiten, Referate, Bachelorarbeiten, Masterarbeiten, Diplomarbeiten, Dissertationen und wissenschaftliche Aufsätze einem breiten Publikum zu präsentieren.
Kostenfreie Veröffentlichung: Hausarbeit, Bachelorarbeit, Diplomarbeit, Dissertation, Masterarbeit, Interpretation oder Referat jetzt veröffentlichen!
- GRIN Verlag GmbH
-
- Nymphenburger Str. 86
- 80636
- Munich, Deutschland
- +49 89-550559-0
- +49 89-550559-10
- info@grin.com
-