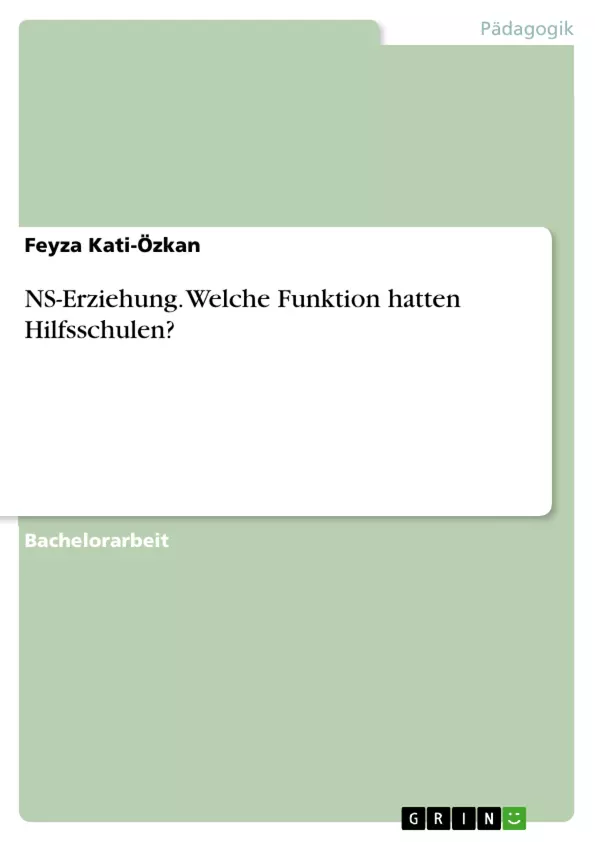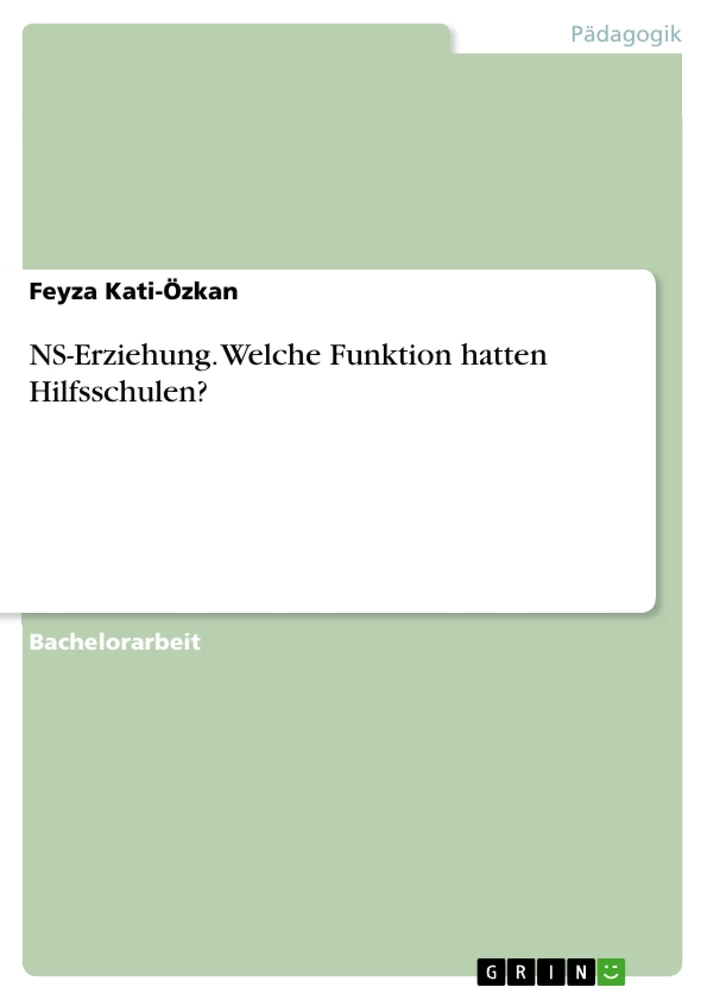
NS-Erziehung. Welche Funktion hatten Hilfsschulen?
Bachelorarbeit, 2018
34 Seiten, Note: 2,3
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Hilfsschulen im historischen Kontext
- Von der Eugenik zur Euthanasie
- Zwangssterilisation
- Die Nationalsozialistische Gesundheitspolitik
- Hitlers Rassenhygiene
- Legitimation der Hilfsschulen
- Erziehung und Bildung in der Hilfsschule
- Die Verwaltung der Hilfsschule
- Lehrplan und Lehrmittel
- Klassengröße, Schülerzahl und Stundenumfang
- Die Hilfsschule als „Sammelstelle“
- Die Hilfsschüler als Mitglieder der Gesellschaft
- Die Ausbildung der Hilfsschullehrer
- Das Bild der Hilfsschullehrerschaft
- Rassenideologie als Maßstab?
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Bachelorarbeit befasst sich mit der Funktion von Hilfsschulen in der NS-Zeit. Sie untersucht die Rolle der Erziehung und Bildung in diesen Einrichtungen unter dem nationalsozialistischen Regime. Die Arbeit beleuchtet die historischen Hintergründe, insbesondere die Rassenhygiene und das Euthanasieprogramm Hitlers, um zu verstehen, wie die Hilfsschulen in den Gesamtkontext der nationalsozialistischen Ideologie eingebunden waren.
- Die historische Entwicklung der Hilfsschulen bis 1933
- Die Rolle der Rassenhygiene und des Euthanasieprogramms im Kontext der Hilfsschulen
- Die Erziehung und Bildung in den Hilfsschulen unter dem NS-Regime
- Die Funktion und Intention der Hilfsschullehrer/innen
- Die Auswirkungen der NS-Ideologie auf die Hilfsschulen
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt die Forschungsfrage nach der Funktion von Hilfsschulen in der NS-Zeit und benennt die Leitfragen der Arbeit. Kapitel 2 bietet einen historischen Überblick über die Entwicklung der Hilfsschulen bis 1933, um die Ausgangslage vor der Machtergreifung der Nationalsozialisten zu verdeutlichen.
Kapitel 3 untersucht die Einflüsse der Rassenhygiene und des Euthanasieprogramms Hitlers auf die Hilfsschulen. Es beleuchtet die Legitimation der Hilfsschulen im Kontext der nationalsozialistischen Gesundheitspolitik.
Kapitel 4 analysiert die Erziehung und Bildung in den Hilfsschulen unter dem NS-Regime. Es behandelt die Verwaltung, den Lehrplan, die Schülerzahl und die Ausbildung der Hilfsschullehrer/innen.
Schlüsselwörter
Hilfsschule, NS-Zeit, Erziehung, Bildung, Sonderpädagogik, Rassenhygiene, Euthanasie, Zwangssterilisation, Rassenideologie, Hilfsschullehrer/innen, Inklusion, Exklusion
Häufig gestellte Fragen
Welche Funktion hatten Hilfsschulen im Nationalsozialismus?
Sie dienten oft als „Sammelstellen“ zur Erfassung und Selektion von Kindern mit Beeinträchtigungen im Sinne der nationalsozialistischen Rassenhygiene.
Was bedeutete das "Gesetz zur Verhütung erbkranken Nachwuchses" für Schüler?
Es führte zur Zwangssterilisation vieler Hilfsschüler, um deren Fortbestand zu verhindern und die deutsche Bevölkerung nach NS-Ideologie zu „bereinigen“.
Wie verhielten sich Hilfsschullehrer während der NS-Zeit?
Die Arbeit untersucht, inwieweit die Lehrerschaft die rassenpolitischen Vorgaben des Regimes aktiv unterstützte und umsetzte.
Wurden Hilfsschüler in der NS-Zeit gefördert?
Die ursprüngliche Idee der Hilfe wurde pervertiert; Bildung wurde durch Rassenideologie ersetzt, und viele Kinder wurden letztlich diskriminiert oder sogar ermordet.
Was war der Unterschied zwischen Hilfsschulen vor und nach 1933?
Vor 1933 stand der Fördergedanke im Vordergrund; ab 1933 wurden die Schulen Instrumente der Ausgrenzung und Vorbereitung für eugenische Maßnahmen.
Details
- Titel
- NS-Erziehung. Welche Funktion hatten Hilfsschulen?
- Hochschule
- Universität Paderborn
- Note
- 2,3
- Autor
- Feyza Kati-Özkan (Autor:in)
- Erscheinungsjahr
- 2018
- Seiten
- 34
- Katalognummer
- V459452
- ISBN (eBook)
- 9783668904941
- ISBN (Buch)
- 9783668904958
- Sprache
- Deutsch
- Anmerkungen
- Schlagworte
- ns-erziehung welche funktion hilfsschulen
- Produktsicherheit
- GRIN Publishing GmbH
- Preis (Ebook)
- US$ 15,99
- Preis (Book)
- US$ 21,99
- Arbeit zitieren
- Feyza Kati-Özkan (Autor:in), 2018, NS-Erziehung. Welche Funktion hatten Hilfsschulen?, München, Page::Imprint:: GRINVerlagOHG, https://www.diplomarbeiten24.de/document/459452
- Autor werden
- Ihre Optionen
- Vertriebskanäle
- Premium Services
- Autorenprofil
- Textarten und Formate
- Services für Verlage, Hochschulen, Unternehmen

- © GRIN Publishing GmbH.
- Alle Inhalte urheberrechtlich geschützt. Kopieren und verbreiten untersagt.
- info@grin.com
- AGB
- Open Publishing
Der GRIN Verlag hat sich seit 1998 auf die Veröffentlichung akademischer eBooks und Bücher spezialisiert. Der GRIN Verlag steht damit als erstes Unternehmen für User Generated Quality Content. Die Verlagsseiten GRIN.com, Hausarbeiten.de und Diplomarbeiten24 bieten für Hochschullehrer, Absolventen und Studenten die ideale Plattform, wissenschaftliche Texte wie Hausarbeiten, Referate, Bachelorarbeiten, Masterarbeiten, Diplomarbeiten, Dissertationen und wissenschaftliche Aufsätze einem breiten Publikum zu präsentieren.
Kostenfreie Veröffentlichung: Hausarbeit, Bachelorarbeit, Diplomarbeit, Dissertation, Masterarbeit, Interpretation oder Referat jetzt veröffentlichen!
- GRIN Verlag GmbH
-
- Nymphenburger Str. 86
- 80636
- Munich, Deutschland
- +49 89-550559-0
- +49 89-550559-10
- info@grin.com
-