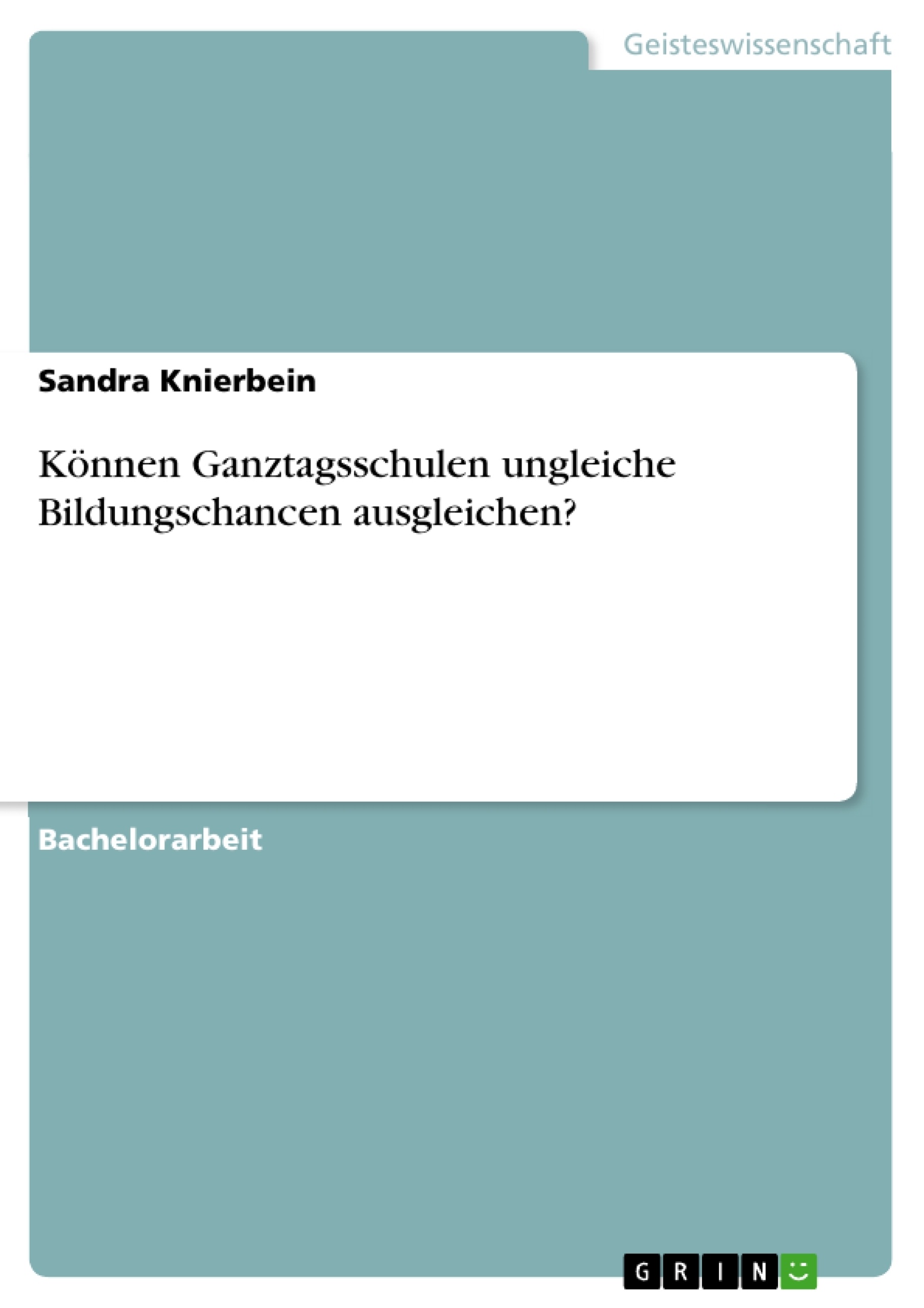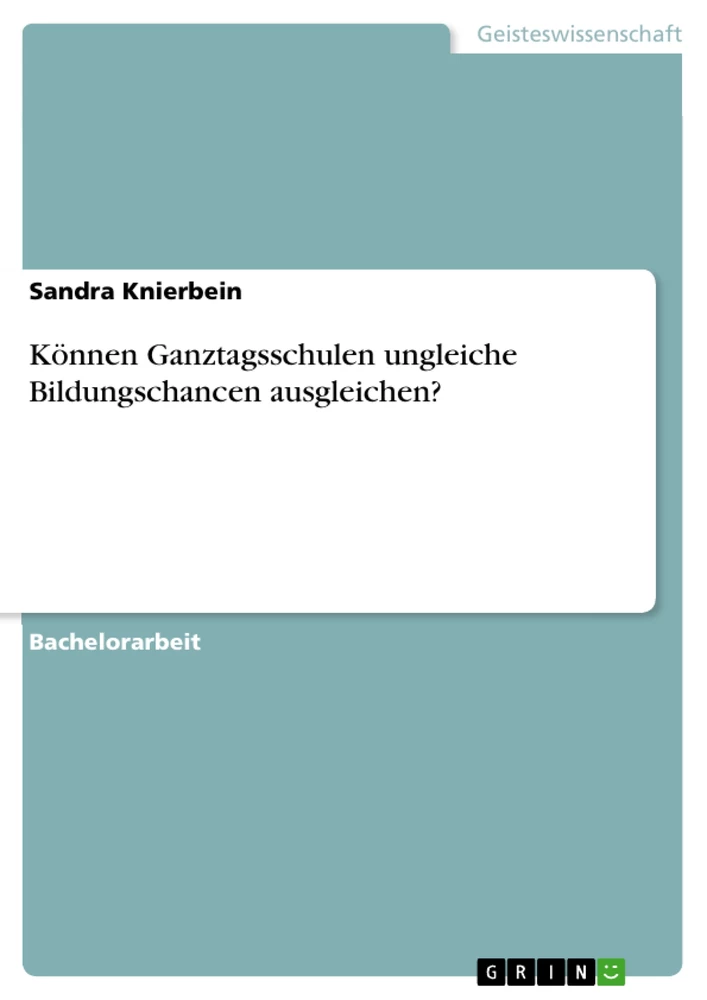
Können Ganztagsschulen ungleiche Bildungschancen ausgleichen?
Bachelorarbeit, 2016
48 Seiten, Note: 1.8
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einleitung
- 2 Grundlagen zur Armut
- 2.1 Der Armutsbegriff
- 2.1.1 Armutskonzepte
- 2.1.2 Die Bedeutung von Armut im Kindes- und Jugendalter
- 2.2 Das Ausmaß der Armut
- 2.1 Der Armutsbegriff
- 3 Folgen von Kinder- und Jugendarmut
- 3.1 Die kulturelle Lebenslagedimension
- 3.1.1 Beeinflussung durch die Eltern
- 3.1.2 Sortierung nach Herkunft in der Schule
- 3.3 Einflüsse auf die Schwere der Folgen
- 3.1 Die kulturelle Lebenslagedimension
- 4 Kompensation ungleicher Bildungschancen durch Ganztagsschulen
- 4.1 Entstehung, Intention und Entwicklung von Ganztagsschulen
- 4.2 Empirische Ergebnisse über Wirkungen nach StEG
- 4.3 Möglichkeiten und Voraussetzungen der gebundenen Ganztagsschule
- 5 Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Bachelorarbeit befasst sich mit der Problematik ungleicher Bildungschancen von Kindern und Jugendlichen, die durch Armut entstehen. Die Arbeit untersucht die Auswirkungen von Kinder- und Jugendarmut auf Bildungsverläufe und analysiert, ob Ganztagsschulen als Instrument des Ausgleichs dienen können.
- Armutskonzepte und -definitionen im Kontext von Kinder- und Jugendarmut
- Die Auswirkungen von Kinder- und Jugendarmut auf Bildungschancen
- Die Rolle von Ganztagsschulen bei der Kompensation von Bildungsnachteilen
- Empirische Studien zu den Wirkungen von Ganztagsschulen
- Möglichkeiten und Voraussetzungen für eine effektive Gestaltung von Ganztagsschulen
Zusammenfassung der Kapitel
Die Arbeit beginnt mit einer Einführung in das Thema und stellt die Relevanz von Kinder- und Jugendarmut in Deutschland dar. Im zweiten Kapitel werden die Grundlagen von Armut und insbesondere Kinder- und Jugendarmut definiert und erläutert. Das dritte Kapitel beleuchtet die Folgen von Kinder- und Jugendarmut auf die Bildungschancen von Kindern und Jugendlichen, insbesondere im schulischen Kontext. Im Fokus steht dabei der Übergang von der Grundschule zur Sekundarstufe I und die damit verbundenen Herausforderungen. Das vierte Kapitel konzentriert sich auf die Rolle von Ganztagsschulen als Instrument der Bildungsgerechtigkeit. Es werden Entstehung, Intention und Entwicklung von Ganztagsschulen analysiert, empirische Befunde zur Wirkung von Ganztagsschulen betrachtet und Möglichkeiten zur Kompensation von Bildungsnachteilen durch Ganztagsschulen aufgezeigt.
Schlüsselwörter
Kinder- und Jugendarmut, Bildungschancen, Ganztagsschule, Kompensation, Bildungsungleichheit, empirische Forschung, Chancengleichheit, soziale Herkunft.
Details
- Titel
- Können Ganztagsschulen ungleiche Bildungschancen ausgleichen?
- Hochschule
- Technische Universität Dortmund
- Note
- 1.8
- Autor
- Sandra Knierbein (Autor:in)
- Erscheinungsjahr
- 2016
- Seiten
- 48
- Katalognummer
- V461156
- ISBN (eBook)
- 9783668891449
- ISBN (Buch)
- 9783668891456
- Sprache
- Deutsch
- Schlagworte
- Armut Jugendarmut Kinderarmut Bildungschancen Bildungsungerechtigkeit Ganztagschule Bildungsgerechtigkeit Chancengleichheit Benachteiligung Bildungsbenachteiligung Armutsfolgen
- Produktsicherheit
- GRIN Publishing GmbH
- Preis (Ebook)
- US$ 20,99
- Preis (Book)
- US$ 29,99
- Arbeit zitieren
- Sandra Knierbein (Autor:in), 2016, Können Ganztagsschulen ungleiche Bildungschancen ausgleichen?, München, Page::Imprint:: GRINVerlagOHG, https://www.diplomarbeiten24.de/document/461156
- Autor werden
- Ihre Optionen
- Vertriebskanäle
- Premium Services
- Autorenprofil
- Textarten und Formate
- Services für Verlage, Hochschulen, Unternehmen

- © GRIN Publishing GmbH.
- Alle Inhalte urheberrechtlich geschützt. Kopieren und verbreiten untersagt.
- info@grin.com
- AGB
- Open Publishing
Der GRIN Verlag hat sich seit 1998 auf die Veröffentlichung akademischer eBooks und Bücher spezialisiert. Der GRIN Verlag steht damit als erstes Unternehmen für User Generated Quality Content. Die Verlagsseiten GRIN.com, Hausarbeiten.de und Diplomarbeiten24 bieten für Hochschullehrer, Absolventen und Studenten die ideale Plattform, wissenschaftliche Texte wie Hausarbeiten, Referate, Bachelorarbeiten, Masterarbeiten, Diplomarbeiten, Dissertationen und wissenschaftliche Aufsätze einem breiten Publikum zu präsentieren.
Kostenfreie Veröffentlichung: Hausarbeit, Bachelorarbeit, Diplomarbeit, Dissertation, Masterarbeit, Interpretation oder Referat jetzt veröffentlichen!
- GRIN Verlag GmbH
-
- Nymphenburger Str. 86
- 80636
- Munich, Deutschland
- +49 89-550559-0
- +49 89-550559-10
- info@grin.com
-