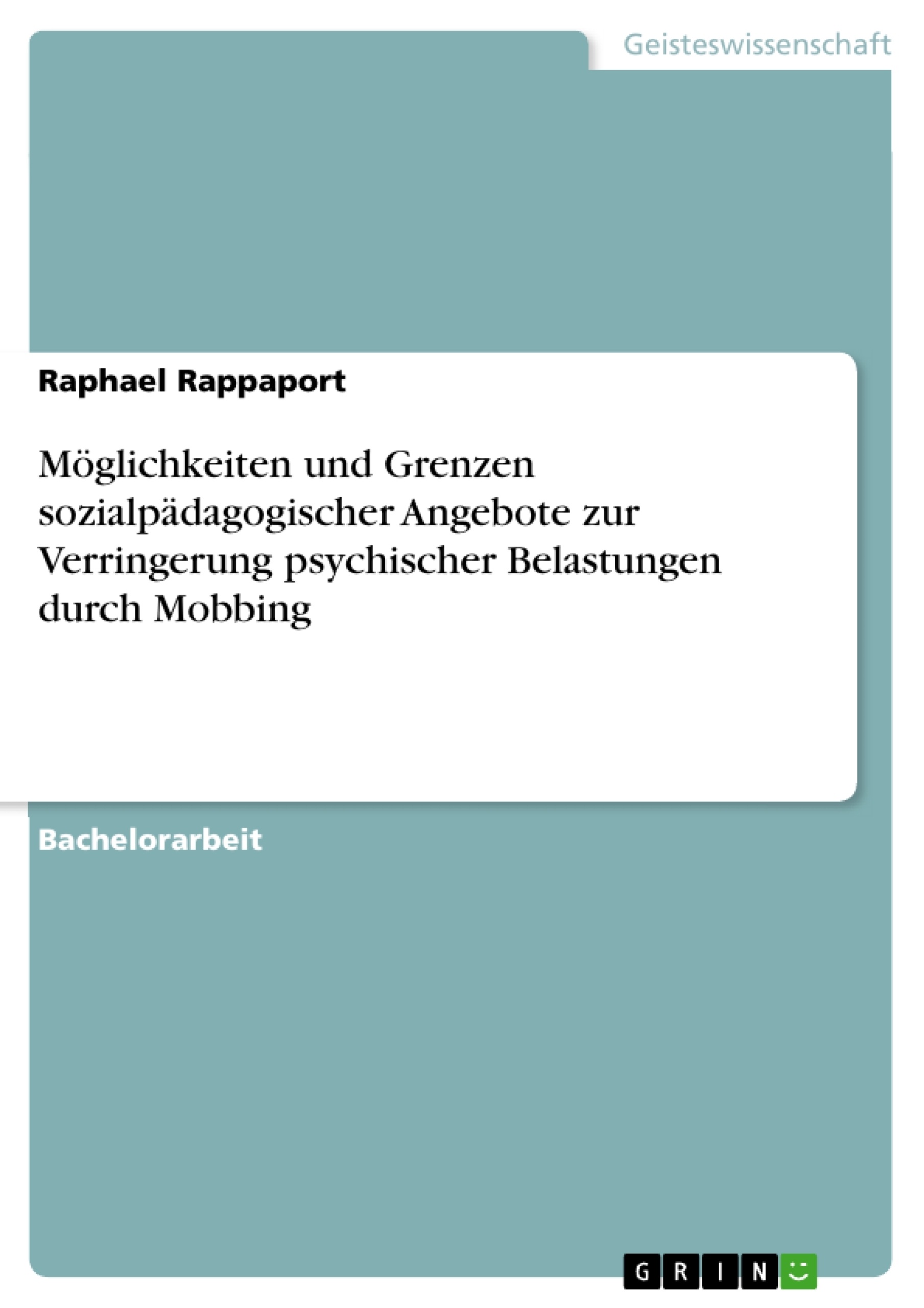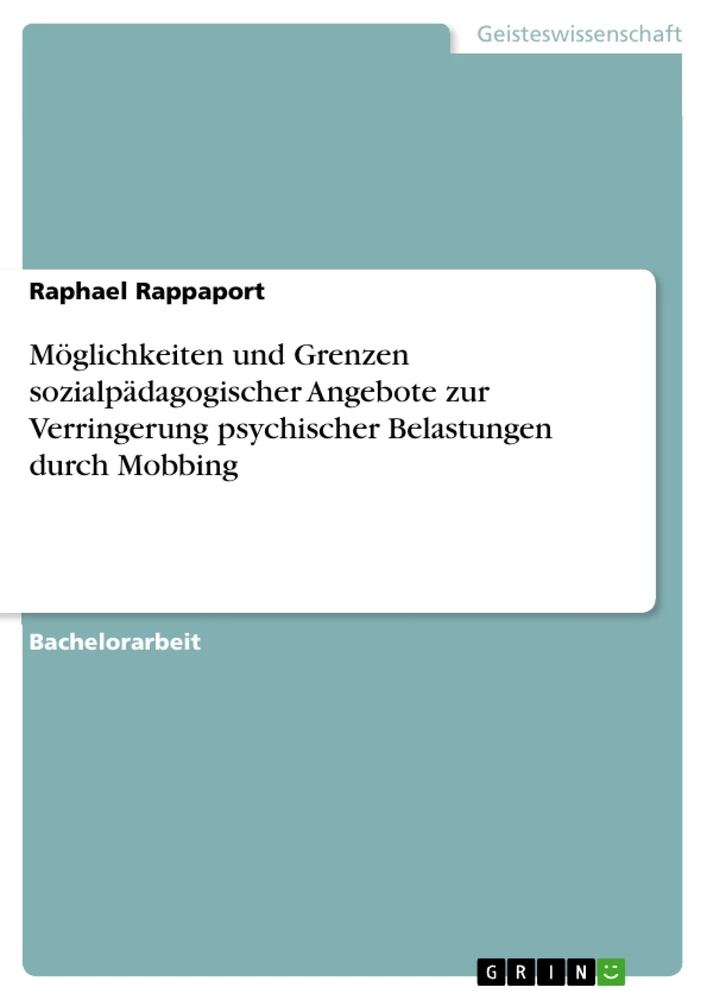
Möglichkeiten und Grenzen sozialpädagogischer Angebote zur Verringerung psychischer Belastungen durch Mobbing
Bachelorarbeit, 2019
49 Seiten, Note: 1,7
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einleitung
- 2 Begrifflichkeiten und Definition
- 2.1 Definition Mobbing/Bullying
- 3 Auftreten in Schule
- 3.1 Häufigkeit von Bullying
- 3.2 Bullying- Ein Problem der Schule?
- 4 Struktur von Bullying
- 4.1 Wer sind die Mobber?
- 4.2 Ziele der Mobber
- 4.3 Wer sind die Opfer?
- 4.4 Ursachen und Risikofaktoren von Bullying
- 4.5 Phasen der Viktimisierung
- 4.6 Phasen des Bullyings
- 5 Psychische Folgen
- 6 Schulsozialarbeit
- 6.1 Historische Einordnung
- 6.2 Definition
- 6.3 Arbeitsbereiche der Schulsozialarbeit
- 6.4 Methoden der Schulsozialarbeit
- 7 Handlungsansätze bei Bullying
- 7.1 Anti-Bullying Interventionsprogramm
- 7.2 ,,No Blame Approach"
- 7.3 ,,Farsta Methode"
- 7.4 Das Buddy-Projekt
- 7.5 ,,BE-PROX"
- 8 Verringerung psychischer Belastung?
- 8.1 Fazit aus dem Forschungsstand
- 8.2 Fazit aus der Analyse der Praxisprogramme
- 8.3 Fazit zu Möglichkeiten und Grenzen
- 9 Diskussion
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Bachelorarbeit befasst sich mit der Thematik Mobbing an Schulen und untersucht die Möglichkeiten und Grenzen sozialpädagogischer Angebote zur Verringerung psychischer Belastungen durch Mobbing. Die Arbeit befasst sich mit der Entstehung, der Struktur und dem Ablauf von Mobbing-Verhaltensmustern und untersucht die Aktualität des Problems. Im Anschluss wird die Rolle der Schulsozialarbeit beleuchtet, gängige Programme vorgestellt und deren Fokus auf die Reduzierung psychischer Belastung untersucht.
- Definition und Abgrenzung der Begriffe Mobbing und Bullying
- Häufigkeit und Auswirkungen von Mobbing in Schulen
- Struktur und Phasen von Mobbing
- Psychische Folgen von Mobbing für Opfer
- Rolle der Schulsozialarbeit bei der Prävention und Intervention von Mobbing
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung der Bachelorarbeit führt mit einem Zitat die Problematik von Mobbing ein und zeigt die Relevanz des Themas auf. Es werden aktuelle Studien zitiert, die die weitreichenden Folgen von Mobbing für Kinder und Jugendliche beleuchten.
Kapitel 2 beleuchtet die Begriffe „Mobbing“ und „Bullying“ und untersucht deren unterschiedliche Bedeutungen in verschiedenen Sprachräumen. Es wird die Entwicklung des Begriffes „Mobbing“ und dessen heutige Verwendung im deutschen Sprachraum dargestellt.
Kapitel 3 beleuchtet das Auftreten von Mobbing in Schulen und untersucht die Häufigkeit von Bullying-Vorfällen. Es wird die Frage gestellt, ob Bullying ein spezifisches Problem der Schule ist.
Kapitel 4 beleuchtet die Struktur von Bullying und untersucht verschiedene Aspekte wie die Identifizierung der Mobber, die Ziele des Mobbings und die Charakteristika der Opfer. Des Weiteren werden Ursachen und Risikofaktoren für Bullying und die Phasen der Viktimisierung sowie die Phasen des Bullyings untersucht.
Kapitel 5 beschäftigt sich mit den psychischen Folgen von Mobbing für Opfer. Es werden die Auswirkungen von Mobbing auf die psychische Gesundheit von Kindern und Jugendlichen dargestellt.
Kapitel 6 beleuchtet die Rolle der Schulsozialarbeit und deren historische Entwicklung, Definition und Arbeitsbereiche. Außerdem werden Methoden der Schulsozialarbeit vorgestellt.
Kapitel 7 stellt verschiedene Handlungsansätze im Kontext von Mobbing vor, wie z.B. Anti-Bullying-Interventionsprogramme, den „No Blame Approach“ und die „Farsta Methode“. Das Buddy-Projekt und „BE-PROX“ werden ebenfalls vorgestellt.
Kapitel 8 untersucht die Möglichkeiten und Grenzen der Verringerung psychischer Belastung durch Mobbing und zieht ein Fazit aus dem Forschungsstand und der Analyse der Praxisprogramme.
Kapitel 9 enthält eine Diskussion der Thematik Mobbing mit Einordnung und möglichen Lösungsansätzen.
Schlüsselwörter
Die Bachelorarbeit beschäftigt sich mit der Thematik Mobbing, Bullying, Schulsozialarbeit, Prävention, Intervention, psychische Belastung, soziale Handlungsansätze und aktuelle Forschungsbefunde.
Häufig gestellte Fragen
Was ist der Unterschied zwischen Mobbing und Bullying?
Die Begriffe werden oft synonym verwendet, wobei Bullying meist das aggressive Verhalten im schulischen Kontext und Mobbing eher den Prozess in Arbeitswelten beschreibt.
Welche psychischen Folgen hat Mobbing für Opfer?
Die Folgen reichen von Angstzuständen und Depressionen bis hin zu psychosomatischen Beschwerden und langfristigen Beeinträchtigungen des Selbstwertgefühls.
Was ist der „No Blame Approach“?
Ein lösungsorientierter Ansatz in der Schulsozialarbeit, der ohne Schuldzuweisungen arbeitet und stattdessen die Unterstützungsgruppe des Opfers in die Lösung einbezieht.
Welche Rolle spielt die Schulsozialarbeit bei Mobbing?
Sie fungiert als Schnittstelle für Prävention und Intervention, bietet Beratung für Betroffene an und implementiert Anti-Mobbing-Programme in den Schulalltag.
Was versteht man unter dem „Buddy-Projekt“?
Ein Präventionsprogramm, bei dem Schüler als Vertrauenspersonen (Buddies) für andere Schüler agieren, um ein positives und gewaltfreies Schulklima zu fördern.
Details
- Titel
- Möglichkeiten und Grenzen sozialpädagogischer Angebote zur Verringerung psychischer Belastungen durch Mobbing
- Hochschule
- Medical School Hamburg
- Note
- 1,7
- Autor
- Raphael Rappaport (Autor:in)
- Erscheinungsjahr
- 2019
- Seiten
- 49
- Katalognummer
- V464361
- ISBN (eBook)
- 9783668934368
- ISBN (Buch)
- 9783668934375
- Sprache
- Deutsch
- Schlagworte
- Mobbing Bullying Schikane Prävention Intervention Schule
- Produktsicherheit
- GRIN Publishing GmbH
- Preis (Ebook)
- US$ 19,99
- Preis (Book)
- US$ 29,99
- Arbeit zitieren
- Raphael Rappaport (Autor:in), 2019, Möglichkeiten und Grenzen sozialpädagogischer Angebote zur Verringerung psychischer Belastungen durch Mobbing, München, Page::Imprint:: GRINVerlagOHG, https://www.diplomarbeiten24.de/document/464361
- Autor werden
- Ihre Optionen
- Vertriebskanäle
- Premium Services
- Autorenprofil
- Textarten und Formate
- Services für Verlage, Hochschulen, Unternehmen

- © GRIN Publishing GmbH.
- Alle Inhalte urheberrechtlich geschützt. Kopieren und verbreiten untersagt.
- info@grin.com
- AGB
- Open Publishing
Der GRIN Verlag hat sich seit 1998 auf die Veröffentlichung akademischer eBooks und Bücher spezialisiert. Der GRIN Verlag steht damit als erstes Unternehmen für User Generated Quality Content. Die Verlagsseiten GRIN.com, Hausarbeiten.de und Diplomarbeiten24 bieten für Hochschullehrer, Absolventen und Studenten die ideale Plattform, wissenschaftliche Texte wie Hausarbeiten, Referate, Bachelorarbeiten, Masterarbeiten, Diplomarbeiten, Dissertationen und wissenschaftliche Aufsätze einem breiten Publikum zu präsentieren.
Kostenfreie Veröffentlichung: Hausarbeit, Bachelorarbeit, Diplomarbeit, Dissertation, Masterarbeit, Interpretation oder Referat jetzt veröffentlichen!
- GRIN Verlag GmbH
-
- Nymphenburger Str. 86
- 80636
- Munich, Deutschland
- +49 89-550559-0
- +49 89-550559-10
- info@grin.com
-