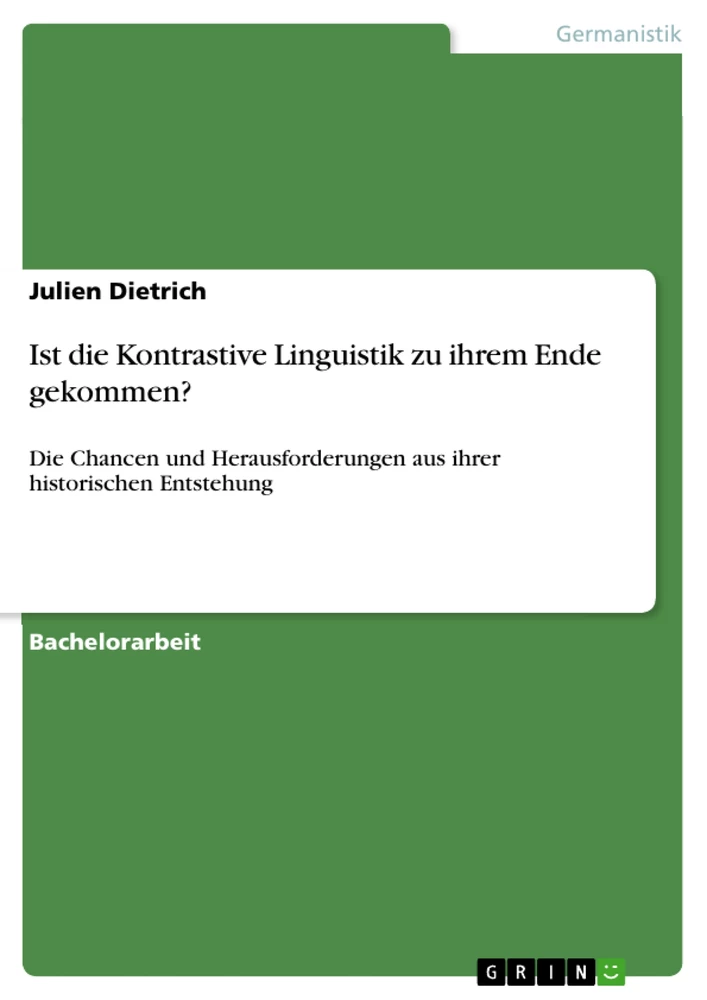
Ist die Kontrastive Linguistik zu ihrem Ende gekommen?
Bachelorarbeit, 2018
39 Seiten, Note: 1,7
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Die vergleichende Sprachwissenschaft und ihre Teildisziplinen
- Die Kontrastive Linguistik und ihr historischer Verlauf
- Begriffsbestimmung, Gegenstand und Ziele
- Der Beginn der Kontrastiven Linguistik
- Die 3 großen Spracherwerbshypothesen
- Die Kontrastivhypothese
- Die Identitätshypothese
- Die Interlanguage-Hypothese
- Historisch-vergleichende Sprachwissenschaft
- Sprachtypologie
- Areallinguistik
- Die Kontrastive Linguistik und ihr historischer Verlauf
- Das tertium comparationis
- Die Rolle der KL im Fremdsprachenunterricht
- Ausblick der Kontrastiven Linguistik
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Chancen und Herausforderungen, die sich für die Kontrastive Linguistik seit ihrer Entstehung ergeben haben. Sie befasst sich mit der Frage, ob die Kontrastive Linguistik nur ein vorübergehender Trend war und ob von einem Ende der Disziplin gesprochen werden kann.
- Einordnung der Kontrastiven Linguistik innerhalb der vergleichenden Sprachwissenschaft
- Die Bedeutung des tertium comparationis für die Kontrastive Linguistik
- Die Rolle der Kontrastiven Linguistik im Fremdsprachenunterricht
- Ein Ausblick auf die zukünftige Entwicklung der Kontrastiven Linguistik
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Die Einleitung stellt den Forschungsgegenstand und die Fragestellung der Arbeit vor. Sie beleuchtet die historische Entwicklung der Kontrastiven Linguistik und die Kritik, die sie seit ihrem Entstehen erfuhr.
- Die vergleichende Sprachwissenschaft und ihre Teildisziplinen: Dieses Kapitel beschreibt die Entwicklung der vergleichenden Sprachwissenschaft und ihre Teildisziplinen, wie die historisch-vergleichende Sprachwissenschaft, die Sprachtypologie und die Areallinguistik. Es wird die Frage aufgeworfen, ob die Kontrastive Linguistik als Zweig der vergleichenden Sprachwissenschaft betrachtet werden kann.
- Das tertium comparationis: Dieses Kapitel beschäftigt sich mit der Bedeutung des tertium comparationis für die Kontrastive Linguistik. Es stellt die besondere Herausforderung dar, die der Vergleich von Sprachen mit sich bringt, da eine gemeinsame Bezugsgröße benötigt wird.
- Die Rolle der KL im Fremdsprachenunterricht: Dieses Kapitel beleuchtet die Rolle der Kontrastiven Linguistik im Fremdsprachenunterricht. Es untersucht, welche Möglichkeiten die Kontrastive Linguistik der Fremdsprachendidaktik bietet und ob sie im Vergleich zu ihren Anfängen eine grundlegende Neuausrichtung erfahren hat.
Schlüsselwörter
Die Arbeit befasst sich mit den zentralen Themen der Kontrastiven Linguistik, der vergleichenden Sprachwissenschaft, dem tertium comparationis, dem Fremdsprachenunterricht und der historischen Entwicklung der Disziplin. Die Arbeit analysiert die Chancen und Herausforderungen der Kontrastiven Linguistik und untersucht, ob die Disziplin in eine Krise geraten ist oder ob sie weiterhin eine relevante Rolle in der Sprachwissenschaft spielt.
Häufig gestellte Fragen
Was ist das Hauptziel der Kontrastiven Linguistik?
Sie untersucht Ähnlichkeiten und Unterschiede zwischen zwei Sprachen, meist um den Fremdsprachenunterricht effektiver zu gestalten.
Warum geriet die Kontrastive Linguistik in eine Krise?
Sie stieß auf Kritik, da die Annahme, Unterschiede zwischen Sprachen seien die einzige Quelle für Lernschwierigkeiten, als zu einseitig angesehen wurde.
Was bedeutet der Begriff „tertium comparationis“?
Es bezeichnet die gemeinsame Vergleichsbasis oder Bezugsgröße, die notwendig ist, um zwei verschiedene Sprachen wissenschaftlich gegenüberzustellen.
Welche drei großen Spracherwerbshypothesen werden diskutiert?
Die Arbeit behandelt die Kontrastivhypothese, die Identitätshypothese und die Interlanguage-Hypothese.
Ist die Kontrastive Linguistik heute noch relevant?
Die Arbeit geht der Frage nach, ob die Disziplin am Ende ist oder ob sie durch neue Fragestellungen weiterhin eine wichtige Rolle in der Sprachwissenschaft spielt.
Details
- Titel
- Ist die Kontrastive Linguistik zu ihrem Ende gekommen?
- Untertitel
- Die Chancen und Herausforderungen aus ihrer historischen Entstehung
- Hochschule
- Universität Duisburg-Essen (Institut für Deutsch als Zweit- und Fremdsprache)
- Note
- 1,7
- Autor
- Julien Dietrich (Autor:in)
- Erscheinungsjahr
- 2018
- Seiten
- 39
- Katalognummer
- V481992
- ISBN (eBook)
- 9783668963603
- ISBN (Buch)
- 9783668963610
- Sprache
- Deutsch
- Schlagworte
- Kontrastive Linguistik Spracherwerb Linguistik Nativismus Behaviorismus Kontrastivhypothese Interlanguage Interimssprache Intergenerative Grammatik Identitätshypothese Chomsky Skinner Sprachtypologie Areallinguistik tertium comparationis Fremdsprachenunterricht DaF DaZ Deutsch als Fremdsprache Deutsch als Zweitsprache Historisch-vergleichende Sprachwissenschaft Germanistik Deutsch Spracherwerbshypothesen Fremdsprachendidaktik Schlegel Saussure Weinreich Fremdsprachenerwerb Boas Sapir Bloomfield foreign language Ersprache Zweitsprache L1 L2 L1-Erwerb L2-Erwerb Tertiärsprache Transfer Fries Lado LAD Selinker Lernersprache back-sliding critical period Sanskrit Morphologie Language-Awareness Interferen Sprachunterricht Pragmatik
- Produktsicherheit
- GRIN Publishing GmbH
- Preis (Ebook)
- US$ 16,99
- Preis (Book)
- US$ 18,99
- Arbeit zitieren
- Julien Dietrich (Autor:in), 2018, Ist die Kontrastive Linguistik zu ihrem Ende gekommen?, München, Page::Imprint:: GRINVerlagOHG, https://www.diplomarbeiten24.de/document/481992
- Autor werden
- Ihre Optionen
- Vertriebskanäle
- Premium Services
- Autorenprofil
- Textarten und Formate
- Services für Verlage, Hochschulen, Unternehmen

- © GRIN Publishing GmbH.
- Alle Inhalte urheberrechtlich geschützt. Kopieren und verbreiten untersagt.
- info@grin.com
- AGB
- Open Publishing
Der GRIN Verlag hat sich seit 1998 auf die Veröffentlichung akademischer eBooks und Bücher spezialisiert. Der GRIN Verlag steht damit als erstes Unternehmen für User Generated Quality Content. Die Verlagsseiten GRIN.com, Hausarbeiten.de und Diplomarbeiten24 bieten für Hochschullehrer, Absolventen und Studenten die ideale Plattform, wissenschaftliche Texte wie Hausarbeiten, Referate, Bachelorarbeiten, Masterarbeiten, Diplomarbeiten, Dissertationen und wissenschaftliche Aufsätze einem breiten Publikum zu präsentieren.
Kostenfreie Veröffentlichung: Hausarbeit, Bachelorarbeit, Diplomarbeit, Dissertation, Masterarbeit, Interpretation oder Referat jetzt veröffentlichen!
- GRIN Verlag GmbH
-
- Nymphenburger Str. 86
- 80636
- Munich, Deutschland
- +49 89-550559-0
- +49 89-550559-10
- info@grin.com
-









