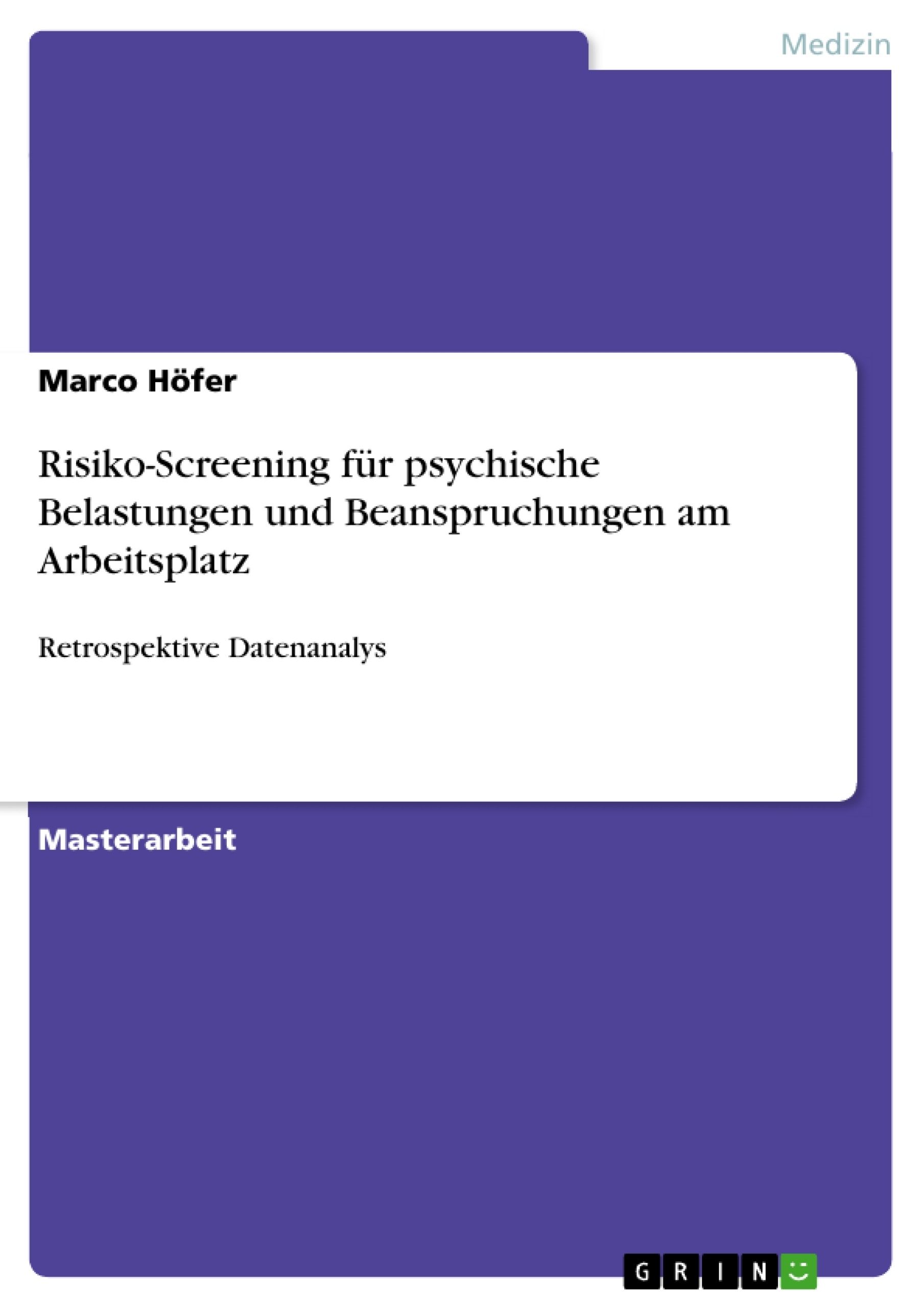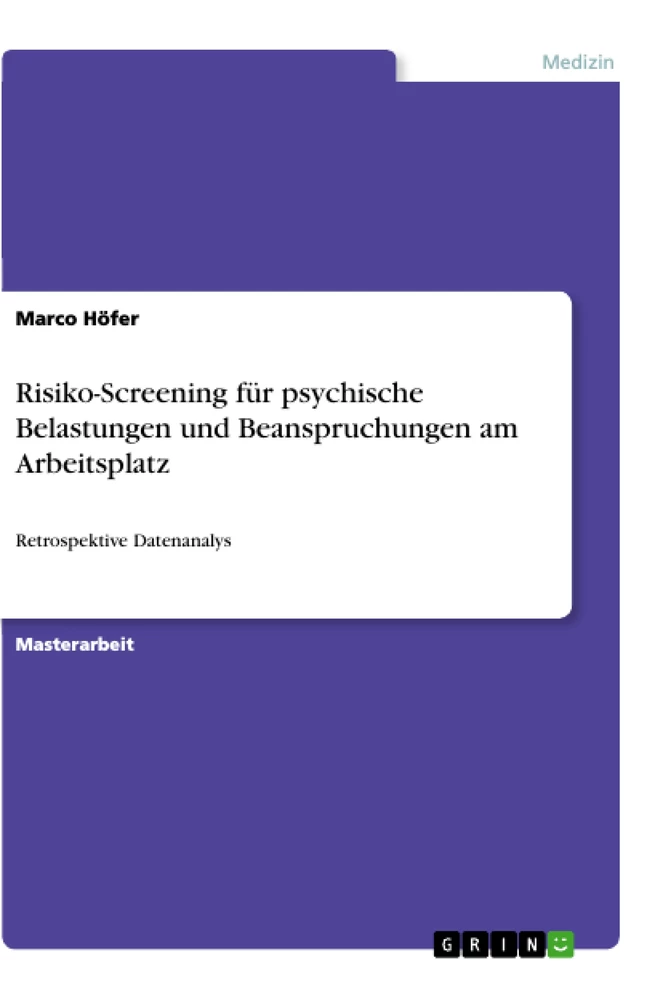
Risiko-Screening für psychische Belastungen und Beanspruchungen am Arbeitsplatz
Masterarbeit, 2019
104 Seiten, Note: 2,1
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
- 1 EINLEITUNG UND PROBLEMSTELLUNG
- 2 ZIELSETZUNG
- 3 GEGENWÄRTIGER KENNTNISSTAND
- 3.1 Einordung der Begriffe Gesundheit, BGM, BGF und Arbeitsschutz
- 3.1.1 Gesundheit
- 3.1.2 Betriebliches Gesundheitsmanagement (BGM)
- 3.1.3 Betriebliche Gesundheitsförderung (BGF)
- 3.1.4 Arbeitsschutz
- 3.2 Einordnung der Begriffe „Psychische Belastung“ und „Stress“
- 3.3 Aktueller Forschungsstand
- 3.3.1 Psychische Belastungen und Erkrankungen im Allgemeinen
- 3.3.2 Psychische Belastungen und Erkrankungen im Arbeitsbezug
- 3.4 Work Ability Index (WAI)
- 3.5 Beschreibung aktueller Screeningverfahren zu psych. Belastungen am Arbeitsplatz
- 3.5.1 Beobachtende Verfahren
- 3.5.2 Interview
- 3.5.3 Fragebogen
- 4 METHODIK
- 4.1 Beschreibung / Vorstellung des Unternehmens (anonymisiert)
- 4.2 Forschungsfragen / Hypothesen
- 4.3 Beschreibung der Stichprobe
- 4.4 Forschungsdesign
- 4.5 Datenerhebung
- 4.6 Datenauswertung
- 5 ERGEBNISSE
- 5.1 Deskriptive Auswertung
- 5.2 Inferenzstatistik
- 5.2.1 Hypothesenprüfungen der Unterschiedshypothesen (F1-H1 und F2-H3)
- 5.2.2 Hypothesenprüfung der Zusammenhangshypothese (F3-H6)
- 5.2.3 Sonstige Hypothesenprüfungen (F2-H2, F3-H4 und F3-H5)
- 5.2.4 Beantwortung der Forschungsfragen
- 6 DISKUSSION
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Masterarbeit zielt darauf ab, eine retrospektive Datenanalyse eines Risiko-Screenings für psychische Belastungen und Beanspruchungen am Arbeitsplatz im Kontext eines Industrieunternehmens durchzuführen. Die Arbeit untersucht die Wirksamkeit des Screening-Instruments und dessen Bedeutung für die betriebliche Gesundheitsförderung. Sie beleuchtet den aktuellen Forschungsstand zu psychischen Belastungen und Erkrankungen im Arbeitskontext, um das Screening-Instrument in einen wissenschaftlichen Kontext einzuordnen.
- Die Auswirkungen psychischer Belastungen und Beanspruchungen am Arbeitsplatz auf die Gesundheit der Mitarbeiter
- Die Relevanz eines Risiko-Screenings für die frühzeitige Erkennung von psychischen Belastungen
- Die Validität und Zuverlässigkeit des eingesetzten Screening-Instruments
- Die Bedeutung des Betrieblichen Gesundheitsmanagements (BGM) für die Prävention von psychischen Belastungen
- Die Rolle von Führungsverhalten und organisatorischen Faktoren bei der Entstehung von psychischen Belastungen
Zusammenfassung der Kapitel
Die Arbeit beginnt mit einer Einleitung, die die Problemstellung und die Relevanz des Themas „Psychische Belastungen und Beanspruchungen am Arbeitsplatz“ beleuchtet. Anschließend wird die Zielsetzung der Arbeit dargelegt und der aktuelle Forschungsstand zu den Themen Gesundheit, Betriebliches Gesundheitsmanagement, Psychische Belastung und Stress, sowie zum Work Ability Index (WAI) erläutert. Kapitel 3 widmet sich der Beschreibung aktueller Screeningverfahren für psychische Belastungen am Arbeitsplatz. Die Methodik der Arbeit wird in Kapitel 4 vorgestellt, einschließlich der Beschreibung des Unternehmens, der Forschungsfragen, der Stichprobe, des Forschungsdesigns, der Datenerhebung und der Datenauswertung.
Kapitel 5 präsentiert die Ergebnisse der deskriptiven und inferenzstatistischen Auswertung der Daten. Die Ergebnisse der Hypothesenprüfungen werden dargestellt, die den Zusammenhang zwischen den Screening-Ergebnissen und den Arbeitsbedingungen untersuchen. Die Arbeit endet mit einer Diskussion der Ergebnisse, die die Bedeutung der Erkenntnisse für die Praxis beleuchtet.
Schlüsselwörter
Psychische Belastungen, Beanspruchungen, Risiko-Screening, Betriebliches Gesundheitsmanagement (BGM), Arbeitsschutz, Work Ability Index (WAI), Gesundheit, Stress, Depression, Burn-out, Bore-out, Industrieunternehmen, Forschungsdesign, Inferenzstatistik, Datenanalyse
Häufig gestellte Fragen
Was ist das Ziel eines Risiko-Screenings am Arbeitsplatz?
Es dient der frühzeitigen Erkennung von psychischen Belastungen und Beanspruchungen, um präventive Maßnahmen im Rahmen des Arbeitsschutzes einzuleiten.
Welche Rolle spielt das Betriebliche Gesundheitsmanagement (BGM)?
Das BGM bildet den organisatorischen Rahmen, um Gesundheit als strategischen Faktor zu verankern und psychische Belastungen durch systematische Analysen zu minimieren.
Was ist der Work Ability Index (WAI)?
Der WAI ist ein Instrument zur Erfassung der Arbeitsfähigkeit eines Mitarbeiters, das in der Arbeit als Teil des theoretischen Hintergrunds herangezogen wird.
Welche psychischen Auswirkungen werden in der Studie untersucht?
Untersucht werden Auswirkungen wie Stress, Burn-out-Symptome, Depressionen oder Bore-out im Kontext der Arbeitsumgebung.
Welche Ressourcen helfen Mitarbeitern bei der Bewältigung von Belastungen?
Die Arbeit unterscheidet zwischen externalen Ressourcen (z. B. Unterstützung durch Kollegen) und persönlichen Ressourcen (z. B. individuelle Coping-Strategien).
Details
- Titel
- Risiko-Screening für psychische Belastungen und Beanspruchungen am Arbeitsplatz
- Untertitel
- Retrospektive Datenanalys
- Hochschule
- Deutsche Hochschule für Prävention und Gesundheitsmanagement GmbH
- Note
- 2,1
- Autor
- Marco Höfer (Autor:in)
- Erscheinungsjahr
- 2019
- Seiten
- 104
- Katalognummer
- V497064
- ISBN (eBook)
- 9783668997738
- ISBN (Buch)
- 9783668997745
- Sprache
- Deutsch
- Schlagworte
- Betriebliches Gesundheitsmanagement Psychische Belastung Psychische Beanspruchung Risiko-Screening Datenanalyse Sekundäranalyse Industrie Arbeitsbelastung Stress
- Produktsicherheit
- GRIN Publishing GmbH
- Preis (Ebook)
- US$ 39,99
- Preis (Book)
- US$ 50,99
- Arbeit zitieren
- Marco Höfer (Autor:in), 2019, Risiko-Screening für psychische Belastungen und Beanspruchungen am Arbeitsplatz, München, Page::Imprint:: GRINVerlagOHG, https://www.diplomarbeiten24.de/document/497064
- Autor werden
- Ihre Optionen
- Vertriebskanäle
- Premium Services
- Autorenprofil
- Textarten und Formate
- Services für Verlage, Hochschulen, Unternehmen

- © GRIN Publishing GmbH.
- Alle Inhalte urheberrechtlich geschützt. Kopieren und verbreiten untersagt.
- info@grin.com
- AGB
- Open Publishing
Der GRIN Verlag hat sich seit 1998 auf die Veröffentlichung akademischer eBooks und Bücher spezialisiert. Der GRIN Verlag steht damit als erstes Unternehmen für User Generated Quality Content. Die Verlagsseiten GRIN.com, Hausarbeiten.de und Diplomarbeiten24 bieten für Hochschullehrer, Absolventen und Studenten die ideale Plattform, wissenschaftliche Texte wie Hausarbeiten, Referate, Bachelorarbeiten, Masterarbeiten, Diplomarbeiten, Dissertationen und wissenschaftliche Aufsätze einem breiten Publikum zu präsentieren.
Kostenfreie Veröffentlichung: Hausarbeit, Bachelorarbeit, Diplomarbeit, Dissertation, Masterarbeit, Interpretation oder Referat jetzt veröffentlichen!
- GRIN Verlag GmbH
-
- Nymphenburger Str. 86
- 80636
- Munich, Deutschland
- +49 89-550559-0
- +49 89-550559-10
- info@grin.com
-