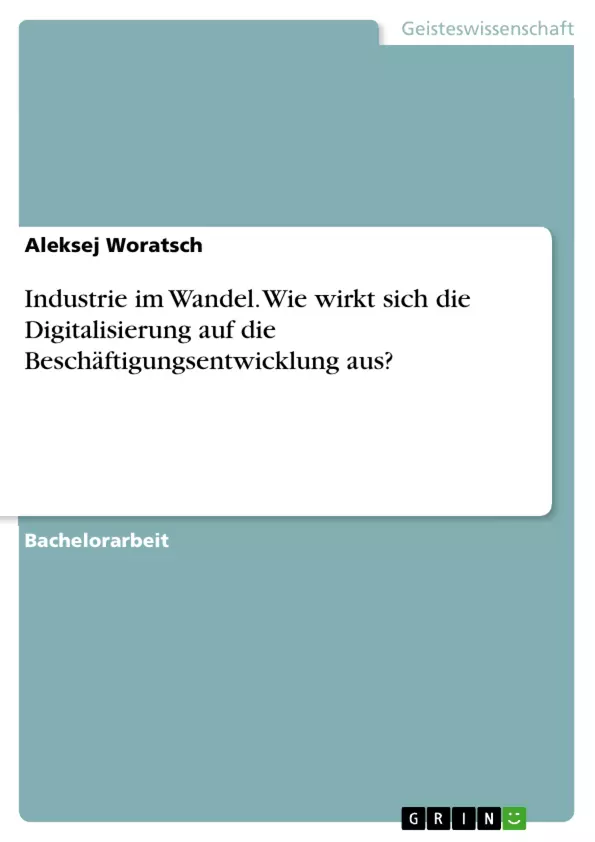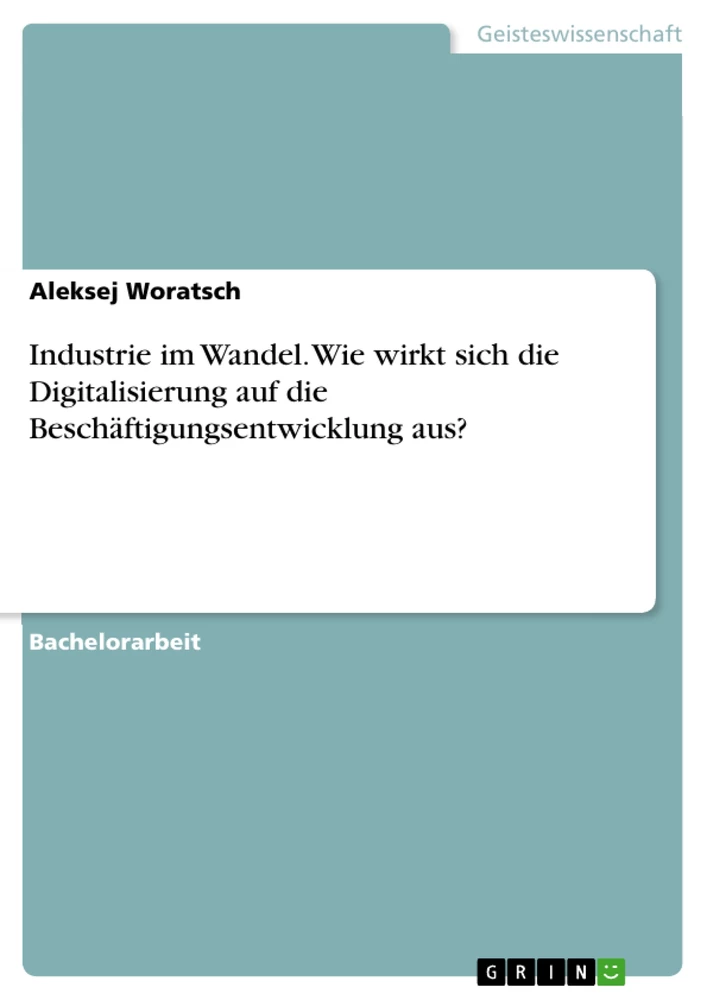
Industrie im Wandel. Wie wirkt sich die Digitalisierung auf die Beschäftigungsentwicklung aus?
Bachelorarbeit, 2019
35 Seiten, Note: 1,9
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Soziotechnischer Wandel
- Technik als strukturbildendes Element
- Technik als Institution
- Impulse des Wandels
- Verlauf soziotechnischen Wandels
- Industrie 4.0
- Begriffseingrenzung Digitalisierung
- Begriffseingrenzung Industrie 4.0
- Disruption in der Industrie 4.0
- Konzept der disruptiven Innovation
- Disruptive Impulse der Technologiebranche
- Zwischenfazit
- Wandlungsprozesse
- Industrielle Wandlungsprozesse
- Cyber-physische Systeme
- Scientific Management
- Kritik
- Gegenwärtige Wandlungsprozesse
- Dezentralisierung der Produktion
- Technische Innovationen im Vertrieb
- Scientific Management in der Industrie 4.0
- Beschäftigungsentwicklung in der Industrie 4.0
- Theoretisches Konzept
- Substituierbarkeit von Arbeitsplätzen
- Beschäftigungsentwicklung in Deutschland
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit untersucht die Auswirkungen der Digitalisierung auf die Beschäftigungsentwicklung im Kontext der Industrie 4.0. Sie analysiert soziotechnische Wandlungsprozesse und die Rolle des Scientific Managements in der industriellen Produktion.
- Soziotechnischer Wandel und Digitalisierung
- Industrielle Wandlungsprozesse in der Industrie 4.0
- Disruptive Innovation und ihre Auswirkungen
- Substitution von Arbeitsplätzen durch Automatisierung
- Beschäftigungsentwicklung in Deutschland
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in das Thema der Digitalisierung und ihrer Auswirkungen auf die Arbeitswelt ein und skizziert den Aufbau der Arbeit. Kapitel 2 beleuchtet den soziotechnischen Wandel und definiert zentrale Begriffe wie Industrie 4.0 und Digitalisierung. Im Fokus stehen die disruptiven Innovationen und deren Einfluss auf die Gesellschaft. Kapitel 3 behandelt industrielle Wandlungsprozesse und die Rolle des Scientific Managements. Dabei werden aktuelle Entwicklungen in Produktion und Vertrieb im Rahmen der Industrie 4.0 analysiert. Kapitel 4 widmet sich der Substitution von Arbeitsplätzen durch Automatisierung und beleuchtet dies anhand relevanter Studien. Es wird die Beschäftigungsentwicklung in Deutschland im Kontext der Industrie 4.0 beleuchtet.
Schlüsselwörter
Soziotechnischer Wandel, Digitalisierung, Industrie 4.0, Disruptive Innovation, Scientific Management, Automatisierung, Substitution von Arbeitsplätzen, Beschäftigungsentwicklung, Deutschland.
Details
- Titel
- Industrie im Wandel. Wie wirkt sich die Digitalisierung auf die Beschäftigungsentwicklung aus?
- Hochschule
- Justus-Liebig-Universität Gießen
- Note
- 1,9
- Autor
- Aleksej Woratsch (Autor:in)
- Erscheinungsjahr
- 2019
- Seiten
- 35
- Katalognummer
- V499402
- ISBN (eBook)
- 9783346029737
- ISBN (Buch)
- 9783346029744
- Sprache
- Deutsch
- Schlagworte
- industrie wandel digitalisierung beschäftigungsentwicklung
- Produktsicherheit
- GRIN Publishing GmbH
- Preis (Ebook)
- US$ 16,99
- Preis (Book)
- US$ 18,99
- Arbeit zitieren
- Aleksej Woratsch (Autor:in), 2019, Industrie im Wandel. Wie wirkt sich die Digitalisierung auf die Beschäftigungsentwicklung aus?, München, Page::Imprint:: GRINVerlagOHG, https://www.diplomarbeiten24.de/document/499402
- Autor werden
- Ihre Optionen
- Vertriebskanäle
- Premium Services
- Autorenprofil
- Textarten und Formate
- Services für Verlage, Hochschulen, Unternehmen

- © GRIN Publishing GmbH.
- Alle Inhalte urheberrechtlich geschützt. Kopieren und verbreiten untersagt.
- info@grin.com
- AGB
- Open Publishing
Der GRIN Verlag hat sich seit 1998 auf die Veröffentlichung akademischer eBooks und Bücher spezialisiert. Der GRIN Verlag steht damit als erstes Unternehmen für User Generated Quality Content. Die Verlagsseiten GRIN.com, Hausarbeiten.de und Diplomarbeiten24 bieten für Hochschullehrer, Absolventen und Studenten die ideale Plattform, wissenschaftliche Texte wie Hausarbeiten, Referate, Bachelorarbeiten, Masterarbeiten, Diplomarbeiten, Dissertationen und wissenschaftliche Aufsätze einem breiten Publikum zu präsentieren.
Kostenfreie Veröffentlichung: Hausarbeit, Bachelorarbeit, Diplomarbeit, Dissertation, Masterarbeit, Interpretation oder Referat jetzt veröffentlichen!
- GRIN Verlag GmbH
-
- Nymphenburger Str. 86
- 80636
- Munich, Deutschland
- +49 89-550559-0
- +49 89-550559-10
- info@grin.com
-