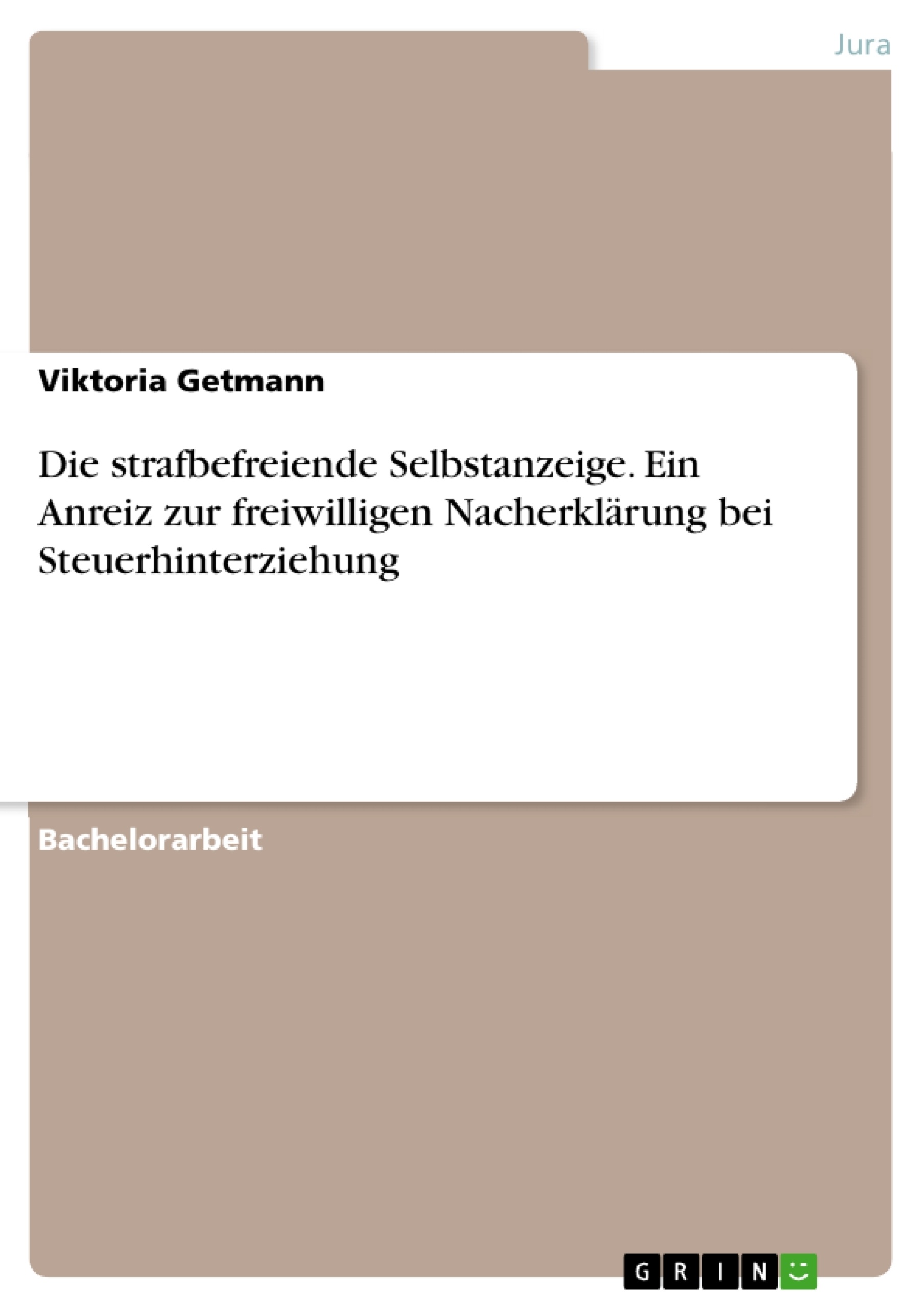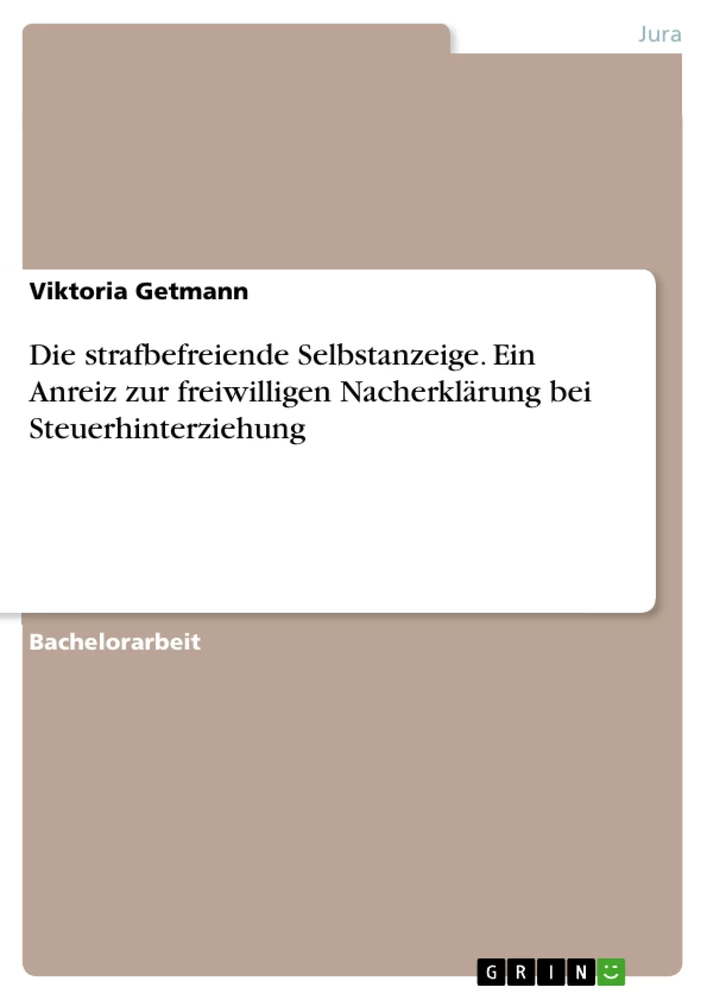
Die strafbefreiende Selbstanzeige. Ein Anreiz zur freiwilligen Nacherklärung bei Steuerhinterziehung
Bachelorarbeit, 2019
46 Seiten, Note: 1,0
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
- Steuerhinterziehung
- Straftatbestand der Steuerhinterziehung
- Objektiver Tatbestand
- Subjektiver Tatbestand
- Unterscheidung: Berichtigte Steuererklärung oder Selbstanzeige
- Straftatbestand der Steuerhinterziehung
- Die (strafbefreiende) Selbstanzeige
- Sinn und Zweck der Regelung
- Form der Selbstanzeige
- Voraussetzungen der strafbefreienden Selbstanzeige
- Vollständigkeitsgebot
- Ausschluss aufgrund eines Sperrgrundes
- Vollständige und fristgerechte Nachzahlung
- Sperrgründe
- Prüfungsanordnung
- Ermittlungsverfahren
- Erscheinen eines Amtsträgers
- Tatentdeckung
- Verkürzungsbetrag und schwerer Fall der Steuerhinterziehung
- Wirkung
- Selbstanzeige bei Umsatzsteuervor- und Lohnsteueranmeldungen
- Die heutige Selbstanzeige: Abriss der historischen Entwicklung
- § 371 Abs. 2a AO
- Hintergrund für die Wiedereinführung der Teilselbstanzeigen
- Fallkatalog
- Bewertung
- Exkurs: Praxis im Innendienst
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Bachelorarbeit befasst sich mit der strafbefreienden Selbstanzeige im Steuerrecht, insbesondere im Kontext des § 371 Abs. 2a AO. Ziel ist es, die rechtlichen Grundlagen der Selbstanzeige zu erforschen, ihre Voraussetzungen und Auswirkungen zu erläutern und ihre Anwendung in der Praxis zu beleuchten.
- Der Straftatbestand der Steuerhinterziehung und seine rechtlichen Grundlagen
- Die strafbefreiende Selbstanzeige als Möglichkeit der Vermeidung strafrechtlicher Konsequenzen
- Die besonderen Anforderungen und Auswirkungen der Selbstanzeige bei Umsatzsteuervor- und Lohnsteueranmeldungen
- Die rechtlichen und praktischen Herausforderungen der Selbstanzeige im Kontext des § 371 Abs. 2a AO
- Die Bedeutung der Selbstanzeige für die Steuergerechtigkeit und die Bekämpfung von Steuerhinterziehung
Zusammenfassung der Kapitel
Kapitel 1 behandelt den Straftatbestand der Steuerhinterziehung, wobei sowohl der objektive als auch der subjektive Tatbestand beleuchtet werden. Anschließend wird die Unterscheidung zwischen einer berichtigten Steuererklärung und einer Selbstanzeige thematisiert.
Kapitel 2 widmet sich der strafbefreienden Selbstanzeige im Allgemeinen. Zuerst wird der Sinn und Zweck der Regelung sowie die Form der Selbstanzeige erläutert. Anschließend werden die Voraussetzungen für eine strafbefreiende Selbstanzeige, wie Vollständigkeit, Ausschluss durch Sperrgründe und fristgerechte Nachzahlung, dargelegt. Im Folgenden werden die verschiedenen Sperrgründe, wie Prüfungsanordnung, Ermittlungsverfahren, Erscheinen eines Amtsträgers, Tatentdeckung und Verkürzungsbetrag, im Detail betrachtet. Abschließend wird die Wirkung der Selbstanzeige behandelt.
Kapitel 3 konzentriert sich auf die Anwendung der Selbstanzeige bei Umsatzsteuervor- und Lohnsteueranmeldungen. Hierbei wird die historische Entwicklung der Selbstanzeige skizziert und der § 371 Abs. 2a AO im Detail analysiert. Besonderer Fokus liegt auf den Hintergründen für die Wiedereinführung der Teilselbstanzeige und auf dem dazugehörigen Fallkatalog. Abschließend wird eine Bewertung der aktuellen Regelung vorgenommen.
Kapitel 4 bietet einen Exkurs in die Praxis im Innendienst. Dieses Kapitel behandelt die Anwendung der Selbstanzeige aus Sicht der Finanzverwaltung.
Schlüsselwörter
Die vorliegende Arbeit befasst sich mit der strafbefreienden Selbstanzeige im Steuerrecht, insbesondere im Kontext des § 371 Abs. 2a AO. Im Zentrum stehen Themen wie Steuerhinterziehung, strafbefreiende Selbstanzeige, Vollständigkeit, Sperrgründe, Umsatzsteuervor- und Lohnsteueranmeldungen, Teilselbstanzeige, Prüfungsanordnung, Ermittlungsverfahren und Tatentdeckung. Die Arbeit analysiert die rechtlichen Grundlagen, Voraussetzungen und Auswirkungen der Selbstanzeige sowie ihre praktische Relevanz im Steuerwesen.
Häufig gestellte Fragen
Wann führt eine Selbstanzeige bei Steuerhinterziehung zur Straffreiheit?
Eine Selbstanzeige führt zur Straffreiheit, wenn sie vollständig ist, rechtzeitig vor Entdeckung der Tat erfolgt und die hinterzogenen Steuern fristgerecht nachgezahlt werden.
Was ist das Vollständigkeitsgebot bei einer Selbstanzeige?
Der Steuerpflichtige muss alle steuerlich erheblichen Tatsachen zu allen unverjährten Steuerstraftaten einer Steuerart in vollem Umfang offenlegen.
Welche Sperrgründe verhindern eine strafbefreiende Selbstanzeige?
Sperrgründe sind unter anderem die Bekanntgabe einer Prüfungsanordnung, das Erscheinen eines Amtsträgers zur steuerlichen Prüfung, die Einleitung eines Strafverfahrens oder die Entdeckung der Tat.
Was gilt für Selbstanzeigen bei Umsatzsteuervoranmeldungen?
Gemäß § 371 Abs. 2a AO gibt es Besonderheiten für Umsatzsteuervor- und Lohnsteueranmeldungen, die unter bestimmten Voraussetzungen Teilselbstanzeigen ermöglichen.
Was ist der Unterschied zwischen einer Berichtigung und einer Selbstanzeige?
Eine Berichtigung nach § 153 AO erfolgt bei unbewussten Fehlern, während eine Selbstanzeige nach § 371 AO bei vorsätzlicher oder leichtfertiger Steuerhinterziehung notwendig ist, um Straffreiheit zu erlangen.
Details
- Titel
- Die strafbefreiende Selbstanzeige. Ein Anreiz zur freiwilligen Nacherklärung bei Steuerhinterziehung
- Hochschule
- Hochschule für öffentliche Verwaltung und Finanzen Ludwigsburg; ehem. Fachhochschule Ludwigsburg
- Note
- 1,0
- Autor
- Viktoria Getmann (Autor:in)
- Erscheinungsjahr
- 2019
- Seiten
- 46
- Katalognummer
- V499634
- ISBN (eBook)
- 9783346034403
- ISBN (Buch)
- 9783346034410
- Sprache
- Deutsch
- Schlagworte
- selbstanzeige anreiz nacherklärung steuerhinterziehung
- Produktsicherheit
- GRIN Publishing GmbH
- Preis (Ebook)
- US$ 20,99
- Preis (Book)
- US$ 29,99
- Arbeit zitieren
- Viktoria Getmann (Autor:in), 2019, Die strafbefreiende Selbstanzeige. Ein Anreiz zur freiwilligen Nacherklärung bei Steuerhinterziehung, München, Page::Imprint:: GRINVerlagOHG, https://www.diplomarbeiten24.de/document/499634
- Autor werden
- Ihre Optionen
- Vertriebskanäle
- Premium Services
- Autorenprofil
- Textarten und Formate
- Services für Verlage, Hochschulen, Unternehmen

- © GRIN Publishing GmbH.
- Alle Inhalte urheberrechtlich geschützt. Kopieren und verbreiten untersagt.
- info@grin.com
- AGB
- Open Publishing
Der GRIN Verlag hat sich seit 1998 auf die Veröffentlichung akademischer eBooks und Bücher spezialisiert. Der GRIN Verlag steht damit als erstes Unternehmen für User Generated Quality Content. Die Verlagsseiten GRIN.com, Hausarbeiten.de und Diplomarbeiten24 bieten für Hochschullehrer, Absolventen und Studenten die ideale Plattform, wissenschaftliche Texte wie Hausarbeiten, Referate, Bachelorarbeiten, Masterarbeiten, Diplomarbeiten, Dissertationen und wissenschaftliche Aufsätze einem breiten Publikum zu präsentieren.
Kostenfreie Veröffentlichung: Hausarbeit, Bachelorarbeit, Diplomarbeit, Dissertation, Masterarbeit, Interpretation oder Referat jetzt veröffentlichen!
- GRIN Verlag GmbH
-
- Nymphenburger Str. 86
- 80636
- Munich, Deutschland
- +49 89-550559-0
- +49 89-550559-10
- info@grin.com
-